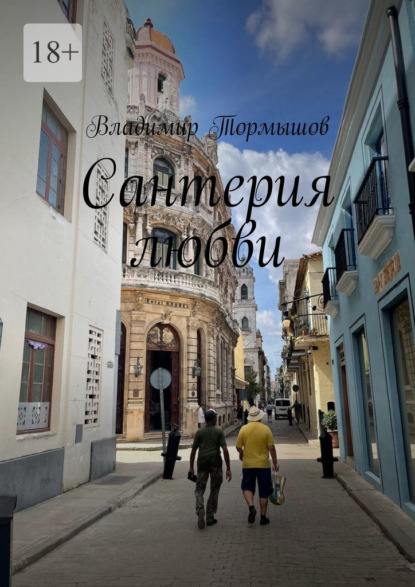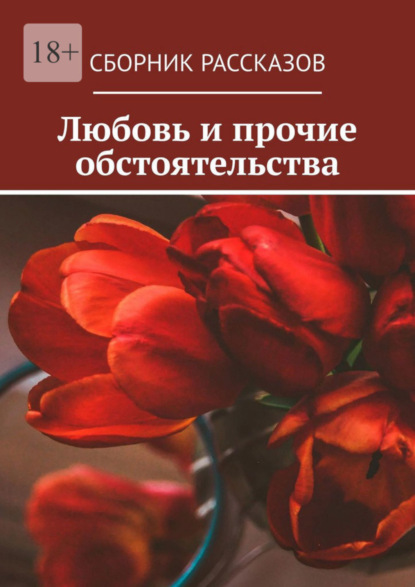Homöopathie für Pflanzen - Der Klassiker in der 15. Auflage

- -
- 100%
- +
1.2 Homöopathische Grundlagen – kurzgefasst

Wenn wir einen kranken Menschen mit klassischer Homöopathie behandeln, ist für uns Homöopathen der Krankheitsname oder die medizinische Diagnose in der Fallaufnahme zunächst von untergeordneter Bedeutung: Im Mittelpunkt stehen die Beschwerden des Patienten. Wir versuchen herauszufinden
• wodurch seine Beschwerden verursacht wurden,
• wie sich seine Beschwerden äußern und wo sie lokalisiert sind und
• wodurch sich seine Beschwerden bessern oder verschlechtern.
Nicht weniger wichtig sind die Angaben, die den Menschen charakterisieren: Ist der Patient beispielsweise ein eher extrovertierter oder introvertierter Mensch, gibt es ausgeprägte Ängste oder typische Verhaltensweisen, lassen sich Vorlieben oder Abneigungen auf bestimmte Nahrungsmittel ausmachen oder leidet der Patient an spezifischen klimatischen Einflüssen. Zudem werden gezielte Fragen zu seiner Krankengeschichte und der seiner Vorfahren gestellt, um Hinweise auf seine genetische Veranlagung zu bekommen. Diese Schilderungen geben dem Homöopathen Informationen über das für den Patienten individuelle homöopathische Arzneimittel.
Dieses homöopathische Arzneimittel, das gegen seine Beschwerden verabreicht wird, verursacht sehr ähnliche Krankheitsbeschwerden, wenn es über einige Zeit in gesundem Zustand eingenommen wird.

Das Arzneimittel verursacht nach Einnahme in gesundem Zustand genau die gleichen Symptome, wie es bei einem Kranken ähnliche Symptome heilt.
Beispiel: Nimmt ein Gesunder z. B. Belladonna (= Tollkirsche) in einer tiefen Potenz (D 3, D 4, D 6) über ein paar Tage ein, wird er – als Zeichen der Arzneimittelprüfung – mit heftigsten Kopfschmerzen, schmerzhaften, brennenden Augen, starker Lichtempfindlichkeit, heftigem Fieber mit dampfendem Schweiß, tomatenrotem Gesicht, starkem Frieren und evtl. Fieberphantasien auf die Einnahme reagieren. In unserer Praxis haben wir nun vielleicht ein Kind mit genau diesen Fieber- und Krankheitssymptomen. Wenn wir jetzt Belladonna verabreichen, wird diese Arznei nicht noch kränker machen, sondern zuverlässig und schnell heilen.

Abb. 1.4: Tollkirsche (Belladonna).
Dies ist das „Ähnlichkeitsprinzip“ nach Samuel Hahnemann: „Ähnliches wird durch Ähnliches geheilt“. Samuel Hahnemann wusste um die Naturgesetze. Das gleiche Prinzip beherrschen noch einige Naturvölker: Bei den Aboriginies oder bei den Pygmäen wird ein Buschfeuer mit einem gezielten Gegenfeuer gelöscht. Es handelt sich beim „Ähnlichkeitsgesetz“ also um ein mathematisches Naturgesetz = Minus mal Minus gibt Plus.

Von ebenso zentraler Bedeutung ist die richtige Zubereitung des ausgewählten Arzneimittels. In der Homöopathie ist dies der Prozess der Verdünnung und der rhythmischen Verschüttelung der in Alkohol aufgelösten oder mit Milchzucker verriebenen Ursubstanz. Durch diesen „dynamischen Prozess“ wird das Material der Ursubstanz einer Arznei umgewandelt in eine „geistige Form“, in ein Schwingungsmuster, in die Information einer Arznei.
Bei richtiger Arzneiwahl passt diese „geistige Form der Arznei“ in unsere „Lebenskraft“ wie ein Schlüssel ins Schloss. Und sie wirkt eigenartigerweise umso stärker, je stärker sie potenziert (= verdünnt und dynamisiert) wurde. Hier haben wir es dann mit „Hochpotenzen“ (

EXKURS
Die Auswahl der „richtigen“ Potenzhöhe ist eine Wissenschaft für sich und die Erklärung würde an dieser Stelle viel zu weit führen. Deshalb versuche ich, mich auf das zu beschränken, was für Sie als Gartenliebhaber(in) wichtig ist:
• Die D-Potenzen (D 1– D 23) sind sogenannte Tiefpotenzen, die noch Materie beinhalten; d. h., sie enthalten noch Spuren der Ausgangssubstanz und wirken düngerähnlich (

• Die C-Potenzen (C 30, C 200 und höher,


Abb. 1.5: Homöopathische Mittel.
Skeptiker der Hochpotenzen meinen, man könne genauso gut ein Stück Zucker in den Ozean werfen, Hochpotenzen hätten die gleiche Wirkung – nämlich keine. Wenn man ein Stück Zucker in den Ozean wirft, wird man kaum Wirkung nachweisen können. Wie und warum wirken diese „Nichtse“ der Homöopathie trotzdem? Ist das alles nur Einbildung, handelt es sich um Plazebos? Pflanzen reagieren absolut nicht auf Plazebogaben, sondern zeigen klar und deutlich, ob eine Arznei passt und heilt oder nicht. Pflanzen „interpretieren“ keine Verbesserung oder Verschlechterung, wie dies häufig der Mensch subjektiv empfindet. Wenn wir der Pflanze das richtige Arzneimittel geben, können wir schnell objektiv beurteilen, ob die Arznei der Pflanze hilft.
Immer wieder konnte ich beobachten, dass Pflanzen sehr gut auf homöopathische Hochpotenzen (C 30, C 200, C 1000, C 10 000 und C 100 000) reagieren – erfreulich zügig und schnell. Im vorliegenden Garten-Ratgeber verwende ich als Düngegaben die D-Potenzen, ansonsten jedoch hauptsächlich die Hochpotenzen C 30–C 200 und bei einigen wenigen Indikationen auch C 1000.
1.3 Homöopathischer Kompass für den Garten
Wie bei der Behandlung am Menschen ist es auch bei der Behandlung von Pflanzen wichtig, die mögliche Ursache der Pflanzenerkrankung, die Modalitäten (= wodurch bessert und wodurch verschlimmert sich der Zustand) zu kennen. Im vorliegenden Ratgeber habe ich in der Modalitätentabelle (


Abb. 1.6: Ausfüllen der Modalitätentabelle.
Ferner ist wichtig: Mit welchen Symptomen zeigt sich die Krankheit? Wodurch wurde sie ausgelöst? Vielleicht durch lang andauernde Regenperioden, Dürre, Kälte, Trockenheit, Insektenbefall? Diese Ursachen sind oft der Schlüssel zur Bestimmung des passenden Arzneimittels. Wenn wir die Ursachen eingrenzen können, ist die Pflanzenbehandlung einfach.
Oft kennen wir die Ursache jedoch nicht. Deshalb ist es bei unklarer Erkrankung der Pflanzen natürlich deutlich schwieriger, zu behandeln. Man versucht, die Symptome der kranken Pflanze zu „interpretieren“ und zu „verdolmetschen“. Handelt es sich vielleicht um eine häufig vorkommende, typische Pflanzenkrankheit, um einen schlechten Standort, liegt ein Nährstoffmangel vor oder falsche Pflege, oder was könnte sonst der Grund sein? Auch hier hilft bei der Auswahl des Arzneimittels die Modalitätentabelle (


Um das richtige Arzneimittel zu bestimmen, habe ich im Anhang einige Hilfsmittel zusammengestellt. Um mögliche Ursachen für Pflanzenkrankheiten einzugrenzen, benutzen Sie die Modalitätentabelle (

Die Modalitäten kennzeichnen die Art und Weise bzw. den Umstand, wodurch sich ein Symptom verbessert oder verschlimmert. Im vorliegenden Buch sind logischerweise bei der Behandlung von Pflanzenkrankheiten nur die „Verschlimmerungen“ in der Ursachenliste vermerkt.
Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, sollten Sie die Modalitätentabelle mehrfach kopieren, damit Sie Ihre Eintragungen vornehmen können. Außerdem benötigen Sie einen Farbstift oder Text-Marker, um die entsprechenden Kreuzchen zu markieren. Ein Lineal hilft Ihnen, in der Zeile nicht zu verrutschen. Gehen Sie dann wie folgt vor.
• Sehen Sie sich Ihre kränkelnde Pflanze genau an: Ist der jetzige Zustand evtl. Folge von Frost oder Hitze oder Hagelschlag? Handelt es sich um eine Pilzerkrankung oder Sonstiges? Ist die Pflanze von Schädlingen befallen? Bestimmen Sie, um was es sich handelt.
• „Repertorisation“:
Bestimmen Sie mit Hilfe der Ursachenliste (

– Markieren Sie farbig die entsprechenden Kreuzchen.
– Mit Hilfe Ihres Lineals überprüfen Sie dann (senkrecht), welches Arzneimittel die meisten farbigen Kreuzchen aufweist. Wenn Sie bei einem Arzneimittel zwei, drei oder sogar mehrere markierte Kreuzchen haben, ist dieses Arznei-Präparat mit großer Wahrscheinlichkeit das wirksamste Heilmittel für Ihre kranke Pflanze.
– Dieses Arzneimittel (oder evtl. auch mehrere) notieren Sie auf einem Zettel. Lesen Sie anschließend die einzelnen Arzneien in den Arzneimittelbeschreibungen nach (

• In den Kapiteln 2 und 3 erfahren Sie, dass die einzelnen Pflanzenkrankheiten mit mehreren Arzneien geheilt werden können. Durch das Repertorisieren mittels der Modalitätentabelle (

• In den „Arzneimittelbeschreibungen“ (


Bei den jeweiligen Krankheiten finden Sie eine Liste der am häufigsten eingesetzten homöopathischen Hauptmittel.
Für weitere Mittel wählen Sie aufgrund der Symptome unter Zuhilfenahme der Modalitätentabelle auf Seite 196–197 ein homöopathisches Mittel aus.
Zum Üben der Mittelfindung ist ein Übungsbeispiel auf S. 198 vermerkt.

• Verwenden Sie nur ein Einzelmittel. Stellen Sie bitte keine Mischungen aus mehreren Arzneien her. Vielleicht werde ich zukünftig in Ausnahmefällen für große landwirtschaftliche Betriebe und Gärtnereien zwei Mittel mischen, damit die Ausbringung für große Betriebe nicht so zeitaufwändig ist. Der gleichzeitige Einsatz von mehreren Arzneien muss unbedingt genau abgewogen werden und gehört in die Hände eines erfahrenen Homöopathen. Die Gefahr dabei ist, dass sich nicht alle homöopathischen Arzneien miteinander „vertragen“ und sich gegenseitig unwirksam machen können (= antidotieren). Deshalb bitte nicht selbst „experimentieren“.

Abb. 1.7a: Kontrolle des Befalls.
• Benutzen Sie zum Verrühren nur Plastik-, Porzellan- oder Holzlöffel. Metall kann evtl. die Wirkung des Arzneimittels stören. Deshalb sind Plastik-Gießkannen sinnvoller als solche aus Metall. Nach jedem Gebrauch von homöopathischen Arzneien die Gießkanne reinigen, einfach mit klarem Wasser gut ausspülen.
• Einfaches Übergießen mittels Gießkanne hat sich als effektiver erwiesen als das Sprühen mit einer Pflanzenspritze.
• Übergießen Sie die gesamte Pflanze, also Blattwerk sowie Wurzelbereich. Bei Bäumen den Stamm und das Erdreich bis zur Traufgrenze gießen.

Abb. 1.7b: Abzählen der Globuli.
• Möglichst an einem hellen, trockenen Morgen oder gegen Abend gießen. Die Blätter sollten zügig abtrocknen können. An sonnigen, heißen Tagen nur den Wurzelbereich gießen, da sonst Verbrennungsgefahr der Blätter besteht.
• Gießwasser nicht über die Haut gießen; sonst könnten Sie mit einer Arzneimittelprüfung reagieren (


Abb. 1.7c: Zerdrücken der Globuli.
Dosierung und Anwendung von C-Potenzen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Arzneiwasser zuzubereiten (

• Für Wassermengen bis 10 Liter: Die Globuli direkt in der Plastikgießkanne vollständig auflösen lassen, gründlich mit einem Holzstab verrühren.
• Für größere Wassermengen (20–30 Liter): Die Globuli in einem Schraubdeckelglas (z. B. Marmeladenglas) vollständig auflösen lassen, dann mit dem Deckel verschließen und kräftig schütteln.
• Für 20 Liter Gießwasser teilen Sie die Menge auf zwei 10-Liter-Gießkannen: die Hälfte der Mischung in eine mit 10 Litern gefüllte Plastik-Gießkanne geben. Kräftig mit einem Holzstab oder Plastiklöffel verrühren. Dann mit der zweiten Hälfte ebenso verfahren.

Abb. 1.7d: Aufgelöste Globuli werden ins Gießwasser gegeben.
• Für 30 Liter dritteln Sie die Mischung und verteilen Sie auf drei große Kannen.
• 30 Liter sind in etwa ausreichend für 4–6 Rosensträucher oder Staudenpflanzen. Für einen großen Baum benötigen Sie durchaus 60 Liter Arzneiwasser.