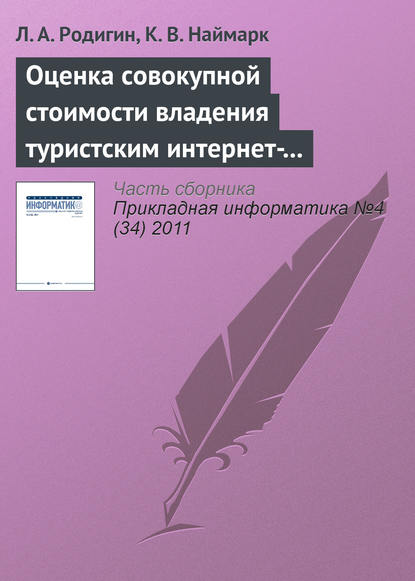- -
- 100%
- +
»Ne-ein?! Und, soll ich dir hundert Zeugen anführen? Ihr seid alle verhaftet, alle haben sie gestanden, sind alle hier, hie-er! Hier kann sich keiner rausreden! Wir kennen jeden eurer Schritte! Wo warst du am 5. Januar? In Makarows Wohnung! Worüber habt ihr gesprochen? Darüber, dass die sowjetische Studentenschaft die beste Plattform für die Konterrevolution darstellt … und dann, warst du nicht mit Freunden auf Sauftour im Metropol und hast die Gedichte des weißen Banditen Gumiljow rezitiert? Und bist nicht am 13. Februar mit dem Dichter Vira aus der Redaktion der ›Mursilka‹ gekommen und hast auf dem Roten Platz aufs Leninmausoleum gezeigt und einen antisowjetischen Witz erzählt? Na? So war’s doch? Wir wissen alles!«
Im ersten Augenblick brachte mich ihr Wissen um die Einzelheiten meines Lebens völlig aus der Fassung, doch dann wurde mir klar, dass er im Grunde nur reine Fakten wusste: wo ich hingegangen war, mit wem was ich getan hatte; die Inhalte meiner Gespräche hingegen waren entweder erfunden oder völlig entstellt.
Ein paar Fragen folgten, dann bot der Ermittler an:
»Setzen Sie sich doch. Möchten Sie rauchen? Nein? Schade. Soll ich was zum Essen bringen lassen?« Er streckte die Hand zu einem Knopf an der Wand aus. »Auch nicht? Schade. Nutzen Sie die Chance zu rauchen oder zu essen, es ist vielleicht Ihre letzte! Wenn Sie gestehen, sieht die Sache natürlich anders aus: zwei, drei Jährchen, die sitzen Sie ab und schon sind Sie wieder vollberechtigter Bürger der Sowjetunion. Wenn Sie aber … Im Übrigen wollen Sie sich doch nicht von Ihrem jungen Leben verabschieden …«
Ich genoss es, im Sessel zu sitzen – es war so bequem! Mir drehte sich ein wenig der Kopf, und bei aller Aufmerksamkeit verwirrten sich meine Gedanken.
»Soo-o.« Der Ermittler wühlte in meinen Fotos umher, sein Blick blieb für einen Moment am Gesicht einer Filmschauspielerin hängen, dann zeigte er mir ein anderes Bild.
»Erkennen Sie den?«
Der Mann, dessen Bild der Ermittler in der Hand hielt, war ein Ingenieur, ein hervorragender Kenner der Literatur und Freund der Jugend. Er pflegte zu unseren literarischen Abenden zu kommen, und manchmal fanden sie bei ihm in der Wohnung statt.
Der Ermittler teilte mir mit:
»Er ist der direkte Anführer eurer Organisation. Er ist Oberst, hat enge Beziehungen zu einem Feindesstaat. Sie sind sein Zuarbeiter bei sich in der Hochschule, Makarow in der Hochschule für Architektur, und Korin im Bergbauinstitut. Kontakt hatte er außerdem mit Woronski und Sosnowski, erbitterten Volksfeinden. Die Namen sind Ihnen hoffentlich bekannt?«
»Ich glaube nicht, dass er ein Konterrevolutionär ist.«
»Er glaubt es nicht! Ooh, was für eine falsche Schlange!«
Er hob sein Bein, trat mir geschickt gegen die Brust, und ich flog mitsamt dem Sessel um und stieß mir den Kopf am Fußboden. Mir drehte sich alles, die Decke verschwamm vor meinen Augen, doch ein paar Sekunden später erhob ich mich bereits langsam auf die Füße.
Schwankend stand ich da und versuchte das Geschehene zu begreifen.
»Wenn du nicht wie ein Mensch mit uns reden willst, können wir uns auch anders unterhalten«, drohte der Ermittler schwer atmend. »Wir werden mit dir nicht viel Federlesens machen, Gesindel. Vielleicht noch einen Prozess anstrengen? Wir knallen dich ab wie einen Hund.«
»Erledige ich«, sagte der Assistent dienstbeflissen, trat an mich heran und hielt mir die Mündung des Brownings an die Schläfe.
»Unterschreibst du?«
Meine Schläfe erstarrt unter dem kalten Stahl. Binnen eines Atemzugs laufen vor meinem inneren Auge Bilder meines fernen Zuhauses und meiner Lieben ab, kurze, unbedeutende Episoden aus meinem Leben. Einen Augenblick nur, und schon bin ich wieder in der schrecklichen Gegenwart. Gleich, jetzt gleich würde ich sterben. Vielleicht sollte ich unterschreiben? Oder doch gleich … ohne lange Qualen. Dann auf einmal ein Gedanke: Und wenn es nur Methode ist, ein Spiel? Sie können mich doch nicht einfach umbringen, ohne die erforderlichen Sanktionen! Außerdem brauchen sie mich noch, für das »Verfahren«.
»Naa-a?«, sagte der Assistent gedehnt.
»Halt! Nicht schießen!« Der Ermittler tat so, als wolle er seinen Kumpel zurückhalten.
Der Helfer stieß mit der Mündung des Revolvers gegen meine Schläfe und ging zur Seite. Der Ermittler lächelte genussvoll, tauchte seinen Federhalter in die Tinte und streckte ihn mir hin:
»Hier, unterschreib und geh schlafen. Essen lass ich dir kommen. Ruh dich aus. Hier … nimm!«
»Ich kann nicht«, presste ich mit Mühe heraus.
Ein heftiger Faustschlag ins Gesicht riss mich erneut von den Füßen. Ich wollte aufstehen, doch der Lederstiefel des Ermittlers drückte mich auf den Boden. Sie traten mich mit Füßen, bemüht, die empfindlichsten Stellen zu treffen. Ich krümmte mich, biss die Zähne zusammen und schützte mit den Armen meinen Kopf. Sie zerschlugen mir Nase und Mund, aus denen das salzige, klebrige Blut in Strömen floss … »Der Mensch – das klingt stolz.«
Leise erzittert der Fahrstuhl, der mich irgendwohin nach unten bringt.
Die Gegenüberstellung
Ich sitze auf meinem Eisenbett in der Einzelzelle; der Gefängnisarzt entfernt meinen Kopfverband. Beim letzten Verhör hat der Ermittler mir mit dem Revolvergriff den Kopf aufgeschlagen.
»Wie viele müssen Sie denn so am Tag verbinden?«, frage ich den Arzt.
Er schweigt beharrlich. Das macht mich wütend.
»Was hat das eigentlich für einen Sinn: verprügeln, dann kurieren, und nach zwei Tagen wieder verprügeln? Da können sie einen doch lieber gleich totschlagen …«
»Nicht reden«, sagt er leise, aber bestimmt.
Als der Verband ab ist, streut der Arzt ein Pulver auf die Wunde und teilt mir mit, ein Verband sei nicht mehr nötig. Ich protestiere, doch er nimmt die Binde und geht raus. Das Schloss klickt.
Ich falle auf die Eisenpritsche und schließe die Augen.
Ein ganzer Monat qualvoller, Körper und Seele zermürbender Verhöre liegt hinter mir. Zweimal verlor ich im Arbeitszimmer des Ermittlers das Bewusstsein, und man trug mich in die Zelle zurück. Auch in der Gummizelle war ich. So nennen sie den Karzer, in den sie ungehorsame Untersuchungshäftlinge eine Zeit lang einsperren. Wände und Fußboden dieser Zelle sind mit Gummi beschlagen. Kein Lichtstrahl, absolute Finsternis. Es ist stickig, kein Laut zu hören. Der Arrestant sitzt im Dunkeln und spürt um sich herum nur diesen klebrigen, wie blutverschmierten Gummi. Er kann noch so viel schreien, mit dem Kopf gegen die Wand schlagen – niemand reagiert. All das wirkt sich entsetzlich auf die Psyche aus; zwei Tage des Aufenthalts in dieser Zelle genügen, und der Häftling beginnt mit den Fäusten gegen die Gummitür zu schlagen und zu schreien, er sei bereit, jedes beliebige Protokoll zu unterschreiben, jede beliebige Selbstdiffamierung. Alles hier ist bedrückend und führt dazu, dass die Nerven bis zum Gehtnichtmehr angespannt sind: die Stille, die Dunkelheit, der ununterbrochene Kontakt mit dem klebrigen kalten Gummi des Fußbodens und der Wände; man hat das Gefühl, die gesamte Zelle sei voller Blut. Wenn man dann herauskommt, brennt das Licht unerträglich in den Augen, die nicht mehr daran gewöhnt sind, und man läuft, wenn man unter Aufsicht den Korridor entlanggeht, wie ein blindes Kätzchen gegen die Wände.
»Poch-poch. Poch-poch-poch-poch …«, klopfte es beharrlich aus der Nachbarzelle. Ich begann die Sprache der Gefängniswände schon ein wenig zu verstehen, konnte sie aber noch nicht nach dem Gehör aufnehmen und übermitteln. In den grauen Putz meiner Wand war das Klopfalphabet als Tabelle eingeritzt: je fünf Buchstaben horizontal und sechs vertikal. Das ist das Ljubjanker System. In der Butyrka ist es umgekehrt: sechs horizontal und fünf vertikal. Das Klopfen hatte mir mein Nachbar beigebracht, der in jeder verhörfreien Sekunde fünfmal entlang der Wand klopfte und, offenbar auf dem Bett stehend, sechsmal von der Decke bis zum Boden, bis ich begriff, wie es ging. Ich ritzte die Tabelle in meine Wand und begann Klopfzeichen mit ihm auszutauschen.
Ein Popka kam. Er befahl mir mitzukommen. Ich wunderte mich. Die Verhöre fanden sonst nachts statt, jetzt aber war Tag. Vielleicht sollte ich entlassen werden? Immer, selbst wenn die Lage noch so schlimm ist, blitzt bei einem Häftling im Stillen der Gedanke an die Freiheit auf, wenn er Schlüssel im Schloss vernimmt.
Aber nein. Schon war ich wieder im Untersuchungsraum. Der Ermittler saß am Schreibtisch und telefonierte:
»Sei mir nicht böse, Galotschka, ich schaffe es nicht zum Mittag … Wie? … Zum Abendessen? Zum Abendessen bin ich auf jeden Fall da. Versteh doch, hier ist eine Unmenge zu tun. Ja! Ruf Grigorjew an, es soll uns zum Sonntag zwei Karten fürs Bolschoi-Theater besorgen, für den ›Stillen Don‹, der hat Beziehungen, der besorgt sie. Bis dann, Galotschka!«
Der Ermittler legte den Hörer auf, lehnte sich im Sessel lässig zurück, sah mich an und hieß mich sitzen. Ich nahm Platz.
»Wie geht’s dem jungen Leben?«
»Geht so«, passte ich meinen Ton dem seinen an.
»Sehen Sie nur, draußen ist Frühling, Mai, Blumen, Mädchen. Sie aber sitzen und werden weiter sitzen, bis Sie gestehen.«
»Das ist unlogisch. Wenn ich irgendwas gestehe, sitze ich noch länger.«
»Unsinn! Das hier ist die Geheime Politische Abteilung des NKWD und nicht irgendeine Literaturkneipe. Hier geht alles nach Gesetz. Also, wie war Ihre Beziehung zu Dubow?«
»Gut.«
»Keine offenen persönlichen Rechnungen?«
»Nein.«
»So aufschreiben?«
»Können Sie.«
»Unterschreiben Sie!«
Ich unterschreibe.
»Jetzt nehmen wir eine Gegenüberstellung vor«, teilt mir der Ermittler lächelnd mit und drückt einen Knopf, der sich seitlich an seinem Schreibtisch befindet.
Aha, deshalb also wurde mir der Verband abgenommen.
Ich bin sehr aufgeregt, nehme meinen Herzschlag wahr. Gleich würde ich meinen Kommilitonen sehen, mit dem mich eine langjährige gute Freundschaft verbindet. Ich bin mir sicher, dass er nicht gegen mich aussagen wird, doch ein Treffen mit ihm unter solchen Umständen geht mir zu Herzen. Ungeduldig schaue ich auf die Tür.
In Begleitung eines Wachsoldaten betritt der bleiche Dubow den Raum; mit zitternden Händen knetet er seine Mütze und schaut den Ermittler erschrocken an, als würde er mich gar nicht sehen. Aufgrund des tadellos weißen Hemdkragens, der Krawatte und seines glattrasierten Gesichts begreife ich, dass er in Freiheit ist.
»Bürger Dubow«, sagte der Ermittler, »in Ihren Angaben haben Sie ihn (der Ermittler wies auf mich) letztens als Volksfeind beschrieben. Bestätigen Sie dies in seiner Anwesenheit.«
»Ja … ja«, stotterte Dubow verlegen.
»Was heißt hier ja, ja?«, unterbrach ihn der Ermittler wütend. »Berichten Sie ihm und mir ausführlich von seinen konterrevolutionären Aktivitäten!«
»Ja, ein Volksfeind«, fing Dubow an und verstummte. Sein tränenerfüllter Blick begegnete meinem, senkte sich schnell und erstarrte auf meiner nackten Schulter, die durch das zerrissene Hemd zu sehen war. Ich begriff, dass sich vor mir ein zuvor eingeübtes Theaterstück abspielte.
»In diesem Fall werde ich Sie daran erinnern«, sagte der Ermittler. »Hören Sie zu.«
Er begann eine umfangreiche Aufzählung meiner »Verbrechen« vorzulesen. Ein Großteil davon waren meine »Pläne, innerhalb der Moskauer Studentenschaft einen terroristischen Stoßtrupp gegen die Führer der kommunistischen Allunionspartei der Bolschewiki zu organisieren«. Diese Zeugenaussage endete ungefähr so: »In meiner Verantwortlichkeit eines ehrlichen sowjetischen Studenten erkläre ich, dass wir es mit einem ideologischen, heimtückischen und überzeugten Volksfeind zu tun haben.« Es folgte die Unterschrift.
Der Sprachstil, die stümperhaften Wendungen machten mir sofort klar, dass dies alles der Ermittler selbst formuliert hatte (Dubow war ein sehr gebildeter Mensch), und dass von Dubow nur die Unterschrift stammte. Ganz offensichtlich hatte man ihn vor ein Ultimatum gestellt: Entweder du unterschreibst oder du wirst selbst in der Ljubjanka sitzen. Dubow hatte natürlich Ersteres gewählt. Selbstverständlich musste er auch unterschreiben, das Ganze vertraulich zu behandeln.
Noch ein Detail: Auf den Seiten, die die Zeugenaussage meines Kameraden enthielten, befanden sich zwischen den Zeilen große Leerstellen. Diese Leerstellen würde der erfinderische Ermittler später mit selbst gebasteltem »Material« ausfüllen. Als Dubow das Dokument unterschrieb, konnte er das natürlich nicht wissen.
»Sehen Sie!«, sagte der Ermittler triumphierend. »Sogar Ihr bester Freund sagt Ihnen ins Gesicht, dass Sie ein Feind der Sowjetmacht sind. Sie aber wollen das nicht gestehen. Wie dumm von Ihnen! Dubow, unterschreiben Sie bitte Ihre Angaben. Und Sie, was sagen Sie zu Ihrer Rechtfertigung?«, wandte er sich wieder an mich.
Ich schwieg nachdenklich. Das hatten sie geschickt eingefädelt! Meine Rechtfertigung konnte ich nicht einmal mehr mit Rachegefühlen begründen: Ich hatte schließlich unterschrieben, dass ich mit Dubow keine Rechnung offen hätte. Und ich würde es auch nie fertigbringen, derart dreist zu lügen. Doch wie sonst konnte ich mich rechtfertigen?
»Ich werde vor Gericht die Wahrheit sagen. Sie haben ihm Angst eingejagt und ihn gezwungen, den ganzen Unsinn zu unterschreiben.«
Der Ermittler brach in Lachen aus und drückte den Klingelknopf.
»Ha! Und Sie denken, dass man Ihnen glauben wird? Sie sind ein sonderbarer Mensch …«
Ich sah Dubows gebeugter Gestalt nach, als dieser in Begleitung des Wachsoldaten den Raum verließ, und dachte an jenen fröhlichen, klugen, ehrlichen, wunderbaren Kameraden zurück, der er einmal gewesen war. Sollte ich ihn jetzt anklagen, weil er mein Leben zerstörte, um seines zu retten? Und würde es mir besser gehen, wenn zu den sieben oder acht Millionen politischen Gefangenen noch einer mehr hinzukäme? Tief in meinem Herzen rührte sich ein weiterer Gedanke, eine Hoffnung: Vielleicht würde er ja vor Gericht seine Aussagen zurücknehmen und den Richtern mutig erzählen, wie man ihn gezwungen hatte, diese schreckliche, üble Verleumdung zu unterschreiben.
Durch das Gitter des Fensters drang frühlingshafter, süßer Pappelduft in die Zelle.
Der Prozess
Gerichtssaal Nr. 4 des Moskauer Stadtgerichts.
Wir sitzen in der ersten Stuhlreihe. Direkt vor uns steht auf einem Podest ein großer Tisch, dahinter drei leere Armstühle; der mittlere ist höher und solider gebaut als die anderen, das ist der Richtersessel. Von der Wand blickt spöttisch, mit leicht zusammengekniffenen Augen Stalin auf uns herab.
Außer uns, den Angeklagten, befinden sich im Saal noch vier Wachsoldaten, die unbeweglich hinter uns stehen, sowie die Protokollantin, ein stupsnasiges, rotwangiges Mädchen, das links von uns an einem gesonderten Tischchen in irgendwelchen Papieren wühlt.
Aus dem Warteraum klingt Stimmengewirr. Dort sind unsere Angehörigen und auch einfach nur fremde Menschen, die alle auf unser Urteil warten. Die Fremden warten nicht aus purer Neugier, sondern um eine ungefähre Vorstellung davon zu bekommen, welches Schicksal ihre Brüder, Väter, Töchter erwartet, die noch in der Ljubjanka oder der Butyrka einsitzen und noch nicht an der Reihe sind, selbst vor dem »gerechtesten aller Gerichte, dem proletarischen Gericht« zu erscheinen.
Über uns richten wird bei geschlossenen Türen ein spezielles Kollegium, denn politische »Verbrecher« werden im Land der Sowjets unter Ausschluss der Öffentlichkeit verurteilt.
Das stupsnasige Mädchen erkundigte sich, ob wir mit der Anklageschrift bekanntgemacht worden seien. Als wir verneinten, reichte sie uns einen dicken Hefter: 352 Seiten!
Wir blätterten darin. Vernehmungsprotokolle, Protokolle der Zeugenaussagen, Fotos. Das war alles. Seltsam: es fehlten sämtliche an die Staatsanwälte gerichteten Beschwerden über die Misshandlungen der Ermittler, denen wir während der Verhöre ausgesetzt waren. Und wir hatten viele solcher Beschwerden eingereicht: an den Moskauer Staatsanwalt, an Generalstaatsanwalt Wyschinski, an den für die Kontrolle des NKWD zuständigen Staatsanwalt.
Auf unsere Frage, wo all diese Beschwerden geblieben seien, zuckte das Mädchen nur mit den Schultern und erwiderte nichts. Vielleicht würde das Gericht sich dazu äußern?
Ermüdendes, nervenaufreibendes Warten. Dann endlich öffnete sich rechts von uns eine Tür, und drei Männer kamen schnellen Schritts herein, zwei von ihnen in Zivil, einer in einer khakifarbenen Militärbluse und in Reithosen. Das waren die Richter: Iwanow, Pronin, Sedych. Den Vorsitz hatte Iwanow, der in der Militärbluse.
Zügig, wie Leute, die viel zu tun haben, nahmen sie ihre Plätze ein, und nach der offiziellen Gerichtseröffnung und dem Verlesen der Anklageschrift fragte uns der Vorsitzende Iwanow der Reihe nach, ob wir uns schuldig bekannten. Nachdem er von jedem von uns ein Nein vernommen hatte, lächelte er ironisch und wechselte Blicke mit den Beisitzern.
Er dachte einen Augenblick lang nach und fragte dann:
»Warum haben einige von Ihnen sich während der Untersuchung schuldig bekannt, leugnen jetzt aber ihr Verbrechen. Zum Beispiel Sie, Angeklagter Sharow …«
Mein Kamerad, der Student Sharow, erhob sich, und erkundigte sich, nachdem er um Erlaubnis gebeten hatte, wo denn die an die Staatsanwälte gerichteten Beschwerden abgeblieben seien.
»Haben Sie denn welche geschrieben?«, fragte Pronin schnell.
»Ja.«
»Wenn Sie welche geschrieben hätten, wären sie auch da«, entgegnete Iwanow und fügte hinzu: »Worum ging es denn darin?«
»Um unkorrekte Führung der Untersuchungen, man hat uns gequält, verhöhnt und gewaltsam gezwungen, die Protokolle zu unterschreiben.«
»Hat man Sie vielleicht auch geschlagen?«, fragte Iwanow mit spöttischem Lächeln.
»Nicht nur das! Man hat uns tage- und nächtelang gezwungen, auf der Stelle zu stehen, man ließ uns nicht schlafen, steckte uns die Mündung eines Brownings in den Mund, ließ uns im Karzer hungern, und …«
»Offenbar streben Sie an, dass ich Sie wegen Verleumdung des NKWD zur Verantwortung ziehe?«
Alles klar. Der NKWD und des Sonderkollegium des Moskauer Stadtgerichts waren vom selben üblen Schlag.
Anderthalb Stunden lang versuchten die Richter uns im Kreuzverhör die »konterrevolutionäre terroristische Organisation der Studentenschaft Moskaus« nachzuweisen, und als sie begriffen, dass sie mit »Terror« und »Organisation« nicht weiterkamen, warfen sie uns alle möglichen Nichtigkeiten vor: antisowjetische Witze, zweideutige Aussagen, die wir irgendwo getätigt hatten und die irgendjemand mitgehört hatte.
»Den Zeugen Dubow bitte«, befahl Iwanow dem Wachpersonal.
Die Zeugen waren unsere letzte Hoffnung. Sie alle waren Kommilitonen, einige von ihnen waren alte Freunde aus der Kinderzeit. Würden sie dem Gericht tatsächlich nicht erklären, dass alle Angaben den Köpfen der Untersuchungsrichter entsprungen waren, und dass von ihnen selbst nur die Unterschriften stammten? Würden sie tatsächlich nicht den Mut zur Wahrheit aufbieten?
Dubow kam herein und stellte sich schüchtern, möglichst weit von uns entfernt, vor den Richtertisch.
»Zeuge Dubow, ich erinnere Sie an Ihre Angaben, die Sie bei der Voruntersuchung gemacht haben.«
Iwanow suchte die entsprechenden Seiten heraus und las den in schlechtem Russisch abgefassten, von Dubow unterschriebenen Unsinn vor. Die meisten Anschuldigungen waren gegen mich und den Ingenieur Pawlow gerichtet, aus dem der Ermittler einen »Oberst der weißen Armee und den unmittelbaren Anführer der studentischen terroristischen Organisation« konstruiert hatte.
Nachdem die Verlesung beendet war, wandte er sich wieder an Dubow:
»Bei der persönlichen Gegenüberstellung haben Sie Ihre Angaben bestätigt. Was sagen Sie der Justiz?«
»Ich … bestätige alles.«
»Haben Sie etwas hinzuzufügen?«
»Nein.«
»Fragen an den Zeugen?«
Nein. Wir hatten keine Fragen.
Alle Zeugen traten so auf wie Dubow.
Uns wird das letzte Wort gewährt.
Was sollen wir sagen? Um Nachsicht bitten? Nein. Nein!
Wir verzichten auf das letzte Wort.
Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Wir warten auf das Urteil.
Die Türen öffnen sich weit, und alle, die es wünschen, dürfen der Urteilsverkündung beiwohnen. Ach, hätte man sie doch früher hereingelassen!
Der Saal füllt sich bis zum Bersten. Ich sehe die bleichen Gesichter meiner Familie: Sie geben mir Zeichen, aber ich kann sie nicht verstehen. Ich habe einen Kloß im Hals, wende mich ab und blicke auf Stalin. Er lächelt noch immer spöttisch.
Sie werden uns verurteilen, das ist gewiss. Die Frage ist, zu wie vielen Jahren.
Es herrscht eine Stille wie auf dem Friedhof. So wie man vor einem Toten nur flüstert, so auch im Gerichtssaal vor der Verurteilung.
Die Richter betreten den Saal. Alle erheben sich.
»Im Namen der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik … Sonderkollegium … nach Prüfung der Anklage … geschlossener Gerichtsverhandlung … Anklage … Artikel … Punkt … aufgrund … … verurteilt zu … zwei Jahren Haft … vier Jahren Haft … fünf …«
Ein schlechtes Zeichen. Sie nennen zuerst die geringen Strafen, also die kurzen Haftstrafen, das heißt, am Ende kommt »Erschießen«. Von dieser Regel wissen wir seit den ersten Tagen unserer Haft.
»… Tod durch Erschießen.«
Eine Sekunde lang herrscht nach der Urteilsverlesung Stille im Saal, dann – Lärm, Schreie, Weinen … Ich wende mich um und blicke auf meine Mutter. Sie steht an die Wand gelehnt und hat die Augen geschlossen. Vater hält ihre Hände und sagt etwas. Seine Lippen sind aschgrau.
Das Wachpersonal stößt die Menge auseinander und führt uns ab nach unten, in die Zelle.
Ich suche mir zwischen den vielen Inschriften an der Wand eine möglichst saubere Stelle und ritze mit einem Nagel meinen Namen ein, daneben: »Fünf Jahre.« Dann übergebe ich den Nagel meinen Kameraden. Der Ingenieur Pawlow schreibt neben seinen Namen ruhig und schwungvoll: »Erschießung.«
Man trennt ihn von uns und führt ihn in die Todeszelle.
***
Das gelbe Licht der Petroleumlampe flackert leicht, seltsame Schatten kriechen über das Zeltdach. Ich liege mit offenen Augen da: zerschlagen, krank, innerlich leer, zwischen sterbenden Menschen, fern von meiner Familie, und denke an mein Leben zurück – daran, was für ein vergeudetes Leben es gewesen ist.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.