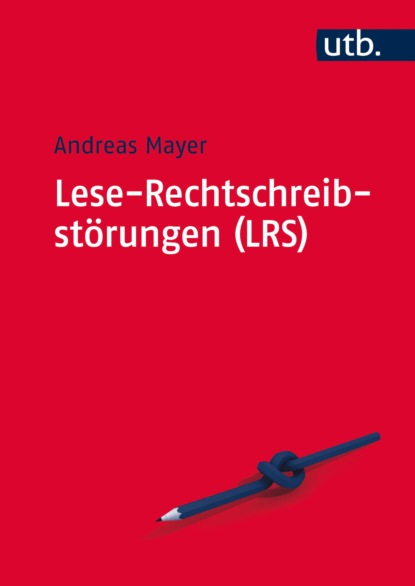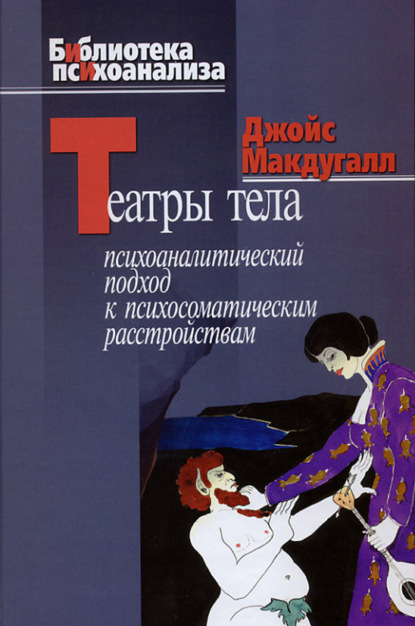- -
- 100%
- +
phonologisches System
Das phonologische System wird in zwei Bereiche mit unterschiedlichen Funktionen unterteilt. Der eine Bereich liegt posterior (hinten) temporo-parietal in der sogenannten perisylvischen Region, welche den Gyrus supramarginalis, Gyrus angularis und den superioren temporalen Kortex umfasst (Abb. 8). Dieser Teil des phonologischen Systems ist verantwortlich für die Überführung orthographischer in sprachliche Informationen und damit zentral für die phonologische Verarbeitung und die Graphem-Phonem Zuordnung. Der andere Bereich liegt anterior (vorne) im frontalen Kortex und beinhaltet den Gyrus frontalis inferior. In diesem Teil des Systems wird die Artikulation und aktive Analyse phonologischer Elemente gesteuert (Pugh et al. 2001). Beide Bereiche des phonologischen Systems stehen im wechselseitigen Austausch und bilden ein funktionelles Netzwerk (Horwitz et al. 1998; Quaglino et al. 2008).
Strategiewechsel
In der kindlichen Leseentwicklung vollzieht sich mit der Zeit ein Wechsel vom phonologischen Lesen hin zum direkten Abruf von bekannten Wörtern. Neurobiologisch gesehen bedeutet dies, dass Kinder als Leseanfänger zunächst auf das phonologische System im temporo-parietalen Kortex angewiesen sind, da ihr Leseprozess hauptsächlich von phonologischen Rekodierungs-Strategien geprägt ist. Mit zunehmender Leseerfahrung bilden und verfestigen sich die orthographischen Verarbeitungsmechanismen des okzipito-temporalen Systems, und bei vertrauten Wörtern kann ein direkter lexikalischer und semantischer Zugriff vollzogen werden (Pugh et al. 2001). Unterstützt werden die Annahmen zur Funktionsweise des Systems durch Studien, die zeigen konnten, dass Kinder beim Lesen von Einzelwörtern im Vergleich zu Erwachsenen signifikant höhere Aktivierung in temporo-parietalen Bereichen aufweisen. Die okzipito-temporalen Regionen hingegen werden bei Kindern sowohl während des Lesevorgangs als auch bei der Wiedergabe bzw. dem Nachsprechen von auditiv präsentierten Wörtern aktiviert. Bei Erwachsenen zeigt sich eine Aktivität allerdings nur während des eigentlichen Leseprozesses. In der Forschung wird daher davon ausgegangen, dass im Verlauf der Leseentwicklung phonologische Verarbeitungsprozesse abnehmen und visuelle Ergebnisse von Post-mortem-Untersuchungen Verarbeitungsmechanismen mit steigender Expertise deutlich zunehmen (Church et al. 2008).
Viele Erkenntnisse zu den neurobiologischen Grundlagen der Lese-Rechtschreibstörung stammen aus sogenannten Post-mortem-Untersuchungen, bei denen die Gehirne betroffener Personen analysiert wurden (Galaburda / Livingstone 1993; Galaburda / Kemper 1979; Galaburda et al. 1994; Galaburda et al. 1985). Interessanterweise wurden dabei neuronale Verlagerungen (Ektopien) und fokale kortikale Fehlbildungen (Dysplasien) entdeckt, die als Resultat einer beeinträchtigten Nervenzellwanderung in der embryonalen Entwicklungsphase angesehen wurden. Strukturelle Auffälligkeiten wurden vor allem in der perisylvischen Region der linken Hirnhälfte gefunden. Bei einem Vergleich zwischen Gehirnen von Menschen ohne Leseprobleme und Personen, die zu Lebzeiten unter einer Lese-Rechtschreibstörung litten, wurde zudem eine abnorme Symmetrie des planum temporale festgestellt (Galaburda / Kemper 1979; Galaburda et al. 1985).

Planum temporale: Oberfläche des Schläfenlappens (Temporallappen), in dem auch das Wernicke-Areal angesiedelt ist. Dieses Areal ist bei etwa zwei Drittel der Bevölkerung linkshemisphärisch größer als rechtshemisphärisch, was als linkshemisphärische Organisation der Sprache interpretiert wird.
Darüber hinaus fanden sich Abweichungen des an der visuellen Verarbeitung beteiligten Corpus geniculatum laterale und im Corpus geniculatum mediale, der einen Teil des auditorischen Systems bildet (Galaburda / Livingstone 1993; Galaburda et al. 1994).

Der Corpus geniculatum laterale (seitlicher Kniehöcker) ist ein Teilgebiet der Sehbahn, gelegen im Thalamus, das die von der Retina über den nervus opticus eingehenden visuellen Informationen an den visuellen Cortex weiterleitet. Es ist v. a. für das Wahrnehmen von Details und schneller Bildabfolgen und für die Regulierung des Informationsflusses verantwortlich.
Der Corpus geniculatum mediale (mittlerer Kniehöcker) übernimmt die Funktionen des seitlichen Kniehöckers für auditive Informationen.
geringe Dichte an grauer Masse
Mittlerweile wurden in strukturellen Bildgebungsstudien verschiedene Kortexareale identifiziert, in denen Kinder und Erwachsene mit Lese-Rechtschreibstörung im Vergleich zu normallesenden Personen ein geringeres Volumen oder eine geringere Dichte an grauer Masse aufwiesen.
Um solche Vergleiche durchführen zu können, wird ein Verfahren namens voxelbasierte Morphometrie (VBM) verwendet.

Mithilfe der voxelbasierte Morphometrie VBM können Hirnstrukturen aus der tomographischen Bildgebung hinsichtlich Größe, Intensität, Form- und Texturparameter quantitativ beschrieben werden. Die ermittelten Maßzahlen werden gemeinsam mit anderen experimentellen Parametern statistisch analysiert.
Dadurch können Hirnstrukturen aus der tomographischen Bildgebung hinsichtlich Größe, Intensität, Form- und Texturparameter quantitativ beschrieben werden. Die ermittelten Maßzahlen werden gemeinsam mit anderen experimentellen Parametern statistisch analysiert. Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung weisen demnach häufig Abweichungen in posterior temporalen bzw. temporo-parietalen Regionen der linken Hemisphäre (Brambati et al. 2004; Hoeft et al. 2007; Silani et al. 2005; Steinbrink et al. 2008), in bilateralen okzipito-temporalen Regionen (Brambati et al. 2004; Eckert et al. 2005; Kronbichler et al. 2008) und dem Cerebellum auf (Brambati et al. 2004; Brown et al. 2001; Eckert et al. 2005; Kronbichler et al. 2008).
gestörte Konnektivität in neuronalen Systemen
Etwa seit dem Jahr 2000 wurde vermehrt von Befunden aus Diffusions-Tensor-Bildgebungsstudien (Diffusion Tensor Imaging, DTI) berichtet. Durch dieses Verfahren können mithilfe der Magnetresonanztomografie (MRT) die Diffusionsbewegungen von Wassermolekülen im Körpergewebe gemessen und räumlich aufgelöst dargestellt werden. Das Diffusionsverhalten bzw. die Richtungsabhängigkeit der Diffusion erlaubt Rückschlüsse auf den Verlauf der großen Nervenfaserbündel. Forschungsergebnisse ermittelten eine weniger stark ausgeprägte Konnektivität (Verbindung) der weißen Masse in linken temporo-parietalen Regionen beim Vergleich normaler und schwacher Leser (Beaulieu et al. 2005; Deutsch et al. 2005; Klingberg et al. 2000; Steinbrink et al. 2008), während im Corpus Callosum eine stärkere Konnektivität der weißen Masse bei Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung im Vergleich zu normallesenden Personen gefunden wurde (Dougherty et al. 2007). Ausgehend von diesen Ergebnissen wird bei Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung eine Störung der Konnektivität zwischen den neuronalen Lesesystemen innerhalb der linken Hemisphäre vermutet. Die gleichzeitig beobachtete stärkere Konnektivität zwischen anatomisch korrespondierenden Kortexarealen der linken und rechten Hemisphäre hingegen sprechen für eine stärkere Nutzung der rechtshemisphärischen Systeme. Möglicherweise kann dies als Hinweis für einen kompensatorischen Mechanismus gewertet werden, der bei leserelevanten Prozessen zum Tragen kommt (Gabrieli 2009).
Weitere Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren konnten bedeutende Aktivierungsunterschiede zwischen Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung und normallesenden Personen während der Bearbeitung von Lesematerial oder Aufgaben mit Lesebezug zeigen (McCandliss / Noble 2003; Shaywitz / Shaywitz 2005). Wiederholt konnten dabei sowohl für Erwachsene als auch für Kinder linkshemisphärische Unteraktivierungen im posterior parietalen Kortex (Brunswick et al. 1999; Rumsey et al. 1997; Shaywitz et al. 2002; Temple et al. 2001), im inferior okzipito-temporalen Kortex (Brunswick et al. 1999; McCrory et al. 2005; Paulesu et al. 2001; Shaywitz et al. 2002) und im Gyrus temporalis superior (Paulesu et al. 1996, 2001; Rumsey et al. 1997) ermittelt werden.
Interessanterweise finden sich solche Befunde in den verschiedensten Sprachen, obwohl zum Teil große Unterschiede bezüglich der Transparenz der jeweiligen Orthographie bestehen. So traten im Vergleich zu normallesenden Menschen geringere Aktivierungen in gleicher Form bei Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung aus Frankreich, Italien und Großbritannien auf (Paulesu et al. 2001). Darüber hinaus zeigen Jugendliche mit einer Lese-Rechtschreibstörung die beschriebenen Unteraktivierungen nicht nur im Vergleich mit einer Gruppe Gleichaltriger, sondern auch verglichen mit einer Gruppe jüngerer Normallesender, die bezüglich des Leseniveaus analog waren. Daher scheinen die ermittelten funktionellen Defizite einer Lese-Rechtschreibstörung unabhängig von der Leseleistung zu sein (Hoeft et al. 2007). Die Beeinträchtigung der beiden posterioren Systeme des oben beschriebenen Lesenetzwerks kann somit als sprachübergreifende neuronale Signatur für eine Lese-Rechtschreibstörung angesehen werden (Shaywitz / Shaywitz 2005).
In Bezug auf die gefundenen Aktivierungsmuster des anterioren Lesesystems gibt es widersprüchliche Ergebnisse. Zum Teil werden bei Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung höhere Aktivierungen im linken inferioren frontalen Kortex im Vergleich zu normallesenden Personen gefunden (Brunswick et al. 1999; Grünling et al. 2004; Shaywitz et al. 1998). Andere Studien allerdings finden solche Überaktivierungen nicht (Eden et al. 1996; Rumsey et al. 1994). Überraschenderweise wird in einigen Untersuchungen sogar von Unteraktivierungen berichtet, die beim Lesen beobachtet werden konnten (Georgiewa et al. 1999; Paulesu et al. 1996; Rumsey et al. 1997; Shaywitz et al. 2002).
Ergebnisse von Metaanalysen
Um übergreifende Aussagen treffen zu können, werden in der Wissenschaft häufig sogenannte Metaanalysen durchgeführt, die verschiedene Einzelstudien zusammenfassen und deren Aussagekraft mit speziellen statistischen Methoden bündeln. Bezüglich der Ergebnisse der verschiedenen Bildgebungsstudien zu Aktivierungsunterschieden zwischen Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung und solchen ohne Störung wurden in den 2000er Jahren zwei bedeutende Metaanalysen durchgeführt. Die erste Studie veranlasste eine Analyse von neun Studien, die mit gesunden, postpubertären Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung aus Ländern mit alphabetischen Schreibsystemen durchgeführt wurden, die mit dem Lesen von visuell präsentierten Wörtern, Pseudowörtern oder Buchstaben konfrontiert wurden (Maisog et al. 2008). Als zentrales Ergebnis konnte eine größere Wahrscheinlichkeit für eine Unteraktivierung bei Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung für posterior ventrale, inferior parieto-temporale und inferior frontale Bereiche der linken und für den Gyrus fusiformis, Gyrus postcentralis und Gyrus temporalis superior der rechten Hemisphäre dokumentiert werden. Die stärksten Aktivierungswahrscheinlichkeiten und die größten Übereinstimmungen zwischen den einbezogenen Studien wurden für den extrastriaten Kortex der linken Hemisphäre gefunden. Höhere Wahrscheinlichkeiten für Überaktivierungen bei Menschen mit Dyslexie wurden für den rechtshemisphärischen Thalamus und, weniger übereinstimmend zwischen den Studien, für den anterioren Bereich der rechtshemisphärischen Insula berichtet. Allerdings konnten keine Anzeichen für eine Überaktivierung des linken frontalen Kortex oder für Aktivierungsunterschiede des Cerebellums gefunden werden. In der zweiten Metaanalyse wurden siebzehn Studien berücksichtigt, in denen Aufgaben mit Wörtern, Zeichenfolgen oder einzelnen Buchstaben von Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung bearbeitet werden mussten (Richlan et al. 2009). Hier wurde die höchste Wahrscheinlichkeit für Unteraktivierungen für inferior parietale, inferior, mittlere und superior temporale und fusiforme Regionen der linken Hemisphäre ermittelt. Unteraktivierungen hingegen fanden sich im Gyrus frontalis inferior bei gleichzeitigen Überaktivierungen im primären Motorkortex und der anterioren Insula. Es wurden keine Aktivitätsunterschiede zwischen Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung und Normallesenden in der rechten Hemisphäre oder im Cerebellum gefunden (Abb. 8).
auditive Aufgaben
Neben Studien, die sich mit der Bearbeitung von Lesematerial beschäftigen, gibt es auch einige Bildgebungsstudien, in denen Aktivierungsunterschiede zwischen Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung und normallesenden Personen bei der Bearbeitung basaler auditiver Aufgaben gefunden wurden. So wurden in einer Studie beispielsweise 16 Sequenzen von drei bzw. vier Tönen pro Minute präsentiert, und es musste entschieden werden, ob die Töne innerhalb einer Sequenz identisch waren oder nicht (Rumsey et al. 1994). Neben höheren Fehlerraten zeigten Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung eine geringere Aktivierung in rechtshemisphärischen fronto-parietalen Regionen. In weiteren Studien mit Erwachsenen (Temple et al. 2000) und Kindern mit einer Lese-Rechtschreibstörung (Gaab et al. 2007) wurden nicht sprachliche auditive Stimuli dargeboten, und es musste zwischen Stimuli hoher und niedriger Frequenz unterschieden werden. Personen ohne Lesebeeinträchtigung zeigten bei Stimuli mit kurzen im Vergleich zu Stimuli mit langen Frequenzübergängen erhöhte Aktivität im präfrontalen Kortex. Bei den Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung konnten hingegen keine Aktivierungsunterschiede in diesem Areal beobachtet werden. Interessanterweise konnten durch ein Training zur Verbesserung schneller auditiver Verarbeitung sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern mit einer Lese-Rechtschreibstörung höhere Aktivierungen in präfrontalen Arealen bei der Verarbeitung von Stimuli mit kurzen Frequenzübergängen erzielt werden.
visuelle Aufgaben
Neben Studien zur phonologisch-sprachlichen Verarbeitung wurden Studien zur basalen visuellen Verarbeitung mit bildgebenden Verfahren durchgeführt. Es konnten Aktivierungsunterschiede zwischen Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung und unbeeinträchtigten Lesern ermittelt werden. In einer Studie wurde beispielsweise entweder ein sich gleichmäßig bewegender Stimulus mit niedrigem Kontrast (durch den vor allem das magnozelluläre System des visuellen Kortex stimuliert werden sollte), oder ein fixer Stimulus mit hohem Kontrast (der vor allem das parvozelluläre System ansprechen sollte), präsentiert. Personen ohne Leseschwierigkeiten zeigten bei der Präsentation des sich bewegenden Stimulus eine Aktivierung des Areals V5 / MT im visuellen Kortex, während bei Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung keine Aktivierungen auszumachen waren. Hinsichtlich des fixen Stimulus wurden keine Aktivierungsunterschiede zwischen den beiden Gruppen gefunden. In zwei weiteren Studien wurden erwachsenen Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung und solchen ohne Lesebeeinträchtigung sich bewegende Gittermuster mit geringer und hoher Leuchtdichte präsentiert (Demb et al. 1998). Die Personen ohne Leseprobleme wiesen höhere Aktivierungen im primären visuellen Kortex und in extrastriaten Regionen bei der Darbietung der bewegten Stimuli mit geringer Leuchtdichte auf. Darüber hinaus zeigte eine Untersuchung mit Kindern unterschiedlicher Lesefähigkeit, denen sich bewegende Gittermuster in unterschiedlichen Kontrastauflösungen dargeboten wurden, Aktivierungen der Areale V1 und MT+ (Ben-Shachar et al. 2007). Ein stärkeres Ansprechen auf Kontraständerungen im Areal MT+, aber nicht in V1, zwei Bereiche des visuellen Kortex, stand zudem im Zusammenhang mit besseren Leistungen in verschiedenen Lesetests und der phonologischen Bewusstheit. Die Aktivierungsunterschiede werden daher als ein basaler neuronaler Marker für Leseleistung angesehen.
4.2.3 Übersicht und Ausblick
Die Übersicht über die verschiedenen Erklärungsansätze zu den neurobiologischen Grundlagen macht deutlich, dass die Lese-Rechtschreibstörung als multidimensionales Problem angesehen werden kann. Auf kognitiver Ebene tritt vor allem das phonologische Verarbeitungsdefizit in den Vordergrund, welches zudem teilweise auch gemeinsam mit sensorischen und / oder motorischen Defiziten vorkommen kann. Obwohl verschiedene sehr überzeugende Theorien zur Entstehung der Störung formuliert wurden, ist es bisher keiner Hypothese gelungen, alle Phänomene, die bei einer Lese-Rechtschreibstörung beobachtet wurden, befriedigend zu erklären. Möglicherweise kann dies als ein Indikator dafür gewertet werden, dass verschiedene Untertypen der Lese-Rechtschreibstörung existieren.
strukturelle und funktionelle Abnormitäten
Als neuronale Korrelate der Dyslexie werden relativ übereinstimmend strukturelle und funktionelle Abnormitäten der posterioren Lesesysteme in temporo-parietalen und okzipito-temporalen Arealen der linken Hemisphäre beschrieben. Dabei wird davon ausgegangen, dass Beeinträchtigungen im temporo-parietalen System sich wiederum auf die Entwicklung des okzipito-temporalen Systems auswirken können (McCandliss / Noble 2003). Demnach würden diese funktionellen Beeinträchtigungen die phonologische Informationsverarbeitung und damit die Rekodierfähigkeiten massiv beeinträchtigen. Infolgedessen können Graphem-Phonem-Zuordnungen weniger effektiv und stabil aufgebaut werden. Solche gespeicherten Informationen sind allerdings notwendig für eine graduelle Spezialisierung des okzipito-temporalen Systems zur schnellen und automatisierten Worterkennung.
Bislang konnte noch nicht eindeutig geklärt werden, ob Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung das inferior frontale System des Lesenetzwerks und rechtshemisphärische Systeme tatsächlich als kompensatorische Mechanismen einsetzen. Auch die Rolle des Cerebellums für die Entstehung der Störung ist weiterhin ungeklärt. Obwohl strukturelle Befunde eine geringere Dichte und / oder ein geringeres Volumen der grauen Masse erkennen lassen, wurden in funktionellen Studien keine Aktivierungsunterschiede zwischen Lesern mit einer Lese-Rechtschreibstörung und unbeeinträchtigten Personen gefunden. Die beobachteten funktionellen und strukturellen Abweichungen von Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung werden möglicherweise von bestimmten Genkonstellationen hervorgerufen (Fisher / Francks 2006).
neurobiologischer Erklärungsversuch
Ein neurobiologisches Modell zur Entstehung der Lese-Rechtschreibstörung versucht, die Ergebnisse aus anatomischen und funktionellen Studien mit denen aus Gen- und Tierstudien zusammenzuführen (Ramus 2004). Darin wird beschrieben, dass genetische Abweichungen, vermittelt über eine Beeinträchtigung der Nervenzellwanderung, zu einer abnormalen Entwicklung derjenigen Kortexregionen führen können, die an der phonologischen Verarbeitung beteiligt sind. Zudem wird vermutet, dass sich diese Abweichungen unter spezifischen hormonellen Bedingungen im weiteren Verlauf auf die Entwicklung des Cerebellums auswirken könnten (Stein et al. 2001). Durch das vorgeschlagene Modell kann somit das gemeinsame Auftreten phonologischer, sensorischer und motorischer Defizite bei Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung potenziell erklärt werden.
abgeleitete Therapiemaßnahmen
In den 2000er Jahren haben Therapieansätze, die auf neurobiologischen Erklärungsmodellen beruhen, erste erfolgversprechende Ergebnisse gezeigt. Beachtenswert ist allerdings, dass nicht alle Personen mit einer Lese-Rechtschreibstörung von diesen Interventionen profitieren konnten. So wurde in einer multiplen Einzelfallstudie gezeigt, dass von den untersuchten 16 Erwachsenen mit einer Lese-Rechtschreibstörung zwar alle ein phonologisches Verarbeitungsdefizit aufwiesen, allerdings nur zehn an weiteren auditiven Verarbeitungsproblemen litten, vier zudem motorische Defizite und zwei Schwierigkeiten bei visuellen Aufgaben hatten (Ramus et al. 2003). Diese Beobachtung macht deutlich, dass die phonologischen Probleme von Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung auf unterschiedlichen Ursachen beruhen können. Daher können Personen möglicherweise nur von einer Intervention profitieren, wenn diese auf der Basis des jeweils zugrundeliegenden neurobiologischen Defizits entwickelt wurde. Eine Person mit einer sensorischen Beeinträchtigung kann nicht von einem Training motorischer Funktionen profitieren und umgekehrt. Wie bereits erwähnt, wird daher eine Unterteilung der Lese-Rechtschreibstörung in unterschiedliche Untergruppen diskutiert (Beaton 2004). Erste Studien deuten sogar daraufhin, dass solche Untergruppen auch mit elektrophysiologischen Methoden identifiziert werden können (Lachmann et al. 2005).
Notwendigkeit weiterer Forschung
Weitere Forschung auf kognitiver und neurobiologischer Ebene ist unbedingt notwendig, um die bisherigen Befunde weiter empirisch zu unterstützen. Nur so kann mit der Zeit ein tieferes Verständnis der Störung und ihrer kognitiven und neuronalen Bedingungsfaktoren erlangt werden. Auch eine genauere Ausdifferenzierung kognitiver Untertypen der Lese-Rechtschreibstörung, möglicher Komorbiditäten und die Suche nach diesen zugrunde liegenden Dysfunktionen in neuronalen Netzwerken sollten im Fokus zukünftiger Forschung stehen. Neue Erkenntnisse und Fortschritte sind unumgänglich für die Verbesserung individueller Diagnoseinstrumente und für die Entwicklung an das individuelle kognitive Profil angepasster Präventions- und Interventionsansätze.
Zusammenfassung
Das Kapitel widmet sich genetischen, kognitiven und neuronalen Grundlagen der Lese-Rechtschreibstörung. Basierend auf einer Darstellung der wichtigsten kognitiven und neurobiologischen Theorien der Entstehung von Lese-Rechtschreibstörung werden Ergebnisse zu spezifischen Störungen des neuronalen Lesenetzwerks bei Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung aus Postmortem-Untersuchungen und strukturellen sowie funktionellen Bildgebungsstudien beschrieben. Die Befunde lassen erkennen, dass die Lese-Rechtschreibstörung ein multidimensionales Problem darstellt, das mit verschiedenen kognitiven, sensorischen und motorischen Defiziten und spezifischen Störungen auf neuronaler Ebene einhergeht. In Zukunft sollte sich Forschung daher verstärkt individuellen Profilen bzw. Subtypen der Störung auf kognitiver wie neuronaler Ebene widmen.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.