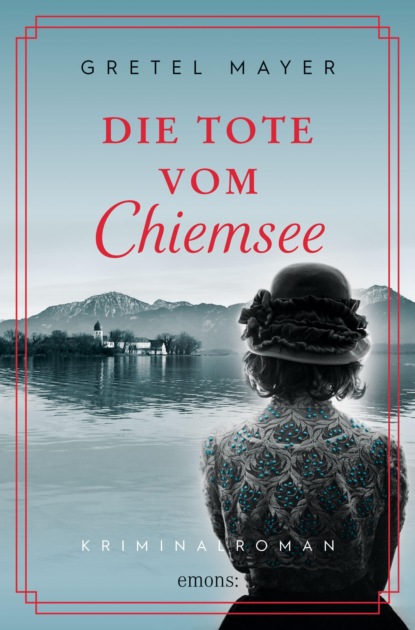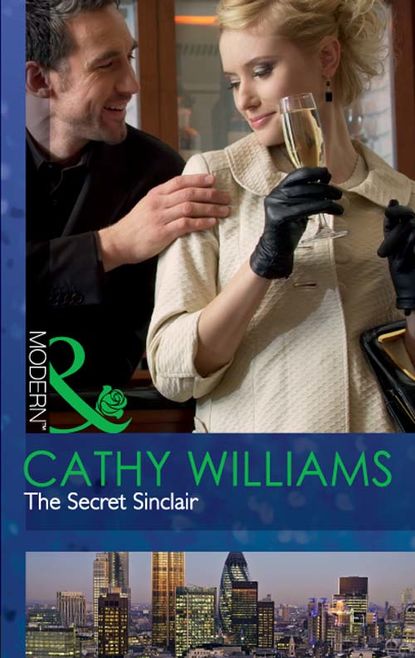- -
- 100%
- +
»Sie suchte Ruhe und Frieden bei uns, und das fand sie auch. Wie weit sie allerdings mit ihrer Entscheidung gekommen war, kann ich Ihnen nicht sagen. Sie verstand sich gut mit unseren beiden Novizinnen; von weiteren Freundschaften, gar von einer Liebelei, ist mir nichts bekannt. Ich bitte Sie nun, mich in meiner Trauer und vor allem im Gebet für meine liebe Flora wieder allein zu lassen.«
Das waren die abschließenden Worte der Äbtissin. Fanderl schloss sein schwarzes Büchlein, in das er nicht sehr viel hatte eintragen können, und verabschiedete sich höflichst.
Wieder zurück im Refektorium fand er die Situation fast unverändert vor. Trauer, Tränen, Verzweiflung und Gebet erfüllten den Raum, ein leichter Geruch nach Gemüsesuppe, die wohl Schwester Kreszentia gerade in der Küche zubereitete, mischte sich darunter. Die beiden Novizinnen Hilda und Sophie saßen noch immer in einer Ecke beieinander, und erst als Fanderl auf sie zutrat, setzten sie sich etwas aufrechter hin und trockneten, so gut es ging, ihre Tränen.
Hilda Rossgoderer, wie sich die kräftigere und größere der beiden vorstellte, wischte sich noch einmal über das rotwangige, runde Bauerngesicht und erzählte, dass sie seit fast zwei Jahren im Kloster sei, dass sie von einem Bauernhof in Brannenburg stamme und sehr gerne draußen arbeite. Auch die Flora, so berichtete sie mit wieder zitternder Stimme, habe, obwohl sie ja ein Stadtmensch war, gerne im Klostergarten gearbeitet. Sie selbst habe ihr alles gezeigt.
»Sie war immer so fröhlich und guter Dinge«, sagte Hilda, und schon wieder füllten sich ihre Augen mit Tränen. »Ich kann’s einfach nicht glauben, dass sie nimmer da is!«
Sophie von Arnstetten, die zweite Novizin, war das gerade Gegenteil der bäuerlichen Hilda. Sie war dünn und blass, ihre dunklen, ein wenig stechenden Augen schienen zu groß für ihr schmales Gesicht.
»Der Herr hat sie von uns genommen. Auch wenn es uns schmerzt und wir es nicht verstehen, es war Sein Wille, und diesen müssen wir annehmen. Sie ist nun beim Herrn«, erklärte sie, und Fanderl, entsetzt über diese ihm auf heuchlerische Weise fromm erscheinenden Worte, musste an den Weihbischof Müller denken, der ihn gefirmt hatte und der immer in solch einem salbungsvollen Tonfall dahergeredet hatte. Dieser Weihbischof hatte sein Gutteil dazu beigetragen, dass Fanderl nur an Ostern und Weihnachten und zu ganz besonderen Anlässen in die Kirche ging. Ansonsten hielt er nicht viel von ihr.
»Ich habe schon meinen lieben Gott, doch der wohnt nicht unbedingt in einer Kirch und braucht auch keinen Pfarrer«, sagte er immer zur Therese, wenn diese sich um sein Seelenheil sorgte.
Wie sich herausstellte, hielt Sophie von Arnstetten, die aus Coburg stammte, nicht viel von der Arbeit in der freien Natur. Sie beschäftigte sich lieber mit dem Leben der Heiligen, über das sie schon viele Bücher gelesen hatte, sie handarbeitete gerne und hatte eine sehr schöne Singstimme. Schon mehrfach hatte sie bei der Morgenandacht eine Kostprobe davon geben dürfen. Mit Flora habe sie sich gut verstanden, sie habe sich auch gerne mit ihr über das Theater und über München unterhalten.
Beide Novizinnen bestätigten, dass sie Flora zum letzten Mal bei der Abendmahlzeit gesehen hätten. Sie habe gewirkt wie immer. Von einer Freundschaft drüben im Dorf wüssten sie beide nichts, versicherten sie sehr rasch, doch gerade dieser Eifer ließ bei Fanderl leise Zweifel aufkommen.
Nach dem Verlassen des Klosters gab Fanderl sich einen Ruck.
»Du kommst eh nicht rum um die Leichenschau, Gustav«, sagte er zu sich. »Fahr lieber gleich hin, dann hast es hinter dir!«
3
»Das glaubst du nicht, Benni, es schneit, und das im September!«, rief Franzi erstaunt, nachdem sie die Vorhänge aufgezogen hatte.
»Die Bäum, die Bänk, der ganze Park, alles weiß!«
Benedikt trat hinter sie, legte die Arme zärtlich um ihren Leib und meinte, schon eine kleine Wölbung ihres Bauches wahrnehmen zu können. »Dann ist es doch das Beste, wenn wir im Bett bleiben und da frühstücken«, schlug er vor.
Seit fünf Tagen wohnten sie nun im Anwesen der von Lindgrubers, nicht weit vom Chiemsee entfernt. Benedikts Vater, damals noch einer der wohlhabendsten Männer Bayerns, hatte das Haus Ende des letzten Jahrhunderts als Sommersitz für die Familie erbauen lassen. Äußerst repräsentativ und großzügig, mit einer Vielzahl von Räumen, Stallungen für die geliebten Pferde und einem gesonderten kleinen Haus für Stallmeister, Gärtner und sonstige Bedienstete, lag es inmitten eines weitläufigen Parks, der dem Englischen Garten in München nachempfunden war.
Als Kind und Jugendlicher hatte Benedikt nahezu jeden Sommer und zuweilen auch die Weihnachtstage hier verbracht. Er hatte ausschließlich schöne Erinnerungen an diese Zeiten. Die zu Gemütsleiden neigende Mutter war auf dem Lande immer aufgelebt, er hatte noch immer ihr unbeschwertes Lachen im Ohr. Auch der Vater hatte sich Zeit für die Kinder genommen, mit ihnen im Park gespielt oder sie auf seine Ausritte mitgenommen.
Natürlich hätten Franzi und Benedikt wie andere Flitterpaare auch nach Venedig oder Paris fahren können, doch nach den anstrengenden Hochzeitsvorbereitungen, der großen Feier und vor allem in Anbetracht von Franzis noch früher Schwangerschaft hatten sie sich für die Stille und den Rückzug entschieden. Die alte Berta, die seit Jahrzehnten im Dienst der von Lindgrubers stand, war darüber hocherfreut gewesen.
»Der Herr Benedikt als Flitterwöchner! Dass ich das noch erleben darf«, hatte sie gejubelt und sofort alle notwendigen Vorbereitungen getroffen. Der Salon, die Bibliothek und natürlich das große Schlafzimmer wurden hergerichtet, und zur Begrüßung hatte sie das Geländer der großen Freitreppe mit einer Girlande aus Efeu und den letzten Sommerrosen geschmückt. Sie hatte eine lange Liste der Lieblingsspeisen des Herrn Benedikt zusammengestellt und ihre Vorräte so ergänzt, dass sie jederzeit auf Wunsch eine davon zaubern konnte.
»Kaiserschmarrn hat er immer so gern gegessen, aber auch Semmelknödel mit Schwammerl und a Suppenfleisch mit Gemüs und Salzkartoffeln!«
So kam es, dass der junge Herr Benedikt all den Speisen, die ihm die gute Berta zubereitete, mit großem Genuss zusprach, doch die junge Frau Franziska – sie war ja schon eine ganz Liebe – aß so gut wie gar nichts! Blass saß sie immer beim Frühstück und ließ die frischen Kaisersemmerl und Hörndl liegen.
»Da is was Kloans unterwegs, wenn ma die Esserei von der jungen Frau anschaut. A bisserl rund um d’Hüftn is a scho«, spekulierte die alte Berta.
Benedikt schlüpfte wieder unter seine Bettdecke und zog Franzi liebevoll an sich. Freilich war so ein extremer Wettereinbruch zu dieser Jahreszeit unangenehm, und ihr geplanter Ausflug nach Prien konnte nun nicht stattfinden, doch eigentlich war er nicht unglücklich darüber. Er fand es schön, einfach faul im Bett zu liegen und die Gedanken schweifen zu lassen. Noch einmal stand er mit Franzi vor dem Altar der Theatinerkirche und sagte aus vollem Herzen Ja zu dieser strahlenden Braut, die zu dem äußerst schlichten Brautkleid statt eines Schleiers eine extravagante Seidenkappe mit Federbesatz trug. Noch einmal trat er mit ihr hinaus auf den Odeonsplatz, wo Familie, Freunde, Bekannte und Kollegen lärmend bunte Blüten warfen.
Schade, dass sein Vater, dem er in den letzten Jahren wieder nähergekommen war, das nicht mehr erleben durfte; er war vor einem guten Jahr verstorben. Jahrelang hatte er keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt, da der alte Herr es nicht hatte verstehen wollen, dass Benedikt sein Jurastudium, das ihm so viele Türen geöffnet hätte, abgebrochen hatte und zur Polizei gegangen war. Auch die Heiratspläne, die sein Vater für ihn geschmiedet hatte, hatte Benedikt verworfen, und so war es zum endgültigen Bruch gekommen.
Noch einmal dachte Benedikt an den Faschingsball, auf dem er seine Franzi kennengelernt hatte, und an die erste Liebesnacht in ihrem Hutatelier, das mittlerweile zu einem der führenden Münchens gehörte. Er war stolz auf seine Frau, obwohl es ihm manchmal schwergefallen war, die Heirat und den Kinderwunsch wegen ihrer geliebten Hutmacherei immer wieder aufzuschieben. Nun aber waren sie an ihrem Ziel angekommen, doch ob er nun wollte oder nicht, mischten sich sofort sorgenvolle Gedanken in die freudigen. Dringend benötigten sie eine größere Wohnung, die vielleicht gleichzeitig Wohnraum und Hutatelier unter einem Dach sein konnte. Würde es Franzi gelingen, Kind und Hüte »unter einen Hut« zu bringen? Sollten sie eine Haushaltshilfe einstellen? Was würde das alles kosten?
Zu diesen schon nicht sehr ersprießlichen Gedanken gesellten sich noch weit sorgenvollere. Seine berufliche Zukunft stand nämlich auf wackligen Füßen. Vor einem Jahr war sein Chef Schulze-Kaiser ganz plötzlich verstorben, und alle im Amt hatten erwartet, dass der altgediente, erfahrene Kollege Sieberer auf den Chefsessel nachrücken würde. Doch es kam anders.
An einem grauen Montagmorgen bat der Polizeipräsident die gesamte Abteilung zu sich und stellte ihnen den neuen Vorgesetzten vor, Herbert Paschke aus Berlin. Akkurat gescheiteltes Haar, tief liegende stechende Augen, Schmiss auf der Wange und glänzendes Parteiabzeichen am Revers. In kürzester Zeit wurde allen klar, dass für Paschke nur eines zählte: unbedingter Gehorsam, keinerlei Eigeninitiative und Hitlergruß zu jeder Gelegenheit. Die strammen Parteimitglieder unter den Kollegen, und das waren inzwischen nicht wenige, waren sehr angetan von diesem neuen Vorgesetzten; die übrigen, zu denen Benedikt und sein Kollege Otterer gehörten, gerieten immer mehr ins Abseits. Benedikt war schon mehrfach nahegelegt worden, in die Partei einzutreten, doch er hatte es bis jetzt immer irgendwie vermeiden können. Sein Kollege Otterer, ein überzeugter Sozialdemokrat, wurde, wie auch Benedikt, immer öfter bei wichtigen Entscheidungen nicht mehr miteinbezogen und bei Beförderungen übergangen. Seit Juli bestand der gesamte Münchner Stadtrat aus Nationalsozialisten, und nun waren auch alle anderen Ämter und Institutionen bestrebt, nur mehr Parteimitglieder in ihren Reihen zu haben. Otterer wurde offen mit Entlassung gedroht, und nur der Umstand, dass er ohnehin in einem halben Jahr in Rente gehen würde, war wohl seine Rettung. Benedikt war klar, dass er, um seiner kleinen Familie weiter Sicherheit bieten zu können, nicht am Parteieintritt vorbeikam.
»Ich könnt jetzt gut ein Kaisersemmerl mit Marmelade und einen Kaffee vertragen. Ich glaub, die schlimmste Übelkeit hab ich überwunden«, murmelte Franzi schlaftrunken an seiner Schulter und riss Benedikt aus seinen trüben Gedanken. Er küsste ihr zerstrubbeltes Lockenhaar und sprang aus dem Bett.
»Ich sag gleich der Berta Bescheid!«
So verbrachten sie den Tag faulenzend, lesend und vor sich hin dösend; nur die alte Berta rief zwischendurch streng zum Mittagessen und Kaffeetrinken.
Bis zum Nachmittag schneite es weiter, dann wurde es plötzlich heller, die Sonne schien durch die verbliebenen tiefgrauen Wolken, und fast augenblicklich begann es zu tauen, obwohl es schon auf den Abend zuging. Die hohen alten Bäume und der Rasen des Parks glitzerten im Sonnenschein, und klar und überdeutlich konnte man die Berge ausmachen, die noch fast bis in die Täler von Schnee bedeckt waren.
Gerade als sie mit dem Abendessen beginnen wollten, klingelte das Telefon.
»Das Polizeipräsidium aus München. Ein gewisser Herr Paschke!«, rief Berta. Sie bedeckte die Sprechmuschel mit der Hand und flüsterte: »Der hört sich an wie der Führer persönlich.«
Benedikt spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach, als er zum Telefon ging, und auch Franzi war blass geworden.
»Lindgruber«, meldete sich Benedikt. »Ja … Wie? … Morgen? … Sie wissen schon, dass … Ja, ich verstehe … Was, nicht nur für diesen Fall? … Überhaupt … Darüber wird noch zu reden sein … so über meinen Kopf hinweg … Guten Abend.«
Kein »Heil Hitler«, wohlgemerkt!
Benedikt setzte sich wieder an den Abendbrottisch und schob seinen Teller mit Wurstsalat von sich.
»Um Gottes willen, Benedikt, red schon!«, rief Franzi.
»Der Fanderl hat einen Mord oder Totschlag, und der Paschke hat mich als Ermittler abgestellt. Das allein ist ja schon eine Unverschämtheit, der weiß genau, dass wir in Flitterwochen sind. Aber die Höhe ist, dass er mich für unbestimmte Zeit nach Rosenheim ausleihen will, Personalprobleme und so weiter und so fort. Der will mich loshaben, dieses Arschloch!«
Benedikt fluchte selten, aber nun musste es sein, und er belegte den Paschke mit noch so einigen nicht stubenreinen Schimpfnamen.
Mit zornrotem Kopf schob Franzi ihren Teller scheppernd beiseite.
»Das ist das Allerletzte!«, rief sie wutentbrannt. »Und das lässt du mit dir machen? Aber ich hätt’s ja wissen müssen. Als Polizistenfrau is man immer die Ausgschmierte. Aber dass es jetzt schon in die Flitterwochen damit losgeht!«
Und sie sprang auf und verließ wutentbrannt und türknallend die Küche.
Benedikt stützte den Kopf in die Hände und versuchte, ein paar klare Gedanken zu fassen. Da wurde draußen der Türklopfer betätigt.
Benedikt öffnete, und draußen stand verlegen und zerknirscht der Fanderl.
»Mei, Benni, hast es schon erfahren? Des tut mir so leid«, stammelte er. »Des wollt ich fei ned!«
»Das ist mir schon klar, dass du da nichts dafür kannst«, erwiderte Benedikt. »Das haben die Herren Dreissiger und Paschke miteinander ausgeheckt.«
Fanderl ließ sich auf einen Stuhl fallen und berichtete: »Ich komm grad aus der Gerichtlichen Medizin. Wären da nicht die Verletzungen, die ganzen Sezierschnitte und der Geruch … Sie lag da wie eine perfekte Marmorstatue, ein wunderschönes junges Mädchen. Totschlag durch Gewalteinwirkung, vermutlich ein Stein. Kopf und Gehirn rechts deutlich eingedrückt, kein Wasser in der Lunge, also nicht ertrunken … Und sie war noch Jungfrau!«
Er sackte ein wenig auf seinem Stuhl zusammen und stützte den Kopf in die Hände.
Benedikt ging zur Anrichte und schenkte zwei volle Stamperl Enzian ein. Fanderl, der sonst eigentlich dem Alkohol nur sehr bescheiden zusprach, kippte sein Glas auf einen Zug. Benedikt tat es ihm nach, und Fanderl berichtete ihm von Flora, vom Kloster, der Äbtissin und den Novizinnen und natürlich auch, warum sich Flora von Prielmayer im Kloster aufgehalten hatte.
»Die von Prielmayers, das Schauspielerehepaar Münchens. Weit über die Stadt hinaus bekannt, skandalumwittert … hast du von denen noch nie gehört?«, fragte Benedikt erstaunt.
Fanderl schüttelte den Kopf. »Du woast as doch, i bin a Landei!«
4
Fanderl und Benedikt hatten sich für den nächsten Morgen beim »Seewirt« verabredet. Dem Hinweis der alten Schwester Kreszentia, dass sich dort eventuell eine kleine Liebschaft Floras angebahnt habe, wollten sie unbedingt nachgehen.
Beide wirkten etwas übermüdet und angeschlagen. Fanderl war immer wieder durch das herzzerreißende Weinen seines Sohnes, der offensichtlich einen großen Backenzahn bekam, geweckt worden, und Benedikt hatte die halbe Nacht versucht, seine Franzi zu beruhigen, was ihm jedoch kaum gelungen war.
Seit fast dreihundert Jahren befand sich der Seewirt nahe der kleinen Dampferanlegestelle, von der aus das Boot hinüber zur Fraueninsel verkehrte. Genauso lang war das Wirtshaus auch im Besitz der Familie Habegger, inzwischen allerdings ausgebaut und erweitert sowie von einem schattigen Biergarten umgeben.
Während die ersten Habeggers nur einen kleinen Ausschank geführt und an vorbeikommende Fuhrleute und die wenigen Leute, die zur Insel hinüberwollten, etwas Proviant und Getränke verkauft hatten, erlebte der Seewirt Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts durch die stark anwachsende Zahl von Ausflüglern und Sommerfrischlern einen enormen Auftrieb. Man erzählte sich, dass Hieronymus Habegger, der Vater des jetzigen Wirts Josef, sogar die königliche Familie bewirtet habe. Hieronymus Habegger war sehr geschäftstüchtig gewesen und seine Frau eine begnadete Köchin, sodass aus dem Seewirt wohl eine Goldgrube hätte werden können, wäre da nicht der verhängnisvolle Hang des Hieronymus zum Glücksspiel gewesen. Aber so stand nach dem Tod des alten Seewirts sein Sohn Josef mit einer nicht unbeträchtlichen Menge Schulden da. Obwohl er schon seit Jahren mit der hübschen Maria aus Stephanskirchen verbandelt war, blieb ihm nichts anderes übrig, als die schwerreiche Bauerntochter Veronika Stammler zu ehelichen. Deren Eltern waren froh, die schmallippige, immer etwas griesgrämige und nicht mehr ganz junge Veronika loszuwerden. Sie kochte nicht schlecht, hielt eisern das Geld beisammen, und sie und der Josef schafften es, trotz der wahrlich nicht häufig stattfindenden Beischlafbesuche drei Kinder zu zeugen.
Allerdings gab der Josef seine Besuche in Stephanskirchen nie ganz auf, und so liefen auch dort zwei Buben mit der typischen Habegger-Visage – etwas feistschädelig und mit wulstigen vollen, fast weibischen Lippen – umher.
Der Älteste aus Josefs Verbindung mit Veronika war Alfred, der vom Aussehen her seinem Vater sehr ähnelte. Äußerst kräftig, schon jung zur Korpulenz neigend, hatte Alfred die dicken Habegger-Lippen und einen breiten roten Schädel, der auf einem viel zu kurz geratenen Hals saß.
Doch vom Wesen her glich Alfred seinem Vater keineswegs. Während dieser von beschaulich behäbiger Gemütlichkeit war und freundlich im Umgang mit den Gästen, wenn auch ein wenig umständlich und schwerfällig, besaß Alfred von klein auf ein stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Schon in der Schule war er von Anfang an der Anführer, und es gab nicht viele, die es wagten, ihm zu widersprechen. Wie kein anderer verstand er es, mit sprachlicher Gewandtheit und seinem gebieterischen Auftreten seine Geschwister und seine Altersgenossen in eisernem Griff zu halten. Als einer der Ersten trat er der Rosenheimer Hitlerjugend bei, weil es im Dorf so etwas noch nicht gab, und arbeitete sich rasch in der Organisation hoch. Schließlich gelang es ihm, auch in seinem Dorf einen NSDAP-Ortsverein zu gründen, und als am 30. Januar 1933 Hitler an die Macht kam, marschierte Alfred mit seinem inzwischen schon beträchtlich angewachsenen Tross mit Fahnen und Fackeln durch die Dorfstraße.
Die meisten Dörfler blieben in ihren Stuben, doch es gab auch einige, die sich ihnen mit der Hoffnung auf nun anbrechende große neue Zeiten anschlossen. Fritz Bergleitner hisste eine kleine rote Fahne an seiner Dachrinne, aber da sein Haus ziemlich außerhalb lag, fiel das niemandem auf.
Die zweitgeborene Habegger, die Lisi, ähnelte sehr ihrer Mutter und wurde deshalb von den Dorfkindern immer »die dürre Goas« genannt. Seit ihr einmal bei einem Sturz auf dem zugefrorenen See zwischen Dorf und Insel die selige Irmengard mit einer Kerze in der Hand erschienen war und sie gerettet hatte, war sie sonderbar geworden. Alle wussten, dass es sich in Wirklichkeit um die Fischersfrau Gruber mit einer Laterne gehandelt hatte, die ihr aufgeholfen und sie nach Hause gebracht hatte; doch die Lisi war von der Erscheinung fest überzeugt und widmete von da an der Seligen ihr Leben. Mindestens dreimal die Woche und natürlich sonntags ruderte sie hinüber zu ihrer Irmengard, und in der Votivkapelle des Münsters hing gut sichtbar ein Taferl, das die Lisi blutend auf dem Eis zeigte, zusammen mit der seligen Irmengard, die hilfreich über ihr schwebte. Der 16. Juli, der Todestag von Irmengard, der ersten Äbtissin von Frauenchiemsee, die vor nicht allzu langer Zeit vom Papst seliggesprochen worden war, war für viele Gläubige in der Gegend, aber besonders für Lisi Habegger der wichtigste Festtag des Jahres.
Das jüngste Habegger-Kind, der Sohn Theo, war zwei Jahre nach der Lisi am Fronleichnamstag auf die Welt gekommen. Da der Altar für die Prozession unmittelbar vor dem Seewirt aufgebaut war, hatten sich die Gebete der Prozessionsteilnehmer mit dem Wimmern und Schreien der Gebärenden vermischt.
Theo hatte weder den typischen Habegger-Kopf noch wie sein Vater eine Neigung zur Korpulenz oder zur Magerkeit wie seine Mutter. Nein, er war ein äußerst ansehnlicher hübscher Kerl, nur seine Lippen waren etwas voll, was ihm aber gut zu Gesichte stand. Er war ein freundlicher, eher zurückhaltender junger Mann und hatte im Gegensatz zu seinem Bruder mit der Partei, ihren Uniformen und Fahnen gar nichts am Hut. Seit er begonnen hatte, politisch zu denken, schwebte ihm eine friedliche, freie Gesellschaft ohne Standesunterschiede und mit gleichen Rechten und Pflichten für alle vor. Natürlich war er wie seine Geschwister sehr in den Betrieb der Gastwirtschaft eingebunden, doch er war der Schöngeist unter ihnen. Er las gerne und spielte schon, seit er fünfzehn war, die Orgel in der Kirche. Gelegentlich sah man ihn bei Anbruch der Dämmerung auch mal im Häusl des roten Bergleitners verschwinden.
»Mei, die Flora, des arme Madl!«, empfing der Wirt Fanderl und Lindgruber. »Wer macht denn so was? Und Sie sind a wieder mit dabei, Herr von Lindgruber. Des ist ja wunderbar! Was darf ich den Herren anbieten?«
Benedikt und Gustav bestellten Kaffee und setzten sich an einen Tisch, von dem aus man auf den See blicken konnte. Auch heute schien die Sonne immer wieder durch die grauen Wolken und ließ den aufgewühlten See funkeln. Auf dem Weg zum Dampfersteg blitzten noch die letzten Schneereste.
»Haben Sie die Flora besser gekannt, Herr Habegger?«, fragte Benedikt.
»Mei, sie war halt oft herüben zum Einkaufen und hat die Post bracht, immer lustig und freundlich war s’. Mit meinem Jüngsten hat sie sich a bissl angfreundet ghabt. Die haben viel diskutiert, die zwei.«
»Diskutiert?«, fragte Fanderl ein wenig zweifelnd.
»Ja, ja, über Politik, übers Theater und über Bücher, die sie glesen haben. Des mit der Politik hab ich nicht so gernghabt. Und vor allem mein ältester Sohn hat sich immer furchtbar aufgregt. Der is nämlich a ganz a Wichtiger in der Partei, müssen S’ wissen.«
»Und Sie, Herr Habegger?«, unterbrach Benedikt.
»I?«, meinte der Wirt. »I führ hier mei Geschäft, i komm mit alle gut aus. Mit der Politik hab i nichts am Hut. I les mei Gastwirtszeitung und sonst nix.«
»Sind denn Ihre Söhne zu sprechen?«, fragte Fanderl.
»Der Groß ist am Schlachthof, aber der Kloane hilft grad meiner Frau in der Küch. Mir habn heut Abend a Vereinsfeier. Da gibt’s viel vorzubereiten.«
So machten sich Fanderl und Benedikt auf in die Küche. Am großen Herd stand vor einer Menge von Töpfen die Frau des Hauses.
Ohne einen Gruß sagte sie mit äußerst unfreundlicher Stimme: »Mir ham vui Arbeit und gar koa Zeit!«
Neben ihr stand eine jüngere Frau, die genauso dünn war, ebenso mürrisch blickte und ein goldenes Kettchen mit einem Anhänger der seligen Irmengard um den Hals trug. Sie würdigte die beiden Ermittler keines Blickes.
Aus einem Nebenraum trat ein junger Mann mit einem großen Korb Kartoffeln. Das musste Theo, der Jüngste, sein.
»Wir müssten uns mal mit dir unterhalten, Theo«, sagte Fanderl.
»Wegen der Flora?«, erkundigte sich Theo, und Tränen traten ihm in die Augen.
Unter den missbilligenden Blicken der beiden Frauen folgte er den beiden Polizisten zum Tisch in der Wirtsstube. Da die Gaststätte am frühen Vormittag noch leer war und der alte Wirt im Nebenraum herumräumte, konnten sie sich ungestört unterhalten.
»Die Flora war die Liebste, Schönste und Gescheiteste, die ich bisher kennengelernt habe«, sagte Theo, und wieder schwammen seine Augen in Tränen. »Mit ihr konnte ich über alles reden.«
»Hatten Sie denn auch eine Liebesbeziehung?«, erkundigte sich Benedikt.
Theo zögerte. »Ja, schon so a bisserl.«
»Also wie jetzt, des musst uns schon genauer erklären«, bohrte Fanderl nach.
Theo errötete und wand sich ein wenig. »Sie wollte sich niemandem ganz hingeben, sie wollte sie selbst bleiben. Erst wolle sie sich selbst genau kennenlernen, bevor sie sich auf jemanden einlässt, hat sie gemeint. Geküsst haben wir uns schon, und ich hätt schon auch ganz gern mehr wollen, aber da ist sie hart geblieben. Dabei war sie sonst so fortschrittlich, sie war ja schließlich früher beim Theater, und da geht’s bekanntlich locker zu. Aber vielleicht hat sie da auch schlechte Erfahrungen gemacht. Sie is ja auch wegen ihrem Vater weg vom Theater, weil der unbedingt eine große Schauspielerin aus ihr machen wollt.«