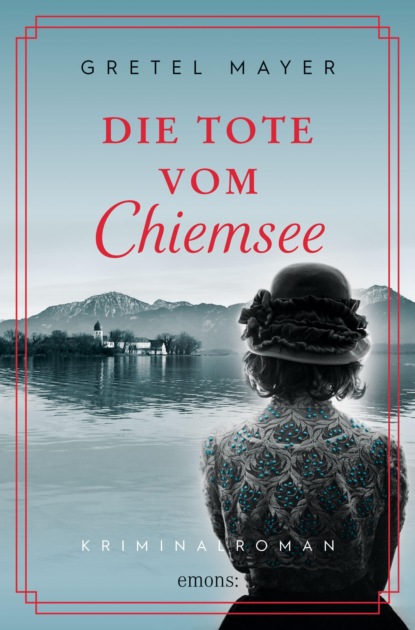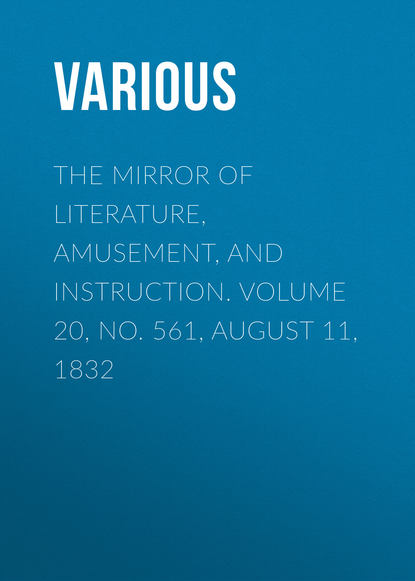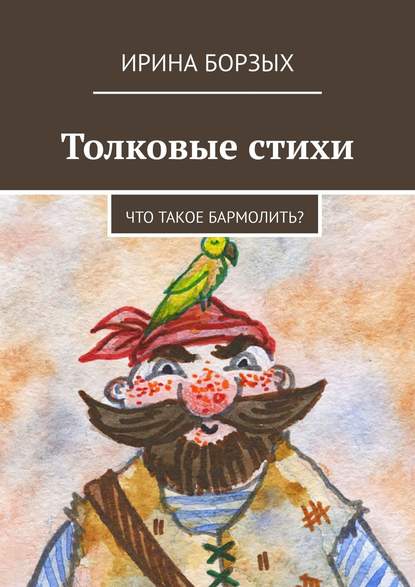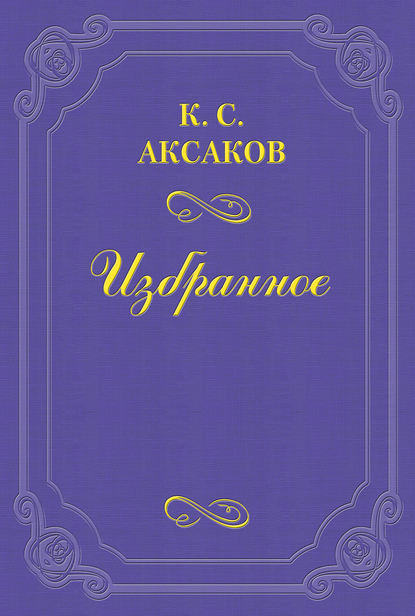- -
- 100%
- +
»Wie war sie denn politisch eingestellt, die Flora?«, erkundigte sich Benedikt.
Theo zögerte abermals.
»Wenn Sie sich in allem so gut verstanden haben, haben Sie doch bestimmt auch in dieser Hinsicht Ansichten geteilt?«, bohrte Benedikt noch einmal nach.
Theo straffte sich. »Wenn Sie’s genau wissen wollen, wir haben die Hitlerschen ganz und gar abgelehnt. Ab und zu haben wir uns mitm Bergleitner und mitm Xaver, dem Knecht vom Huberbauern, unterhalten. Das sind ja noch die Einzigen hier im Dorf mit vernünftigen Ansichten.«
»Und deine Eltern und Geschwister? Was haben die dazu gemeint?«, wollte jetzt der Fanderl wissen.
»Ach, meinen Eltern war das eigentlich egal. Mein Vater hat manchmal gmeint, so eine aus der Stadt wär nichts für mich. Meine Mutter hat gar nichts gsagt, nur grantig gschaut wie immer, und die Lisi hat zu ihrer Irmengard gebetet. Bloß mein großer Bruder, der Alfred, der hat furchtbar gschimpft. Der ist ja sehr aktiv in der Partei, für den gilt ja nichts anderes mehr. Der will ja schon seit Jahren, dass ich da mitmach, und mit der Erna, der Tochter von der Vorsitzenden der NS-Kreisbäuerinnen, will er mich auch immer verkuppeln. Der war einfach stocksauer auf die Flora, vor allem, weil sie nie mit ihrer Meinung hinterm Berg ghalten hat.«
Theo schüttelte den Kopf. »Der Alfred hat nur Angst ghabt vor die berühmten Theaterleut in München und vor der Äbtissin, sonst hätt er die Flora womöglich noch anzeigt. Vollkommen ausgerastet ist er, als die Flora dann noch auf die Idee kam, eine Laienschauspieltruppe zu gründen und jeden Monat im Seewirt was aufzuführen. Von wegen ›subversivem Gedankengut‹ hat er rumgeschrien und dass er sie zum Teufel jagen wird!«
Theo liefen nun die Tränen über die Wangen.
»Sie war mein Lebensmensch«, stammelte er schluchzend. »Des muss doch ein Unfall gwesn sein, wer würd denn meine Flora umbringen?«
»Der Form halber müssen wir dich jetzt noch fragen, wo du gestern zwischen acht Uhr abends und zwei Uhr nachts warst, Theo«, sagte Fanderl.
»Hier in der Wirtschaft, im Ausschank, von abends sieben bis nach eins. Und dann hab ich noch aufgräumt«, antwortete Theo. »Meine Eltern und die Lisi können’s bezeugen. Der Alfred hat freighabt.«
In diesem Moment öffnete sich die Küchentür, und die Lisi rief: »Kommst jetzt endlich zum Kartoffelschälen?«
Theo stand auf.
Fanderl und Benedikt tranken ihren Kaffee aus.
»Also der trauert schwer, der Theo, und außerdem hat er ein handfestes Alibi. Aber diesen Alfred müssen wir uns unbedingt schnell vorknöpfen«, meinte Benedikt.
»Dass wir zwei uns immer mit so braunen Gesellen rumschlagen müssen«, sinnierte Fanderl vor sich hin.
»Sei vorsichtig mit dem, was du sagst, du bist Staatsdiener! Haben sie dich eigentlich noch nie gefragt, wann du in die Partei eintrittst?«, fragte Benedikt. »Ich steh da ganz schön unter Druck.«
Fanderl zuckte die Achseln. »Ich hab gesagt, dass ich ja schon Wachtmeister bin und außerdem noch Mitglied in der freiwilligen Feuerwehr. Das wäre genug! Seitdem hab ich nix mehr ghört.«
»Na, wart’s mal ab«, meinte Benedikt pessimistisch.
5
Als Fanderl und Benedikt den Seewirt verlassen wollten, trafen sie an der geöffneten Tür mit einem wahrlich aufsehenerregenden Paar zusammen. Die eintretende Dame war groß und stattlich, sie trug einen wallenden schwarzen Nerzmantel und einen ebenso schwarzen Hut mit Federn. Der Spitzenschleier vor ihrem Gesicht war auf so raffinierte Weise durchsichtig, dass man die stark geschminkten Züge darunter ziemlich genau wahrnehmen konnte. Unter dem Hut und seitlich des Schleiers quollen blondierte Locken hervor. Ihr folgte ein Mann mit schwarzer Pelerine und einem schwarzen Filzhut, er war wesentlich schmaler als die Dame und auch um einiges kleiner. Benedikt war sofort klar, wen er da vor sich hatte: das legendäre und skandalumwitterte Schauspielerehepaar Siegfried und Henriette von Prielmayer, die Eltern der toten Flora.
Durch Fini Pichler, die Sekretärin des Kommissariats, die eine begeisterte Theatergängerin und stets bestens über das Leben der Schauspieler informiert war, wusste Benedikt von Lindgruber so einiges über das Paar. Zum Beispiel war niemandem so recht klar, wie das »von« vor den urbayerischen Namen Prielmayer gelangt war. Manche behaupteten, der Prielmayer habe sich den Adelstitel einfach selbst verliehen, er stamme ganz schlicht aus der bekannten Metzgerfamilie Prielmayer, die in München mehrere Geschäfte hatte. Andere meinten, er sei der uneheliche Sohn einer Fanny Prielmayer, einer mittelmäßigen Varieté-Tänzerin, und sein Vater der Sänger Gerofried Liebsam vom Gärtnerplatztheater, der es nie in die erste Besetzung geschafft hatte.
Jedenfalls war Siegfried von Prielmayer als sehr junger Mann wie Phönix aus der Asche in den Besetzungslisten des Münchner Schauspielhauses aufgetaucht und hatte in kürzester Zeit die Herzen des Publikums erobert, vor allem natürlich die der Frauen. Mit dichtem schwarzen Haar, glutvollen dunklen Augen und einem äußerst fein geschnittenen Gesicht war er eine eindrucksvolle Erscheinung. Seine eher helle Stimme war weich und flirrend, konnte aber, wenn die Rolle es verlangte, durchaus an Kraft und Stärke gewinnen. Der einzige Makel Prielmayers war, dass er nicht sehr groß gewachsen war. Er trug deshalb immer Schuhe mit erhöhten Absätzen und sehr lange Hosen, die diese verbargen.
Natürlich war der junge Schauspieler, der von Beginn an eine Rolle nach der anderen spielte, kein Kostverächter, und so reihte sich, bis er Henriette Rottmann kennenlernte, Affäre an Affäre. Das sollte nicht heißen, dass sich die beiden dann in ihrem Zusammenleben besonders treu gewesen wären, nein, alle zwei gingen des Öfteren »ganz schön nebennaus«, was zwangsläufig zu familiären Szenen führte, die absoluten Bühnencharakter hatten.
Siegfried von Prielmayer und Henriette Rottmann hatten sich bei einer privaten Faschingsfeier kennengelernt, zu der Henriette, im Haar eine wilde Federkombination, in einem fleischfarbenen Trikot erschienen war, das nichts, aber auch gar nichts von ihren üppigen weiblichen Formen verbarg, und Siegfried war ihr auf der Stelle verfallen. Die junge Frau war nach dem Besuch so einiger Internate wieder nach München zurückgekommen und hatte sich in den Kopf gesetzt, Schauspielerin zu werden. Allerdings war sie zweimal durch die Aufnahmeprüfung der Schauspielschule gefallen, und auch dem privaten Schauspiellehrer Gero Hauptmann, den sie jahrelang konsultierte, war es nicht gelungen, ihr sonderlich viel schauspielerisches Können beizubringen.
Möglicherweise wäre die Liaison zwischen Siegfried und Henriette von gar nicht so langer Dauer gewesen, hätten nicht beide über einen messerscharfen, berechnenden Verstand verfügt. Henriette erkannte, dass ihr der gefeierte Jungschauspieler den Weg auf die ersehnte Bühne bereiten konnte, und für Siegfried sollte es durch die Verbindung mit der wohlhabenden Bürgerstochter endlich vorbei sein mit Geldknappheit und Schulden. So wurde eine selbstverständlich rauschende Hochzeit gefeiert, und bald stand natürlich auch Henriette auf den Brettern, die die Welt bedeuten, allerdings zu ihrer Empörung nur in den kleinsten und unbedeutendsten Rollen.
Ihre ständigen Beschwerden und Auftritte beim Intendanten brachten große Unruhe in die Truppe, und so waren alle mehr als erleichtert, als sie verkündete, dass sie guter Hoffnung sei und sich deshalb für einige Zeit von der Bühne zurückziehen werde. Nach einer komplizierten Schwangerschaft, bei der Henriette unnatürlich viel Gewicht zulegte, wurde die hübsche kleine Flora geboren. Nach zwei Jahren kehrte Henriette mit einer deutlich üppigeren Figur auf die Bühne zurück und fand sich schließlich damit ab, Frauen mittleren Alters und sogenannte Matronenrollen zu verkörpern.
Neben der Schauspielerei beteiligte sie sich lebhaft am gesellschaftlichen Leben der Stadt, und da ihr Mann mittlerweile schlanke, sehr junge Damen bevorzugte, nahm sie sich ebenfalls einen Liebhaber nach dem anderen. Die kleine Flora, die mehr oder weniger von der Haushälterin aufgezogen wurde, sah diesem Treiben mit erstaunten Kinderaugen zu.
Fanderl, dem inzwischen auch klar geworden war, wen er da vor sich hatte, trat auf die beiden schwarzen Gestalten zu.
»Wenn Sie gestatten«, sagte er und deutete einen leichten Diener an, »Wachtmeister Gustav Fanderl. Ich bin mit den Ermittlungen zum Tode Ihrer Tochter Flora befasst. Das ist mein Kollege, Polizeioberkommissär Benedikt von Lindgruber aus München, ebenfalls in dieser Angelegenheit ermittelnd tätig. Unser tief empfundenes Beileid.«
Die schwarz gekleidete Dame schluchzte etwas theatralisch auf, taumelte, und Fanderl fürchtete einen Moment lang, sie würde Benedikt in die Arme sinken. Doch sie klammerte sich dann doch an ihren Mann, der aufrecht und steif dastand und keine Anstalten machte, sie zu stützen oder gar den Arm um sie zu legen. So geleiteten die beiden Ermittler das dunkle Paar zu ihrem Tisch und orderten beim Wirt noch einmal Kaffee.
»Und einen Cognac, bitte«, rief die Dame hinterher.
Da ihr Mann sich sofort gesetzt hatte und apathisch vor sich hin starrte, half Benedikt ihr aus dem Mantel. Sie schlug den Schleier mit einer gekonnten Handbewegung zurück, und Benedikt fiel auf, dass ihre auf aparte Art schwarz umrandeten Augen keine Spur von in den letzten Stunden geweinten Tränen zeigten. Fanderl wiederum stachen die vollen, dunkelrot geschminkten Lippen Henriette von Prielmayers ins Auge, und er fragte sich, wie man in einer derartigen Lebenssituation noch so viel Wert auf sein Aussehen legen konnte.
Siegfried von Prielmayer sah im Gegensatz zu seiner Frau wesentlich erschütterter aus. Sein schon von Natur aus blasses Gesicht war erschreckend bleich, und er hatte dunkle Ringe unter den Augen. Seine Augen blickten starr und stechend, und Benedikt fragte sich, ob er vielleicht etwas eingenommen hatte. Während seine Frau ihr Cognacglas leerte, ergriff von Prielmayer mit seiner hellen, klaren Bühnenstimme das Wort.
»Wir waren schon auf der Insel bei meiner Schwägerin. Sie hat das Kind nicht beschützt und so der Welt eine außerordentlich vielversprechende junge Schauspielerin genommen!«
Henriette von Prielmayer schluchzte in der gleichen theatralischen Weise wie zuvor und betupfte ihre Augen mit einem Spitzentüchlein.
Dann bat von Prielmayer: »Ich will sie jetzt sehen, meine liebe Flora«, und nun zitterte seine Stimme doch ein wenig.
Seine Frau starrte ihn an, als hätte er einen absolut unanständigen Wunsch geäußert, besann sich dann aber wieder auf ihre Rolle und schluchzte erneut auf.
Nun wandte sich Benedikt an beide zugleich: »Dürfen wir Ihnen, bevor wir Sie nach Rosenheim bringen, noch ein paar Fragen stellen?«
Von Prielmayer erhob sich, als wollte er einen Monolog halten. »Jetzt, jetzt wollen Sie uns befragen? Jetzt, in unserer unermesslichen Trauer, und noch bevor wir von unserem Kinde Abschied genommen haben?« Er erhob seine Stimme, die nun dunkler und getragener klang, so als hätte er die Rolle gewechselt. »Machen Sie sich lieber auf die Suche nach dem Mörder, der offenbar noch frei hier in der Gegend umherläuft, und lassen Sie uns in unserer tiefen Trauer allein.«
Und wieder, wie auf ein Stichwort hin, schluchzte Frau von Prielmayer auf.
Fanderl, der sich bis jetzt pietätvoll beherrscht hatte, ging diese gekünstelte Schluchzerei allmählich gehörig auf die Nerven. Mit seiner gestrengen Polizistenstimme, die er mittlerweile recht gut beherrschte, wandte er sich an das Paar: »Dann müssen wir Sie leider zu einer offiziellen Befragung einbestellen.«
»Tun Sie, was Sie nicht lassen können, meine Herren Wachtmeister«, antwortete von Prielmayer herablassend. »Würden Sie uns nun bitte eine Droschke rufen, die uns nach Rosenheim bringt.«
Normalerweise hätten Fanderl oder von Lindgruber trauernde Angehörige selbst zur Gerichtlichen Medizin gefahren, doch in diesem Fall sahen sie keine Veranlassung dazu. So endete der Auftritt der beiden mit einem weiteren Schluchzen von Frau von Prielmayer und einem stechenden Blick des Herrn von Prielmayer. Auf die Idee, ihren Kaffee und den Cognac zu bezahlen, kamen beide nicht.
Fanderl ließ sich auf seinen Stuhl fallen und trank den inzwischen schon kalt gewordenen Kaffee aus.
»Da können wir uns auf was gefasst machen, mit dene zwei«, stöhnte er.
Benedikt nickte. »Aber wir lassen nicht locker. Ich denke, dass es das Beste ist, wenn wir sie in München in ihrer gewohnten Umgebung aufsuchen. Wir müssen eh das genauere Umfeld der Toten dort in Augenschein nehmen.«
Währenddessen saß Franzi, obwohl Berta ihr eigens Kipferl mit hausgemachter Himbeermarmelade hingestellt hatte, missmutig am Frühstückstisch. Die halbe Nacht hatte Benedikt versucht, ihr klarzumachen, dass er seinen Freund Fanderl nicht im Stich lassen könne, Flitterwochen hin oder her. Franzi hatte zwar weiterhin gewettert und geschimpft, doch in ihrem Innersten konnte sie ihren Ehemann schon verstehen.
Was die zeitweilige Versetzung nach Rosenheim betraf, so sei da sicher noch nicht das letzte Wort gesprochen und er werde vehement dagegen protestieren, hatte Benedikt ihr versprochen. Doch zwischen den Zeilen hatte Franzi schon bemerkt, dass er keine sonderlich großen Hoffnungen hatte, gegen Paschke anzukommen, und dass er womöglich sogar erleichtert war, ein wenig aus dem Gesichtsfeld des fanatischen Nationalsozialisten zu rücken.
Doch wie sollte das gehen? Sie, Franzi, in München, er, Benedikt, in Rosenheim? Und das Kind? Ihr Hutatelier würde sie jedenfalls auf keinen Fall aufgeben.
Franzi biss nun doch mit Appetit in ihr Kipferl und nahm sich vor, sich durch diese neuen Umstände die Laune nicht verderben zu lassen. Sie musste sich einfach etwas einfallen lassen für die nächsten Tage, und sie beschloss, an diesem Nachmittag Gustav Fanderls Frau Therese einen Besuch abzustatten. Sie mochte Therese, die um einiges jünger war als sie und aus einfachen Verhältnissen stammte, sehr gern, denn sie war immer fröhlich und herzlich und hatte einen äußerst gesunden Menschenverstand.
Therese Fanderl freute sich sehr über Franzis Besuch. Sie saßen in der guten Stube, tranken Holundersaft und unterhielten sich über die beschwerlichen ersten Monate der Schwangerschaft, über den schwierigen Beruf ihrer Männer und natürlich auch über das so außergewöhnliche Wetter, das in den letzten Tagen den frühherbstlichen Chiemgau zur Winterlandschaft gemacht hatte. Mittlerweile schien jedoch immer mal wieder die Sonne, es war um etliche Grade wärmer geworden, und der Schnee war vollkommen weggetaut. Während der See fast sommerlich blau blitzte, waren die Berge noch bis fast ins Tal mit Schnee bedeckt. Überall tropfte und plätscherte es, und die dunkelroten Geranien an den Fenstern des Fanderlhauses, die vom Schnee nahezu erdrückt worden waren, zeigten nun doch wieder Leben und reckten ihre Blüten der Sonne entgegen.
Während sich beiden Frauen unterhielten, rannte der kleine Korbinian unermüdlich durch die Stube und schob ein kleines Polizeiauto vor sich her.
»Ja, der kommt ganz nach seim Vater«, meinte Therese lachend.
Gerade als Franzi sich verabschieden wollte, betrat Thereses Schwiegermutter die Stube. Sie war in Begleitung einer alten Bäuerin in Chiemgauer Tracht, die eine große schwarze Hutschachtel trug. Franzi war beim Anblick der Hutschachtel natürlich wie elektrisiert, konnte ihre Neugier nicht zügeln und fragte nach dem Inhalt.
»Do is der Priener Hut von der Agnes drin, i hab’n ihr wieder hergricht«, erklärte die alte Frau.
»Die Agnes« war Fanderls Mutter und die Bauersfrau die Fanny Müller aus Traunstein. Die Fanny öffnete nun die Hutschachtel und legte den Hut auf den Tisch. Solche Kopfbedeckungen hatte Franzi schon mehrfach bei den Chiemgauerinnen gesehen, vor allem an Sonn- und Festtagen, aber sie hatte ihnen nie große Beachtung geschenkt. Jetzt aber war sie fasziniert. Vor ihr lag ein Hut aus schwarzem Filz – »aus Hasenhaar«, wie die Fanny erläuterte –, mit goldenen Borten um den Kumpf und zwei handgestickten goldenen Quasten – »Können aber auch vier sein«, erklärte die Fanny weiter. Der Hut war nicht sehr hoch und hatte eine nicht sonderlich breite Krempe, deren Unterseite ebenfalls mit feiner Goldstickerei versehen war. An beiden Seiten des Hutes waren lange Samtbänder befestigt, die »Hint-obi-Bänder«, die im Nacken mit einem Haken befestigt wurden und bis zum Trachtenrock hinabreichten.
»Guat hast’n wieder hergricht«, lobte die Agnes. »Sie müssen wissen, Frau von Lindgruber, dass der Hut schon seit vier Generationen in unserer Familie ist. Was der schon alles mitgmacht hat! Und die Fanny, müssen S’ wissen, ist die Großnichte von der Huaterer-Nanni. Die Huaterer-Nanni aus Prien hat den Hut nämlich erfunden. Zuerst war’s a Strohhut, mit dem hat sie in Berlin a Medaille errungen; erst später sind dann der Hasenfilz, die goldenen Borten, die Quasten und die Goldstickerei dazugekommen. Die Chiemgauerinnen tragen den Hut seit Anfang des Jahrhunderts, und nachdem die Weiberleut seit 1920 auch in den Trachtenvereinen dabei sein dürfen, ist er sehr bekannt geworden. Sie sollten sich mal den Hut von der Luise Riedinger anschaun. Die hat im Dorf den schönsten!«
Franzis Begeisterung und Tatendrang waren geweckt. Ihr spukten bereits so einige Ideen durch den Kopf: Man könnte doch zum Beispiel die Hüte der Stadtfrauen mit Accessoires des Priener Hutes kombinieren, ohne dass gleich ein richtiger Trachtenhut dabei herauskommen müsste. Es wurde vereinbart, dass die Luise Riedinger mit ihrem Hut in den nächsten Tagen bei Franzi vorbeischauen sollte, Therese würde ihr Bescheid geben.
Auf dem Nachhauseweg fühlte Franzi sich richtig beschwingt. All ihre Sorgen waren mit einem Mal wesentlich kleiner geworden.
6
»Ich glaub, aus dieser Wirtschaft kommen wir heut gar nicht mehr raus«, stöhnte Benedikt. »Außer dem Alfred müssen wir ja auch noch die zwei Weibsleut einvernehmen.«
»Wir könnten sie natürlich auch aufs Revier bestellen«, meinte Fanderl. »Aber das hab ich auch von dir glernt, dass es immer gscheiter ist, die Leut in ihrer gewohnten Umgebung zu befragen, da reden s’ mehr. Außerdem ist’s hier einfach gemütlicher.«
Daher baten sie den Wirt, nun seine Frau und die Tochter bei ihnen vorbeizuschicken. Der Alfred sollte erst gegen zwei Uhr mittags vom Schlachthof zurückkommen.
Die beiden Habegger-Frauen nahmen widerwillig am Tisch Platz, eine schaute griesgrämiger als die andere.
»Frau Habegger, Sie haben die Flora ja auch gekannt. Erzählen Sie doch ein wenig über sie«, begann Benedikt die Befragung.
Wie sich herausstellte, war Frau Habegger keine Freundin vieler Worte. »Ja, kennt hab ich sie, mögn hab ich sie nicht«, antwortete sie kurz und bündig, schlug den Blick nieder und knetete ihre Hände.
Benedikt seufzte innerlich auf. »Flora war eng mit Ihrem Sohn Theo befreundet. Was haben Sie davon gehalten?«
»Nix. Die hat hier ned neipasst.«
»Wieso?«
»A Stadtmadl war s’, a Theatermensch und a Kommunistin no dazu!«
»Ihr Sohn Alfred hat das auch nicht gutgeheißen?«
»Na!«
Benedikt gab auf und wandte sich an Lisi Habegger. Sie rieb und knetete den Irmengard-Anhänger, der an ihrer schmalen Brust baumelte.
»Die war nie in der Kirch, nie hod s’ a Gebet gsprochn. Sogar d’Abendandacht drüben im Kloster hat s’ immer gschwänzt! Die hod an nix glaubt! Die war mit die Roten und mitm Teufel im Bund! Sie war a Hex!«, brach es aus Lisi heraus.
»Woher wollen Sie das wissen? Sind Sie oft in der Kirch?«, fragte Benedikt.
Lisi Habegger nickte eifrig. »Seit die selige Irmengard mich gerettet hat …«, begann sie eifrig, doch Fanderl schnitt ihr das Wort ab.
»Ja, die Gschicht kennen wir schon, Lisi.«
Lisi schaute beleidigt und schien entschlossen, kein Wort mehr zu sagen. Ihr ohnehin schon schmaler Mund wurde zum Strich.
Abschließend bestätigten die Habegger-Frauen, der Wirt und die Bedienung Elsi, die gerade gekommen war, noch, dass der Theo den ganzen Abend bis spät in die Nacht hinter der Theke gestanden hatte. Sie selbst seien entweder in der Küche, ebenfalls hinter dem Tresen und in der Bedienung gewesen. Alle bis spät in die Nacht.
»A paar Hockableiba warn halt da«, erklärte der Wirt abschließend.
»Jetzt vertreten wir uns die Füß, bis der Alfred kommt«, schlug Fanderl vor, und sie traten vor die Wirtschaft. Es waren kaum mehr Wolken am Himmel, ein leichter frischer Wind wehte, der See, auf dem nun wieder Schiffsverkehr war und sogar ein einsames Segelboot kreuzte, glänzte samtblau, und beiden Männern kamen der dichte Schneefall und der heftige Sturm fast wie ein Traum vor.
»Was ist denn das für eine Geschichte mit der Lisi und der Irmengard?«, fragte Benedikt.
»Oh mei«, meinte Fanderl, »i war ja selber dabei. Des dürft schon bald zwanzig Jahre her sein, mir warn alle noch Kinder. Jedenfalls war der See zwischen Dorf und Insel damals fest zugfrorn. Des war natürlich a großer Spaß für uns. Wir sind den ganzen Tag mit die Schlittschuh und die Schlitten rumgrutscht. Die Lisi war auch dabei.«
Als es dann dunkel wurde, erzählte Fanderl weiter, hätten die Eltern die Kinder nach Hause gerufen, und da sei aufgefallen, dass die Lisi fehlte. Sofort seien alle mit Lichtern und Lampen ausgeströmt und hätten nach ihr gesucht. Es habe wohl schon einige Zeit gedauert, aber dann habe die Gruberin sie gefunden. Offenbar sei die Lisi in der Dunkelheit aus Versehen nicht zum Dorf, sondern in Richtung der Insel gegangen und unterwegs so unglücklich auf den Kopf gestürzt, dass sie das Bewusstsein verloren habe. Und weil die Gruberin einen hellen Fellmantel angehabt und eine Lampe in der Hand getragen habe, sei die Lisi, wie sie wieder zu sich gekommen sei, fest davon überzeugt gewesen, dass die selige Irmengard mit ihrer Kerze sie gerettet habe. Seit diesem Vorfall sei die Lisi ein wenig seltsam. Sie habe sich auch seit damals nicht mehr weiterentwickelt, sie sei heute noch wie ein Kind, und es gebe für sie nichts anderes als die Irmengard und ihren geliebten Bruder Alfred, dem sie jede Meinung nachplappere und jeden Wunsch von den Augen ablese.
»Aber mit dem Tod von der Flora wird sie wohl nichts zu tun haben«, meinte Benedikt, »dazu ist sie doch zu schwächlich und zu unselbstständig.«
Fanderl zuckte die Achseln. »Die ist zäher, als man denkt. Ich könnt mir schon vorstellen, dass sie aus hündischer Liebe zu ihrem großen Bruder zu so was fähig wäre. Doch sie war ja auch den ganzen Abend in der Wirtschaft.«
Fanderl stockte und zeigte zum Seeweg. »Schau mal, Benedikt, da kommt doch dei Frau!«
Und tatsächlich kam ihnen auf dem Seeweg der kleine Einspänner entgegen, der im Besitz der Familie von Lindgruber war und sicher schon fünfzig Jahre auf dem Buckel hatte. Elegant, im grauen Kostüm und ein grünes Hütchen mit Feder auf dem Kopf, fuhr Franzi ihnen entgegen, und es sah aus, als hätte sie ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht als einen Einspänner zu lenken. Sie stoppte das Gefährt formvollendet vor ihnen und rief: »I komm grad von der Therese!«
»Da habt ihr wahrscheinlich sauber geschimpft auf eure zwei Polizisten«, meinte Benedikt.
Franzi schüttelte den Kopf. »So wichtig seids ihr zwei jetzt auch wieder nicht. Nein, wir haben einen Hut angeschaut, einen Priener Hut, ich kann euch sagen …«
»Das erzählst du mir dann heut Abend daheim«, fiel ihr Benedikt ins Wort, der ungeheuer erleichtert war, seine Franzi wieder guter Dinge zu sehen.
Und was hat zum Stimmungswandel beigetragen? Ein Hut, was sonst, dachte er und musste innerlich schmunzeln.
Franzi setzte ihren Weg fort, und Fanderl und Benedikt gingen zurück in den Seewirt. Alfred war inzwischen heimgekehrt; er lehnte, ein Glas Bier in der Hand, an der Theke und schaute ihnen mit herausforderndem Blick entgegen. Unter seiner Schankschürze wölbte sich ein für sein jugendliches Alter beachtlicher Bauch, die obersten beiden Hemdknöpfe standen offen und zeigten seinen enorm kurzen dicken Hals.
»Heil Hitler, die Herren!«, rief er.
Fanderl und Benedikt murmelten etwas, und man machte sich auf in die Nebenstube, um ungestört zu sein. Dabei lief mit hochrotem Kopf die Lisi an ihnen vorbei, steckte einen Zettel in ihre Schürzentasche und rief devot: »Bin scho unterwegs, Alfred. Geht alles in Ordnung!«