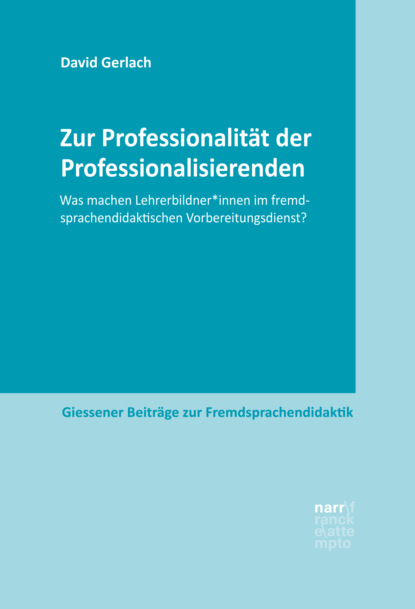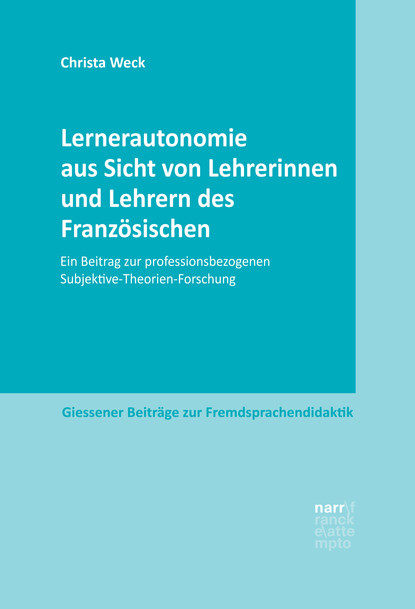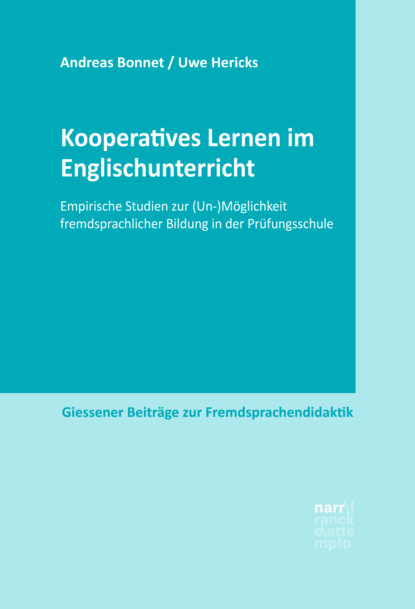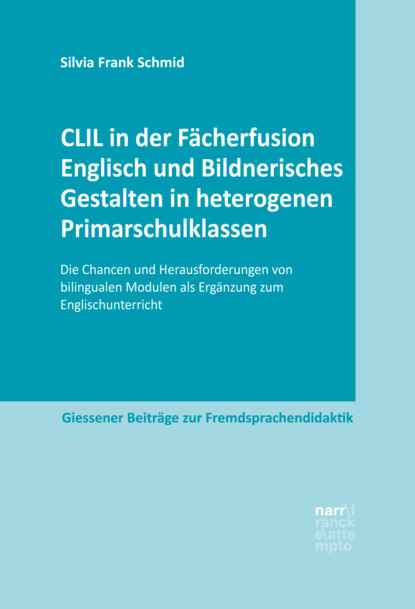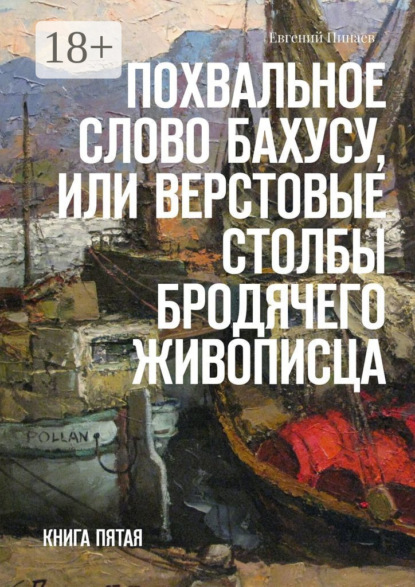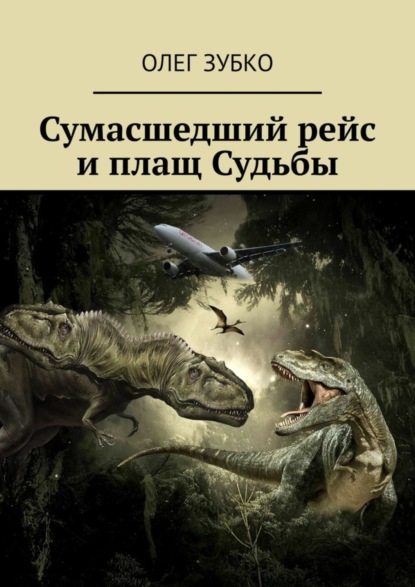Kompetenzentwicklung und Mehrsprachigkeit
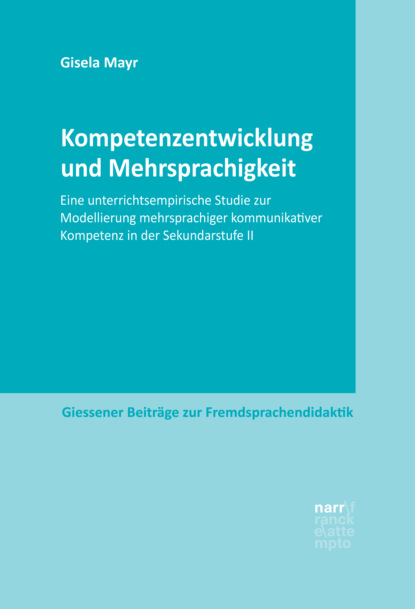
- -
- 100%
- +

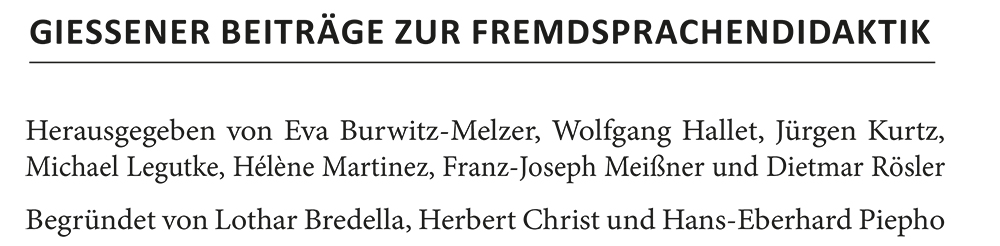
Gisela Mayr
Kompetenzentwicklung und Mehrsprachigkeit
Eine unterrichtsempirische Studie zur Modellierung mehrsprachiger kommunikativer Kompetenz in der Sekundarstufe II
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
[bad img format]
© 2020 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
www.narr.de • info@narr.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-8233-8358-1 (Print)
ISBN 978-3-8233-0191-2 (ePub)
Ich möchte mich besonders bei Herrn Professor Hallet und Frau Professor Martinez für die intensive Betreuung und die konstruktive Kritik an meiner Arbeit bedanken. Ihre Feedbacks haben mich immer zum Überdenken meines Vorhabens angeregt und zu Verbesserungen geführt. Prof. Hallet hat mich zudem mit viel Geduld wieder in die Kunst des wissenschaftlichen Schreiben eingeführt. Weiters möchte ich Prof. Legutke und Prof. Burwitz-Melzer für ihre Anregungen danken, die mir geholfen haben, die anfänglichen Schwierigkeiten zu überwinden und einen völlig neuen Kurs in meiner Projektplanung einzuschlagen, der sich als erfolgreich erwiesen hat. Die Korrekturen meiner Lektorin und Freudin Andrea waren für mich eine Stütze, ohne die ich es nicht geschafft hätte. Zuletzt wollte ich noch meinem Mann David für seine Geduld und Zuwendung danken, meinen Kindern Laetitia und Clemens, die mich immer wieder angespornt haben, weiter zu machen, insbesondere Clemens der mir bei der Transkriptionsarbeit zur Hand gegangen ist.
Vorwort
Als ich vor mehreren Jahren begann, mehrsprachige Module in den Regelunterricht einzubauen, bemerkte ich sofort, dass die Lernenden große Freude daran hatten, ihr gesamtes sprachliches Repertoire auszuprobieren und im spielerischen mehrsprachigen Umgang miteinander gestalterisch tätig zu sein. Sie erschlossen durch die gleichzeitige Arbeit mit mehreren Sprachen und Kulturen unterschiedliche Bedeutungsdimensionen und waren im Idealfall in der Lage, selbst Bedeutung kreativ zu konstruieren.
Im Rahmen dieses Forschungsprojektes – durchgeführt am Gymnasium „Walther v.d. Vogelweide“- in Bozen- wurde simultane Mehrsprachigkeit im Unterricht mittels experimenteller Unterrichtsmodule im Laufe des Schuljahres sukzessive in den Sprachunterricht eingebaut. Jedes Modul erstreckte sich über 10 bis 20 Unterrichtsstunden und verfolgte das Ziel, den Lernenden auf der Basis multimodaler Arbeitsunterlagen die Möglichkeit zu bieten, simultane Mehrsprachigkeit im schulischen Alltag zu (er)leben. Auch die Outputs waren mehrsprachig: Narrative, poetische sowie Sachtexte, Vorträge, Gedichte, Sketches und kurze szenische Darbietungen wurden gleichzeitig in mehreren Sprachen vorgetragen.
Die Verwendung mehrerer Sprachen in einem alltagsnahen Setting ermöglichte einen sprachübergreifenden Vergleich von Genres und damit eine Kompetenzerweiterung in verschiedenen fachsprachlichen Bereichen. Ein weiteres didaktisches Ziel bestand darin, durch Sprachvergleich das Bewusstsein dafür zu wecken, dass sprachlicher Umgang und Ausdrucksformen geschichtlich bedingt sind und dass sich Kulturen und ihre Sprachen in ihrer unterschiedlichen Erfassung von Realität geschichtlich verorten lassen (vgl. Bredella et al. 2000).
Es handelte sich dabei folglich um den Versuch, Ausschnitte der komplexen lebensweltlichen Mehrsprachigkeit, so wie sie für viele Lernende bereits alltäglich ist, ins Klassenzimmer zu bringen und in Richtung einer bildungssprachlichen Mehrsprachigkeit weiterzuentwickeln, einer Mehrsprachigkeit mit größerer syntaktischer und lexiko-grammatischer Komplexität. Dabei wurde im Rahmen der empirischen Untersuchung überprüft, welche Lernprozesse stattfinden und wie sich mehrsprachige kommunikative Kompetenz und mehrsprachige Sprachhandlungskompetenz (MKK) entwickeln und sich im Sinne einer Operationalisierung im Unterricht modellieren lassen.
Die Datenerhebung erfolgte auf mehreren Ebenen: Auf der sprachlich-pragmatischen Ebene, bei der der Fokus auf Sprachmanagement und funktioneller Mehrsprachigkeit lag (vgl. De Angelis 2005; De Angelis & Selinker 2001; Arabski 2006; Cenoz et al. 2002), auf der Ebene des Einsatzes von Transferstrategien und der Aktivierung des mehrsprachigen Lexikons im Rahmen mehrsprachiger kommunikativer Settings, auf der Ebene der Funktionsweise des Language Mode (vgl. Norton 2000; Grosjean 1982, 1989, 1992, 2007) und dessen möglichen Veränderungen. In engem Zusammenhang damit standen auch Erhebungen bezüglich der Entwicklung des metasprachlichen Bewusstseins und der Wahrnehmung der Psychotypologie von Sprachen.
Sprachhandlungsfähigkeit – in diesem Falle mehrsprachige Sprachhandlungsfähigkeit – ist Voraussetzung für die Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung, da sich Identität durch Sprache gestaltet und darstellt (vgl. De Florio-Hansen 2003a; 2003b: VIII). In einem plurilingualen Umfeld tragen völlig neue und unbekannte Erkenntnisfaktoren zur Persönlichkeitsbildung bei und können diese nachhaltig positiv beeinflussen. Dabei spielt die Sprachbiographie und die damit einhergehende Einstellung den unterschiedlichen Sprachen gegenüber eine besondere Rolle (Dewaele 2010; Dewaele & van Oudenhoven 2009). Maßgeblich zur Entwicklung dieser Einstellung zu Sprachen tragen auf emotionaler Ebene Erfahrungen im Umgang mit den Sprachen bei. Jeder einzelne Lernende bringt sprachbiographisch bedingte emotionale Aspekte und damit verbundene Haltungen unbewusst mit in den Unterricht ein (vgl. Busch 2013: 52). Besonders in einer durch historische Brüche gekennzeichneten Gesellschaft gestalten sich diese Biographien sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite gibt es Lernende, die zwei- bzw. mehrsprachig aufwuchsen, auf der anderen Seite Familien, welche die Zweitsprache Italienisch noch immer verweigern. Im folgenden Absatz wird der Versuch unternommen, die geschichtlichen und sozialen Gründe, die zu diesen diversen Haltungen führen, anhand eines geschichtlichen Abrisses zu erläutern.
Da im mehrsprachigen Austausch diese unterschiedlichen Auffassungen, Emotionen, Einstellungen und Haltungen aufeinandertreffen und sich gegenseitig beeinflussen (vgl. Pavlenko 2005), konnte überprüft werden, ob durch die hier praktizierte Form des Unterrichts auch Formen der unbewussten Sprachverweigerung bewusst gemacht und somit überwunden werden können (vgl. Edwards & Dewaele 2007; Norton 2000). Aus kontextgebundenem Sprachvergleich wird den Sprechern unmittelbar ersichtlich, dass Kultur in Form von sprachlichem Umgang und sprachlichen Ausdrucksformen geschichtlich bedingt ist und Sprachen Realität unterschiedlich erfassen. Das gleichzeitige Arbeiten mit und zwischen mehreren Sprachen und Kulturen ermöglicht es dem Individuum, die eigene Persönlichkeit neu zu formen: „An die Stelle autonomer Individuen, die in stabile, homogene Nationalkulturen eingebettet sind, treten sich wandelnde Identitäten in kulturübergreifenden Netzwerken.“ (De Florio-Hansen & Hu 2003b : 9) (vgl. dazu auch Kramsch 2011: 205).
Eine Unterrichtsform, die dies im Blick hat, distanziert sich von starren nationalstaatlich geprägten Auffassungen und orientiert sich hin zu mehr Offenheit und zu der Entfaltungsmöglichkeit des gesamten Individuums mithilfe der Gesamtheit seines kulturellen und sprachlichen Repertoires und seiner emotionalen Haltungen. Besonders in einem durch die politischen Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegszeit gekennzeichnetem Land ist dies von Bedeutung.
1. Ziele, Gegenstand und Struktur der Studie
Die Situation in Südtirol ist geschichtlich bedingt vom Zusammenleben unterschiedlicher Sprachen und Kulturen geprägt. Zwei- und Mehrsprachigkeit sind deshalb von zentraler Bedeutung für alle bildungspolitischen Maßnahmen und die Entwicklung des Landes. Im Laufe der Geschichte kam es zu Konfliktsituationen, die bis heute nachwirken und teilweise ungelöst blieben. Da außerdem die schulischen Institutionen aufgrund der massiven Zuwanderung aus anderen europäischen Ländern, der Flüchtlingsströme und des zunehmenden Drucks vonseiten der Eltern reagieren müssen, rückt der Begriff der Mehrsprachigkeitsdidaktik immer mehr in den Fokus, vor allem weil immer dringlicher wird, dass Maßnahmen zur Inklusion und Sprachbildung getroffen werden.
Der erste Abschnitt dieser Arbeit setzt sich zunächst mit den Forderungen von Mehrsprachigkeit innerhalb der Europäischen Union und ihrem komplexen sozio-politischen Gefüge auseinander (2.1.). Insbesondere werden jene bildungspolitischen Dokumente hervorgehoben, in denen die Europäische Union richtungsweisend eingreift und eine Definition von Mehrsprachigkeit und Mehrsprachigkeitsdidaktik gibt, auf deren Basis konkrete Maßnahmen zur Umsetzung angedacht werden sollten. Dabei nimmt der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (Europarat GER, 2001) eine zentrale Rolle ein, denn er stellt erstmals eine für Europa einheitliche Skalierung der fremdsprachlichen Kompetenzen in Form von Deskriptoren zur Verfügung. Obwohl der 2018 erschienene Ergänzungsband (Council of Europe CEFR/CV, 2018) (2.1.) erst nach der Datenauswertung der vorliegenden Studie erschienen ist, wird auch er in seinem Bezug zur vorliegenden Arbeit kommentiert, da er einen großen Fortschritt in Richtung Mehrsprachigkeit darstellt, weil hier erstmals Deskriptoren für die Kompetenzbereiche Mediation und Mehrsprachigkeit ausformuliert wurden und der Bereich Literarisches Lernen mit den entsprechenden Deskriptoren angeführt wird. Da diese drei Aspekte, die im GER zwar z.T. angeschnitten, aber nicht durch Deskriptoren erfasst wurden, in der vorliegenden Forschungsarbeit einen prominenten Platz einnehmen, erscheint es aus erkenntnistheoretischen Gründen wichtig, den CEFR/CV mit einzubeziehen.
Der Europäische Referenzrahmen für Mehrsprachigkeit ( Candelier et al FREPA 2012) diente zwar als Modell für den Entwurf des vorliegenden Kompetenzmodells für Mehrsprachigkeit, er hat allerdings die gleichen Schwächen wie der Europäische Referenzrahmen für die Sprachen (vgl. hierzu auch Steininger 2014; Quetz 2003; Bausch et al. 2003) (2.3.): In großen Teilen ist der FREPA zu abstrakt und für die Evaluation des Unterrichtes nicht geeignet, da die angegebenen Deskriptoren zwar für den Kompetenzbereich Mehrsprachigkeit von großer Bedeutung sind, aber die Erhebung des Kompetenzzuwachses im Unterricht aufgrund der Abstraktheit der Deskriptoren und der Unübersichtlichkeit des gesamten Dokuments sehr erschwert werden. Es fehlt außerdem größtenteils eine wissenschaftliche Fundierung: Die Deskriptoren wurden lediglich den Erfahrungsberichten von Lehrenden entnommen, weshalb eine wissenschaftliche Fundierung fehlt. Der FREPA lässt außerdem das Savoir s’engager außen vor. Es wird in seiner Wichtigkeit für den mehrsprachigen Lernprozess nicht anerkannt und auch nicht als Desiderat ausgewiesen. Die vorliegende Kompetenzmodellierung hingegen verfolgt das Ziel, das Savoir s’engager in die Modellierung aufzunehmen und unternimmt darüber hinaus erstmals einen ersten Versuch Deskriptoren auszuformulieren (10.2 ff)
Im nächsten Abschnitt wird die Relevanz von Mehrsprachigkeit im schulischen Alltag und im Unterricht behandelt (2.4.). Zunächst wird das Desiderat einer mehrsprachigen Schule, wenn auch nicht erschöpfend, so doch im Ansatz thematisiert. Es wird in der bildungspolitischen Diskussion kaum angesprochen, obwohl es für die Anschlussfähigkeit des Unterrichts an die lebensweltlichen Anforderungen, die an die SchulabgängerInnen gestellt werden, von zentraler Relevanz wäre. In diesem Zusammenhang versteht sich das Forschungsprojekt als Versuch, ein didaktisches Modell zu konstruieren, das den Forderungen eines kompetenzorientierten Unterrichts gerecht wird und gleichzeitig einen Bezugspunkt darstellt, der vermittelnd zwischen lebensweltlicher Mehrsprachigkeit und traditionellem schulischen Fremdsprachenunterricht eingreift, wobei das Erkenntnisinteresse primär auf die Lernprozesse ausgerichtet ist, die im Unterricht stattfinden. Da bislang empirische Untersuchungen zu diesem Thema fehlen, also auf keine empirisch untermauerten Vorlagen aufgebaut werden konnte, war die Erforschung ein Entdeckungsprozess.
Insbesondere werden hier zwei Aspekte hervorgehoben, welche in engem Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt stehen und zentrales Anliegen desselben sind (2.4.1/2.4.2.): Zunächst gilt es, den Begriff der Inklusion und deren Implikationen für schulisches Handeln zu beleuchten und in Zusammenhang zu bringen mit Mehrsprachigkeit, wobei aufgezeigt wird, wie Inklusion nur über mehrsprachiges und transkulturelles schulisches Handeln erfolgen kann. Andererseits wird die Wichtigkeit der curricularen Verankerung von Mehrsprachigkeit unterstrichen, denn nur wenn diese als schulisches Kerngeschäft in ihrer fächer- und stufenübergreifenden Valenz schriftlich verankert wird, kann sie wirklich zur alltäglichen Selbstverständlichkeit werden. Anschließend werden Vorschläge zur Implementierung neuer Ansätze zur Mehrsprachigkeit einhergehend mit einigen laufenden oder soeben abgeschlossenen Projekten vorgestellt.
Im folgenden Abschnitt wird auf mehrsprachigkeitsdidaktische Ansätze der europäischen und außereuropäischen Tradition eingegangen: Mehrsprachigkeitsdidaktik nach Meißner, Interkomprehensionsdidaktik, Tertiärsprachenlernen und CLIL (3.1-3.5). Bezugnehmend auf das Aufgabenformat der Studie – der mehrsprachigen komplexen Kompetenzaufgabe – werden diese dargestellt und die darin vorkommenden Lernprozesse in ihrer Komplexität aufgezeigt. Da die mehrsprachige komplexe Kompetenzaufgabe einen umfassenden Lernprozess initiiert, der zu großen Teilen alle Kompetenzbereiche der anderen pluralistischen Ansätze beinhaltet, stellt sie ein den anderen Ansätzen unterliegendes Aufgabenformat dar, in das deren Aspekte den Zielsetzungen und Anforderungen der konkreten Unterrichtssituation entsprechend aufgenommen werden. Im Unterschied zu diesen werden im folgenden Absatz jene Desiderate der herkömmlichen mehrsprachigen Ansätze aufgezeigt, die in der mehrsprachigen Kompetenzaufgabe Berücksichtigung finden und für die holistische Entwicklung der Lernenden von grundlegender Wichtigkeit sind.
Im folgenden Absatz steht der Kompetenzbegriff in der Fremdsprachendidaktik im Mittelpunkt (4.1.). Im Vordergrund stehen hier die kommunikative Kompetenz und Texterschließungskompetenz aufgrund ihres engen Zusammenspiels beim Fremdsprachenlernen allgemein und insbesondere in der Mehrsprachigkeitsdidaktik. Ausgehend von der Definition des Kompetenzbegriffes in den Rahmenrichtlinien für Sprachen für Südtirols Schulen (Schwienbacher et.al 2017) werden verschiedene Traditionen und unterschiedliche Begriffsdefinitionen analysiert und eine für in diesem Forschungsprojekt anvisierte theoretische Modellierung mehrsprachiger Kompetenz sinnvolle Begriffsdefinition versucht, die eine Operationalisierung ermöglichen soll.
Das Erfassen mehrsprachiger kommunikativer Kompetenz (MKK) im Unterricht erfordert weiterhin, dass ausgehend von der Fremdsprachendidaktik eine Reihe von Referenzwissenschaften hinzugezogen werden müssen, um der Komplexität des Phänomens gerecht zu werden, wobei die angewandten Sprachwissenschaften und insbesondere die Mehrsprachigkeitsforschung im Mittelpunkt stehen (4.2.-4.6.). Ohne fundiertes Wissen über die sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse in diesem Bereich ist es nicht möglich, mehrsprachige Lernprozesse in ihrer Komplexität zu erkennen, zu beschreiben und einen Bogen zu spannen in Richtung Fremdsprachendidaktik. Dabei kamen bei der Datenanalyse Aspekte zum Vorschein, die für die Modellierung eines mehrsprachigen kommunikativen Kompetenzbegriffs als Indikatoren herangezogen werden können, um so den Erfordernissen der Deskriptivität nachzukommen. Die theoretische Modellierung mehrsprachiger kommunikativer Kompetenz (MKK) sieht folgende Kompetenzbereiche vor: symbolische Kompetenz, psycholinguistische und soziolinguistische Aspekte der MKK, Sprach(en)bewusstheit, mehrsprachige Gesprächspraktiken, Emotion. Zunächst gilt es, die Begrifflichkeit „einsprachig-, zwei-, und mehrsprachig“ zu definieren, um sie für den weiteren Gebrauch im Forschungsprojekt nutzbar zu machen. Anschließend werden, nach einer Einführung in den Begriff der Multicompetence nach Vivien Cook, unterschiedliche Modelle des mehrsprachigen Spracherwerbs vorgestellt und auf ihre Relevanz für eine Mehrsprachigkeitsdidaktik hin kritisch hinterfragt.
Psycholinguistische Aspekte der Mehrsprachigkeit stehen im Folgenden im Fokus. Dabei werden all jene mehrsprachigen Phänomene erläutert, die für die Auswertung der Aushandlungsprozesse und der vier Fallstudien von Relevanz sind. So können bei der Datenanalyse die aus der Diskursanalyse und den Stimulated Recalls/Leitfadeninterviews gewonnenen Erkenntnisse in ihrer Wichtigkeit für den mehrsprachigen Spracherwerbsprozess und der Entwicklung mehrsprachiger kommunikativer Kompetenz (MKK) erkannt werden. Es wird dadurch zudem ein tieferes Verständnis der didaktischen Maßnahmen ermöglicht, die zu einem kompetenzbezogenen mehrsprachigen Unterricht führen. Es gilt dabei, in der Datenauswertung zu überprüfen, inwiefern und in welcher Form die in der theoretischen Modellbildung identifizierten Bereiche wiederzufinden sind. Diese dient als Vorlage und Orientierungshilfe, entlang welcher die Daten der Studie geordnet bzw. verifiziert oder falsifiziert werden können. Gleichfalls sollen neue aus der Studie resultierende Kompetenzbereiche/Kategorien, die in der theoretischen Modellierung MKK keine Erwähnung finden, diese ergänzen (vgl. Aguado 2016: 246).
In der Folge wird einleitend das geschichtliche und gesellschaftliche Umfeld umrissen, in dem die Studie durchgeführt wurde (5.1.). Zunächst wird die komplexe sprachliche und bildungspolitische Situation in Südtirol zusammengefasst, indem ein geschichtlicher Abriss vom Ende des Ersten Weltkrieges bis in die Gegenwart aufzeigen soll, wie ein Sprachtrauma, das unsere Region zum Teil auch heute noch prägt, zustande kam und wie auf politischer Ebene versäumt wurde oder nicht möglich war, hier mit gezielten Maßnahmen einzugreifen, um Aufarbeitungsarbeit zu leisten. Erst in den letzten Jahren wurde das Diktat des getrennten Sprachenunterrichtes in dieser Region aufgebrochen, da erstens die Europäische Union die Mehrsprachigkeit mit Nachdruck fordert und zweitens die sprachliche Situation so komplex geworden ist, dass auf bildungspolitischer Ebene reagiert werden muss, und nicht zuletzt, weil immer mehr Eltern Mehrsprachigkeit in der Schule fordern.
Die Situation dieser Region ist durch Besonderheiten gekennzeichnet, die sich maßgeblich auf den Kompetenzerwerb der einzelnen Lernenden auswirkt. Immer noch beeinflussen die geschichtlichen und sozialen Ereignisse, die dieses Land geprägt haben, jede bildungspolitische Entscheidung hinsichtlich Sprachen und Sprachenlernen maßgeblich mit. Bislang waren GER und FREPA im Bereich der Mehrsprachendidaktik Bezugspunkt für Schülerbewertung und Unterrichtsevaluation auch in Südtirol die einzigen Orientierungsrahmen. Es wird deshalb kurz darauf eingegangen, in welcher Form diese Empfehlungen in den letzten Jahren in Südtirol rezipiert wurden, wie die Südtiroler Rahmenrichtlinien für den Sprachenunterricht entstanden sind und wie der Südtiroler Referenzrahmen für die Mehrsprachigkeit aus dem FREPA abgeleitet wurde (Schwienbacher et al. 2017). Des Weiteren werden in diesem Abschnitt das Projekt und seine Forschungsschwerpunkte umrissen und in seinem Umfeld verortet.
Im darauffolgenden Abschnitt wird nach einer allgemeinen Einführung zum aufgabenorientierten Unterricht auf die Besonderheiten der komplexen Kompetenzaufgabe eingegangen und in ihren Eigenschaften erklärt (6.1.). Anschließend wird auf das Forschungsdesign übergeleitet. Zunächst wird der schulische Datenerhebungskontext umrissen, der Wechsel von der LehrerInnen in die ForscherInnenrolle kritisch reflektiert und in diesem Zusammenhang die Gütekriterien, die dieser Arbeit unterliegen, erläutert. Im Folgenden wird die Dokumentation und Analyse der Datensätze detailliert in allen ihren Aspekten transparent gemacht (6.3.).
Anschließend wird eine Unterrichtseinheit in ihrem Modellcharakter vorgestellt und ihr Aufbau beschrieben. Dabei wird die ursprünglich für den einsprachigen Fremdsprachenunterricht konzipierte Komplexe Kompetenzaufgabe von W. Hallet (; Hallet 2006, 2008, Hallet & Krämer 2012a/b) für den mehrsprachigen Unterricht adaptiert. Es wird im Einzelnen angeführt, wie die Kompetenzziele im mehrsprachigen Unterricht z. T. neu definiert werden, indem Aspekten der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit mehr Raum im Unterricht zugesprochen wird. Da die Auswahl der Texte für die einzelnen Module u.a. literarische Texte im weiteren Sinne vorsah, kommt auch den literarischen Kompetenzen, so wie sie in der Tradition der rezeptionsästhetischen Literaturdidaktik (Burwitz-Melzer 2007) verstanden werden, große Bedeutung zu, da diese im Zusammenhang mit der Lese- und kommunikativen Kompetenz in einem mehrsprachigen Forschungsrahmen in Bezug auf Informationsentnahme und Verarbeitungsprozesse Bestandteil der Modellierung von mehrsprachiger kommunikativer Kompetenz sind (6.4.).
Darauf folgen die Einzelanalysen der Aushandlungsprozesse. In den auszugsweisen Aufzeichnungen der Aushandlungsprozesse werden für den Lernprozess relevante Stellen im Diskurs hervorgehoben und diskursanalytisch untersucht. Es werden Auszüge analysiert, die in besonderem Maße den Kompetenzerwerb im Bereich der MKK aufzeigen. Die Analyse der Aushandlungsprozesse soll eine Perspektivenvielfalt ermöglichen, die die SchülerInnenauswertung ergänzt und so die Validität der Daten garantiert (7.1.). Auf die Auswertung der Aushandlungsprozesse folgen die vier SchülerInnenauswertungen (8). Sie beinhalten die Auswertungen der Fragebögen zur Sprachbiographie und Auszüge aus den Aushandlungsprozessen. Diese ergeben zusammen mit den Ergebnissen der drei Stimulated Recalls, des abschließenden Leitfadeninterviews, des Forschungstagebuches und der Analyse der selbst verfassten Texte, ein Gesamtbild der individuellen Lernprozesse und der im mehrsprachigen Unterricht geforderten Strategien, Fähigkeiten und Fertigkeiten der einzelnen Probandinnen. Hier wird die dokumentarische Methode (Bohnsack 2013) herangezogen, da sie aufgrund ihrer Eigenschaften als besonders geeignet erachtet wird, die Entwicklung der symbolischen Kompetenz in ihrer Prozessmäßigkeit im mehrsprachigen Diskurs zu erfassen.
Besondere Berücksichtigung finden in diesem Zusammenhang die persönlichen, kulturellen und sprachlichen Voraussetzungen der einzelnen Lernenden. Ihr Einfluss auf den Kompetenzzuwachs steht in diesem Kontext im Fokus. Dies wirft die Frage auf, welchen Kompetenzzuwachs Lernenden mit unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Voraussetzungen erfahren, wie dieser individuelle Lernprozess sich in Anbetracht der unterschiedlichen kognitiven Voraussetzungen von zwei- bzw. mehrsprachigen und einsprachigen SchülerInnen gestaltet und welche Wechselwirkungen entstehen, wenn mehrsprachige und einsprachige Lernende in einem mehrsprachigen Setting zur gemeinsamen mehrsprachigen Arbeit veranlasst werden. Es stellt sich die Frage, wie sich in diesem Kontext mehrsprachiges soziales Lernen gestaltet und welcher Kompetenzzuwachs sich für alle Beteiligten daraus ergeben kann. Im dann folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse aller Teilanalysen im Vergleich zueinander in einem systematischen Überblick dargelegt (10.1.). Die verschiedenen Aspekte und Daten werden systematisch verglichen und miteinander vernetzt, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, die für die konkrete Durchführung mehrsprachigen Unterrichts ebenso wie für den Erkenntnisgewinn des gesamten Forschungsprojekts von Interesse sind. In einem Abstraktionsprozess werden die so erhaltenen Daten in Indikatoren umformuliert, um Kompetenzbereiche herauskristallisieren zu können. Daraus ergeben sich folgende Forschungsfragen: