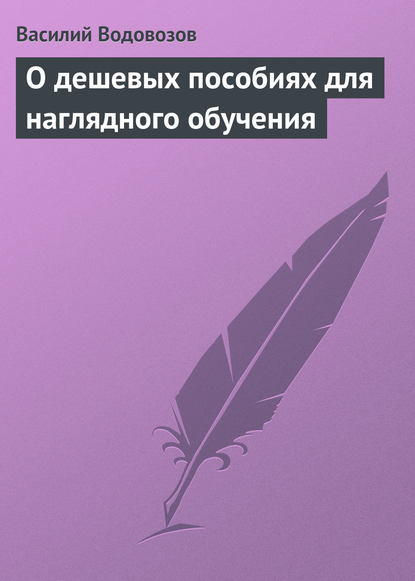Seewölfe Paket 34

- -
- 100%
- +
An Santander glaube ich nicht. Die Übernahme von Proviant weist darauf hin, daß die Schatzschiffe noch eine längere Distanz zurückzulegen hatten.
Also doch Kurs Irland? Aber das Schreiben Seiner Majestät spricht dagegen.
Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr gelange ich zu der Überzeugung, daß Verrat im Spiel und der Konvoi für Spanien verloren ist. Franzosen, Holländer oder Engländer haben den größten Fischzug der Geschichte durchgeführt. Es ist unglaublich.
Ich werde zu retten versuchen, was noch zu retten ist.“
Logbucheintragung vom 16. Dezember 1598.
„Gibt es eine schlimmere Demütigung, als hinter vorgehaltener Hand ausgelacht zu werden? Ich erhalte keine Flotte von Kriegsschiffen, mit der ich der Spur des Konvois folgen könnte. Solange der königliche Befehl ausbleibt, gibt es keine verschwundenen Schatzschiffe.
Allerdings wurde mir bedeutet, ich könnte meinen Aufenthalt und den der ‚Aguila‘ frei bestimmen.
Genau das werde ich tun. Morgen, Schlag sechs Uhr, beginnt das Bunkern von Proviant und Munition. Ich hoffe, daß die Arbeiten bis zum Einbruch der Nacht beendet sein werden.
Die ‚Aguila‘ geht wieder in See. Ich habe el Lobo del Mar aufgespürt und besiegt, ich werde nicht ruhen, bevor mir das Schicksal der Schatzschiffe klar ist. Und wenn es eine verdammt lange Reise wird …“
Logbucheintragung vom 18. Dezember 1598.
Der 20. Dezember war ein kühler und regnerischer Tag, an dem ein steifer Westwind den Atlantik aufpeitschte. Trotzdem verließ die „Aguila“ beim ersten Morgengrauen den sicheren Schutz der Bucht von Cádiz. Capitán César Garcia wollte keine Stunde länger als unbedingt nötig warten.
Das Wetter blieb trist und stürmisch. Erst am Mittag des dritten Tages rundete das Kriegsschiff Kap São Vicente in weniger als zwei Seemeilen Entfernung. Nicht ein portugiesisches Schiff war zu sehen.
In der Folge gewann der Sturm noch an Heftigkeit. Dem Kapitän blieb nur die Wahl, entweder umzukehren und einen sicheren Hafen anzulaufen oder weiter auf die offene See hinaus zu kreuzen, um zu vermeiden, daß das Schiff auf Legerwall getrieben wurde. Garcia entschied sich für letzteres.
Selbst die Sturmsegel hielten dem peitschenden Regen und den Sturmböen nicht stand. Das Tuch zerfetzte, kaum daß es angeschlagen war.
Mannshohe Brecher rollten über Deck und zerschlugen Teile der Verschanzung und der Aufbauten. Die „Aguila“ wurde zum Spielball der entfesselten Elemente. An eine Umkehr war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu denken.
Die Hölle hatte sich aufgetan und schickte sich an, den Viermaster zu verschlingen. Alle halbe Stunde wechselten die Mannschaften an den Lenzpumpen ab, aber selbst durch die verschalkten Luken drang mehr Wasser ein, als die Pumpen wieder nach draußen beförderten.
An Schlaf war nicht zu denken. Zwei Tage hindurch tobte der Sturm mit unverminderter Heftigkeit, dann schien er endlich seinen Höhepunkt überschritten zu haben.
„Das Schlimmste haben wir hinter uns, falls der Sturm nicht wieder losbricht. Die Schäden sind beträchtlich, aber es ist nichts, was sich nicht beheben ließe.
Wir haben zwei Decksleute verloren: Jorge Ruente und Mañuel Martin. Sie wurden über Bord gespült. Der Herr sei ihren armen Seelen gnädig.
Wir versuchen, weiterhin Nordkurs zu steuern. Eine Peilung ist noch unmöglich, aber ich glaube, wir liegen ungefähr auf der Höhe von Cabo de Espichel.“
26. Dezember 1598.
„Inzwischen ist Ruhe eingekehrt. Ein schwacher Wind aus wechselnden Richtungen hindert uns daran, gute Fahrt aufzunehmen. An Steuerbord liegt die Küste Galiciens, das ist weniger, als ich erhofft hatte. Santander anzulaufen, würde jetzt einen zusätzlichen Zeitverlust bedeuten. Ich bin mir nahezu sicher, daß unsere Schatzschiffe nach England verschleppt wurden. Wer außer diesen Ketzern könnte schon auf eine derart wahnwitzige Idee verfallen?
Die ‚Aguila‘ nimmt deshalb Kurs auf die Südwestspitze Englands. Ich muß eine Spur des Konvois finden, koste es, was es wolle.
Zur Hebung der Moral erhält die Mannschaft eine Sonderration Rum. Niemand soll mir nachsagen, wir hätten den Jahreswechsel nicht gebührend gefeiert.“
31. Dezember 1598.
Die folgenden Tage verliefen mehr oder weniger ereignislos. Ein Kälteeinbruch sorgte für leichten Schneefall, doch war die weiße Pracht jeweils bis zum Mittag wie weggewischt.
Vor Brest griffen drei Schaluppen an, aber die französischen Schnapphähne bissen sich an der „Aguila“ die Zähne aus. César Garcia schickte alle drei zu den Fischen. Danach besserte sich seine Laune ein wenig.
Stunden nach dem Gefecht meldete der Ausguck im Großmars Segel Steuerbord voraus.
Erneut wurde die „Aguila“ in Gefechtsbereitschaft versetzt. Sieben Galeonen näherten sich aus Östlicher Richtung.
„Engländer?“
„Sie führen keine Flaggen im Topp.“
Garcia dachte nicht daran, auf Ausweichkurs zu gehen. Er ließ die Kanonen ausrennen. Auf diese Weise gewappnet, konnte er den in Kiellinie segelnden Galeonen ruhig entgegensehen. Sofern ein Gefecht unvermeidbar war, stand er deshalb zunächst nur zwei Schiffen gegenüber. Bis die anderen aufschlossen, konnte die „Aguila“ wieder auf Distanz gehen.
„Batteriedeck, beide Batterien feuerbereit!“ erklang die Meldung.
„Kuhl feuerbereit!“
„Feuern nur auf meinen Befehl – oder falls wir angegriffen werden! Ausguck?“
„Unverändert, Capitán. Keine Flaggen.“
Ein wahnwitziger Gedanke durchzuckte Garcia. Er schob ihn sofort wieder weit von sich. Die sieben Galeonen hatten mit dem Konvoi sicher gar nichts zu tun.
„Achtung!“ brüllte der Ausguck. „Das Führungsschiff hißt Flagge!“
Die vorderste Galeone war inzwischen so weit heran, daß sie auch vom Achterdeck aus zu sehen war. Durchs Spektiv erkannte Garcia die Farben Spaniens.
„Es könnte eine Finte sein“, gab der Erste Offizier zu bedenken.
„Sparen Sie sich solche Bemerkungen, Molina!“ Der Kapitän reagierte gereizt. „Oder glauben Sie, ich wüßte das nicht selbst?“
„Doch, Capitán, natürlich. Verzeihen Sie.“
César Garcia hob das Spektiv wieder vors Auge. Noch konnte er kaum Einzelheiten erkennen, dafür war die Entfernung zu groß. Aber die Schiffe segelten aufeinander zu.
„Wenn es wirklich Spanier sind, verstehe ich, warum sie ihre Flagge erst jetzt zeigen. Immerhin haben sie englische Gewässer hinter sich.“
Der Kapitän schwieg. Nur seine Haltung verriet seine übergroße Anspannung.
„Es könnten durchaus spanische Galeonen sein“, sagte er nach einer Weile und fügte hinzu: „Schatzschiffe.“
Der Erste Offizier blickte ihn entgeistert an.
„Sehen Sie sich die Galion des Führungsschiffs an!“ forderte Garcia. „Außerdem die Heckgalerie und die Aufbauten im Bereich des Achterschiffs.“
Juarez Molina nahm den Kieker entgegen, den der Kapitän ihm reichte. Eine Weile blickte er hindurch, dann zuckte er mit den Schultern.
„Haben Sie das Schiff schon einmal gesehen?“ herrschte Garcia ihn an.
„Mein Gott, ja, vielleicht. Ich kann es nicht mit Gewißheit behaupten.“
„Viele Schiffe haben unverwechselbare Besonderheiten. In unserem Fall zum Beispiel die Galion, sie wurde nachträglich eingepaßt. Ab der Zurring ist die klare Linienführung unterbrochen, da war ein Zimmermann am Werk, der zu viele Schnitzereien angebracht hat. Für einen Teil der Heckgalerie gilt das gleiche.“
Molina nickte knapp. „Jetzt sehe ich es auch“, sagte er. „Das Schiff dürfte in der Tat unverwechselbar sein.“
„Es ist die ‚Salvador‘“, erklärte Garcia, „das Flaggschiff Don Ricardos.“
Dem Ersten blieb vor Überraschung die Spuke weg.
„Das – das ist der Konvoi?“ fragte er.
„Sie können es für Zufall halten – oder für Teufelswerk. Ich sage, es handelt sich um eine Fügung des Schicksals.“
Juarez Molina nickte stumm. Ungläubig starrte er zu der kleinen Flotte hinüber und fragte sich, was die Begegnung wohl zu bedeuten habe.
Garcia befahl ein Manöver, das die „Aguila“ auf Parallelkurs zur „Salvador“ brachte. Die Entfernung betrug danach noch knapp vierhundert Schritte. Die Geschütze blieben ausgerannt.
Während der weiteren Annäherung beobachtete der Kapitän selbst wieder durchs Spektiv. Er suchte Don Ricardos vertrautes Gesicht auf dem Achterdeck, aber er fand es nicht.
Endlich wurden von der „Salvador“ Signale gegeben.
„Wir gehen längsseits!“ bestimmte Garcia. „Aber Vorsicht, falls es sich doch um eine Falle handelt.“ Mittlerweile traute er englischen Piraten und Schnapphähnen so ziemlich alle nur erdenklichen Schandtaten zu, aber das behielt er lieber für sich.
Kurze Zeit später lagen beide Galeonen mit aufgegeiten Segeln nebeneinander. Der Kapitän erkannte einige der Männer auf der „Salvador“ wieder.
„Fragen Sie, warum Don Ricardo es nicht für nötig hält, uns zu begrüßen!“ forderte er den Ersten auf.
Molina brauchte nicht sonderlich laut zu rufen, um auf dem Achterdeck des Flaggschiffes verstanden zu werden.
„Der Generalkapitän ist tot“, lautete die unerwartete Antwort. „El Lobo del Mar hat ihn getötet.“
Der Seewolf?
Das war ein Ding der Unmöglichkeit, es sei denn, der englische Bastard beherrschte tatsächlich die Kunst, an mehreren Orten gleichzeitig zu erscheinen.
César Garcia befahl den neuen Kapitän der „Salvador“, den früheren Ersten Offizier Miguel Salcho, zu sich an Bord.
Salcho war schon immer ein pedantischer Klugscheißer mit Hang zur Kleinlichkeitskrämerei gewesen, aber diesmal hörte Garcia ihm zu, ohne ihn ein einziges Mal zu unterbrechen.
Er berichtete Einzelheiten, die dem Kapitän ein ungläubiges Kopfschütteln entlockten. Die Dreistigkeit, mit der die Engländer vorgegangen waren, ließ sich kaum überbieten.
Der Zweikampf zwischen diesem verfluchten Killigrew und Don Ricardo de Mauro y Avila war ein Kampf um die Ehre des Spaniers gewesen. Unnötig, wie Salcho behauptete, denn dann wäre Don Ricardo noch am Leben.
César Garcia fühlte sich, als hätte ihm jemand die Beine unter dem Leib weggezogen. Er hatte dem Seewolf also schon von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden, er hatte ihm sogar von seiner Absicht erzählt, el Lobo del Mar zu jagen und zur Strecke zu bringen.
Wenn das bekannt wurde, war ihm der Spott der Marine sicher. Daß niemand die Maske des falschen Don Julio de Vilches durchschaut hatte, spielte dabei nur eine untergeordnete Rolle – ebenso, daß in Cádiz der Leichnam irgendeines Piraten verbrannt worden war.
Nur mehr mit halbem Ohr hörte Garcia zu, als Miguel Salcho von der hervorragenden Behandlung seiner Männer in England berichtete. Der Seewolf hatte Wort gehalten und die Spanier nach dem Entladen ihrer Schiffe auf den Heimweg geschickt.
„Wo finde ich den Bastard?“
„Er ist noch in London“, sagte Salcho. „Nur eins seiner Schiffe segelte themseabwärts mit uns, nahm dann aber Kurs auf die Nordsee.“ Da es ihm offenbar nicht schwerfiel, Garcias düstere Gedankengänge nachzuvollziehen, fügte er hinzu: „Ich würde nicht versuchen, den Seewolf in seiner Heimat anzugreifen. Das wäre so, als springe jemand in haiverseuchtem Gewässer über Bord.“
„Señor Salcho hat recht“, sagte Juarez Molina. „Jeder Versuch, el Lobo del Mar unter diesen Umständen anzugreifen, würde tödlich enden.“
Langsam wandte sich der Capitán ihm zu. Er schien soeben aus einem langen Traum erwacht zu sein. Aber gleich darauf schweifte sein Blick wieder nach Norden ab, wo weit hinter der Kimm England verborgen lag.
„Kein Wolf bleibt lange in seiner Höhle“, sagte er. „Sobald er sich hervorwagt, haben wir ihn. Und wenn ich ihn bis ans Ende der Welt jagen müßte.“
Noch ahnte César Garcia nicht, welch tiefere Bedeutung diese Worte haben sollten.
„Ich warte auf dich, Bastard, und diesmal erwische ich nicht den Falschen.
Ich warte vor La Coruña, während die sieben Galeonen weiter nach Süden segeln. Keiner der Kapitäne wollte an meiner Seite kämpfen – sie sind Verräter, die den Strick verdienen. Auch wenn sie heute glauben, ihre Haut gerettet zu haben, ich vergesse nicht, daß sie mit ihrer Handlungsweise den Seewolf schützen. Spanien darf sich Gefühlsduseleien nicht erlauben.
Zur Hölle mit dem Engländer!“
Aus dem Logbuch der „Aguila“, Aufzeichnung des Kommandanten César Garcia vom 8. Januar 1599.
„Endlich!
Ich wußte, daß sich wochenlanges Warten auszahlt.
Fischer haben die Schebecke gesehen. Sie segelte nach Süden und wohl nur wenige Meilen an unserer Position vorbei. Vielleicht hätten wir den Dreimaster bei Tage sogar selbst entdeckt.“
Diese Eintragung wurde weder mit Datum noch mit Unterschrift versehen. Statt dessen prangte die Skizze eines Galgens unter dem Text.
6.
Monate später, vor der Nordwestküste Indiens.
„Jetzt geht das Scheißwetter schon wieder los“, fauchte Old Donegal Daniel O’Flynn wütend. Er deutete zu der im Süden heraufziehenden riesigen Wolkenbank, die im Licht der Mittagssonne hell erstrahlte. „Mein Bein zwackt.“
„Welches Bein?“ fragte Will Thorne wie beiläufig. Der Segelmacher hockte auf einer Luke und flickte ein Marssegel.
„Das rechte“, sagte Old Donegal.
Will sah von seiner Arbeit nur flüchtig auf. „Dann ist es ja gut“, bemerkt er. „Dann bleibt das Wetter vermutlich wie es ist.“
Nach Tagen endloser Wolkenbrüche lockte der momentane Sonnenschein selbst die Freiwache an Deck. Die Männer hockten einfach zwischen den Culverinen, einige standen auch am Schanzkleid und beobachteten die vorbeiziehende Küste. Die Vegetation hatte sich seit der Mündung des Tapti nicht verändert. Mangroven und dichter, dampfender Urwald waren vorherrschend.
„Nichts ist gut!“ polterte Old Donegal. „Und schön bleibt es schon gar nicht.“
Will Thorne nähte in aller Seelenruhe weiter.
„Dein Holzbein spürt also, wie das Wetter wird“, sagte er. „Vielleicht treibt es eines Tages sogar grüne Blätter und Wurzeln.“
„Es schlägt aus!“ zischte Old O’Flynn. „Und wenn du dich nicht vorsiehst, tritt es dich mit aller Kraft in den Hintern.“
Die Wolkenbank zog schnell näher. Schon färbte sich ihre Unterseite dunkel. Erste schwere Tropfen fielen.
Old Donegal stimmte das Meckern eines Ziegenbocks an. „Da bist du sprachlos, Will, was?“
„Auch ein blindes Huhn findet manchmal ein Korn, Donegal. War bestimmt sehr schwer, den Regen vorauszusagen, nachdem wir mindestens zwei Stunden Sonnenschein hatten.“
Old Donegal murmelte etwas, was sich anhörte wie „Banause“, und stieg den Niedergang zum Achterdeck hoch.
Hasard, Don Juan und Old Donegals Sohn, Dan O’Flynn, standen in der Nähe des Besanmastes. Die beiden schiffbrüchigen Spanier waren bei ihnen.
Sie redeten wie gute alte Bekannte miteinander. Indiens Schätze gaben ein schier unerschöpfliches Gesprächsthema ab. Blieb die Frage, wer wen auszuhorchen versuchte. Besonders viel schienen die Dons jedenfalls nicht über die Verhältnisse an Indiens Küste zu wissen.
„Warum gibt Spanien sich nicht mit dem zufrieden, was es aus der Neuen Welt herausquetscht?“ fragte Hasard geradeheraus. „Glaubt Philipp III., nun auch Indien ausplündern zu müssen?“
„Wir sind keine Piraten“, erwiderte der Knochenmann verdrossen.
Hasard nickte zustimmend.
„Das wäre auch hoffnungslos untertrieben“, sagte er.
Für einen Moment rang Pilar Aparicio um sein seelisches Gleichgewicht. Die Bemerkung hatte einen wunden Punkt getroffen.
„Wer in der Pulverkammer steht, sollte nicht mit dem Feuer spielen“, sagte er scharf. „Immerhin sind die Engländer ein Volk von Piraten.“ In seiner Erregung achtete er nicht darauf, was er sagte. Erst nachdem er den Satz ausgesprochen hatte, erschrak er über sich selbst. Prompt zuckte seine Rechte zum Dolch, aber keiner der Umstehenden traf Anstalten, Carmona und ihn anzugreifen.
„Das sind gewichtige Worte.“ Hasard verschränkte die Arme vor der Brust und blickte den Spanier herausfordernd an. „Ich nehme an, Señor, Sie haben Gründe für Ihre Erbitterung.“
„Heraus mit der Sprache, falls Sie das Gefühl haben, Schnapphähnen in die Hände gefallen zu sein!“ forderte Don Juan. „Wir ziehen niemanden aus dem Wasser, der nicht gerettet werden will.“
„Wollen Sie abstreiten, daß englische Schiffe unsere Schatzgaleonen kapern?“ fragte Julián Carmona.
„Wer so redet, sollte Roß und Reiter nennen“, sagte Dan O’Flynn.
„El Lobo del Mar, zum Beispiel“, entgegnete Carmona.
Dan sah Don Juan an, der bedachte Hasard mit einem erstaunten Augenaufschlag. Aber der Kapitän schürzte nur die Lippen und lächelte.
„Nie gehört“, versicherte er mit treuer Miene. „Wer ist das? Ein Engländer?“ Während er das sagte, beobachtete er Carmona und Aparicio.
Der Knochenmann zuckte unwillig mit den Mundwinkeln, sein Begleiter schien etwas erwidern zu wollen, unterließ dann aber doch jede Äußerung.
„Wir sind Ihnen dankbar, Capitán, daß Sie uns aufgefischt haben“, erklärte Julián Carmona. „Deshalb wollen wir keinen Streit.“
„Das ist eine durchaus kluge Einsicht. Sie würden nämlich den kürzeren ziehen.“ Dan konnte sich die Bemerkung nicht verkneifen.
Niemand hatte etwas dagegen einzuwenden, daß sich die Spanier auf das achtere Grätingsdeck zurückzogen. Manch mißtrauischer Blick galt ihnen, doch die beiden unterhielten sich nur und starrten im übrigen die meiste Zeit ins Wasser.
Der Regen wurde heftiger, die Küste verschwand hinter wehenden Wasserschleiern. Hasard war gezwungen, dichter unter Land zu gehen, wollte er die Bucht der Spanier nicht verfehlen. Das Ziel lag wohl nur noch wenige Meilen voraus.
Erst ließ er das Besansegel wegnehmen, um nicht in voller Fahrt auf möglicherweise der Küste vorgelagerte Untiefen aufzubrummen, dann schralte der Wind, das heißt, er fiel vorlicher ein und zwang die Schebecke, abzufallen.
Urplötzlich herrschte Flaute. Von einem Augenblick zum anderen hingen die Segel schlaff an den Rahruten. Nur der Regen plätscherte unvermindert heftig aus dem wolkenverhangenen Himmel nieder. Das Meer war von bleierner Schwärze.
„Ich werde verrückt“, sagte der Profos grollend. „Da oben treiben die Wolken mit einem Affenzahn dahin, und hier unten ist nicht der leiseste Hauch zu spüren.“
„Beschwer dich bei dem alten Mann mit dem dichten grauen Bart“, rief Batuti.
„Da brat mir einer ein Kielschwein!“ rief Carberry aus. „Was hat Shane mit dem Scheißwetter zu tun?“
„Wieso Shane?“ fragte der Gambiamann verdutzt.
„Weil du Hirsch das gesagt hast.“
„Ich habe den anderen Mann gemeint. Den da oben.“ Batuti deutete in die Höhe, wo wirbelnde Wolkenfetzen vorübergehend ein Stück blauen Himmels erkennen ließen.
„Bist du besoffen? Kein Mensch ist im Ausguck.“
Batuti stieß ein verzweifeltes Seufzen aus, der Profos stand händeringend da und schüttelte den Kopf, und Roger Brighton, der das Mißverständnis mitangehört hatte, sagte grinsend: „Der Mann heißt Petrus, alles klar?“
Batuti nickte eifrig. „Richtig“, bestätigte er. „Das ist der Wolkenschieber.“
Als hätte es nur dieser Feststellung bedurft, heulte eine erste Bö durch die Takelage und zerrte an den nassen Segeln. Schwer legte sich die Schebecke nach Backbord, schwang zurück und nahm wieder Fahrt auf.
Der Wind sprang hin und her, als könne er sich nicht entschließen, aus einer Richtung zu wehen. Während der nächsten Stunde standen die Segel selten prall, sie killten und schlugen häufig. Das einzige, was sich nicht veränderte, war der Regen. Er fiel nahezu senkrecht.
Die Küste wurde felsiger. An einigen Stellen sprang der Urwald weit zurück. Kleine Einschnitte und Buchten häuften sich, aber letztlich wucherten wieder Mangroven am Wasser.
„Esperanza liegt vor uns“, verkündete Julián Carmona, der endlich das Grätingsdeck verließ und nach vorn ging.
Eine schmale Einfahrt öffnete sich vor der Schebecke. Die vorspringende Landzunge war dicht bewaldet. Palmen ragten auf, aber vor allem Mangroven bildeten mit ihren verfilzten Stelzwurzeln ein unüberschaubares Dickicht.
Die Sicht war schlecht und wurde durch kleine, dicht bewachsene Inseln zusätzlich behindert.
„Einige Fahrrinnen sind versandet“, sagte Carmona. „Halten Sie sich nach Backbord, Capitán Killigrew.“
„Muß ich loten lassen?“
„Hier nicht.“
„Sir!“ Dan O’Flynn hastete von der Kuhl aus den Niedergang zum Achterdeck hinauf. „Kann ich dich kurz sprechen?“
„Ist es wichtig?“
Dan warf dem Spanier einen forschenden Blick zu. „Unter vier Augen“, sagte er. „Ich habe da ein Problem.“
„Entschuldigen Sie mich.“ Der Seewolf wandte sich von der Balustrade ab und ging zu Dan.
Obwohl sich Julián Carmona Mühe gab, unbeteiligt zu erscheinen, lauerte er offensichtlich darauf, wenigstens einige Gesprächsfetzen zu erhaschen.
„Wieviel Englisch versteht der Bursche?“
„Willst du mich nur das fragen?“
Dan schüttelte den Kopf. Er zog den Kapitän mit sich, zur Kuhl hinunter.
„Ich habe nachgedacht“, eröffnete er dann. „Über den Spanier und seine Bemerkung über el Lobo del Mar …“
„Wir sind eben bekannt wie bunte Hunde.“
„Ich glaube nicht an einen Zufall, Sir. Nicht mehr nach der Geschichte, die uns die Dons aufgetischt haben. Ich behaupte sogar, es hat nie eine ‚El Cobayo‘ gegeben, die von Portus versenkt wurde.“
„Bist du sicher?“
„Die Tranfunzel gibt mir zu denken – schon der dumme Zufall, daß sie in einem Faß gelegen haben soll. Aber nicht nur das. Wer die Portugiesen fürchtet, zündet nachts keine Lampe an. Wozu auch? Das wäre nur nötig gewesen, wenn die beiden Kerle es darauf anlegten, aufgefischt zu werden, und zwar von uns. Frag mich nicht, warum oder woher die Dons überhaupt wissen konnten, daß wir ihnen über den Weg laufen.“
Hasard wandte sich flüchtig zum Achterdeck um. Julián Carmona lehnte inzwischen am Schanzkleid und betrachtete das langsam vorbeiziehende grüne Dickicht.
„Sag den Männern Bescheid! Ich will Ed und noch ein paar auf dem Achterdeck haben. Für die anderen gilt: Klarschiff zum Gefecht!“
„Aye, Sir!“
Hasard kehrte an seinen Platz vor dem Besanmast zurück.
„Schlechte Neuigkeiten?“ wurde er von Carmona empfangen.
„Wie man’s nimmt. Jedenfalls nicht von großer Bedeutung.“
Urplötzlich erklang ein mehrstimmiger Ausruf von der Kuhl: „Schiff Backbord querab!“
7.
„El Lobo del Mar steht mit dem Teufel im Bund, eine andere Erklärung gibt es nicht. Aus dem Großmars waren schon die Mastspitzen der Schebecke und eines zweiten Schiffes, wahrscheinlich der ‚Isabella‘ zu sehen, aber dann trennten sie sich. Die schlanke Galeone fiel nach Westen ab und kehrte vermutlich in die Karibik zurück.
Die Schebecke blieb auf Südkurs. Einen halben Tag lang folgten wir ihr, und zu Beginn der Nacht sahen wir den Schein ihrer Hecklaterne. Aber im Morgengrauen war sie verschwunden. Da der Wind konstant weht, gibt es keinen Grund zur Annahme, der Seewolf hätte den Kurs geändert. Eher ist es wohl so, daß der Teufel seine Segel bläht.“
Aus dem Logbuch der „Aguila“, Aufzeichnung des Kommandanten César Garcia vom 21. Januar 1599.
„Keine Spur von el Lobo und seiner Schebecke. Wir verlieren kostbare Zeit, aber ich muß sichergehen, daß der Bastard nicht die Straße von Gibraltar ins Mittelmeer durchquert hat.
Juarez Molina bedrängte mich, Cádiz anzulaufen und von Admiral Mendez Verstärkung anzufordern. Er hat noch immer nicht begriffen.
Die Schebecke wurde nicht vor Tarifa gesehen. Also segelt der Seewolf weiter nach Süden. Ich weiß nicht, was er plant, aber ich weiß, daß ich ihn stellen werde.“
26. Januar 1599.
„Seit fünf Wochen kreuzen wir zwischen Marokko und Mauretanien, doch die Schebecke ist und bleibt verschwunden. Niemand weiß etwas, keiner hat das auffällige Schiff gesehen.