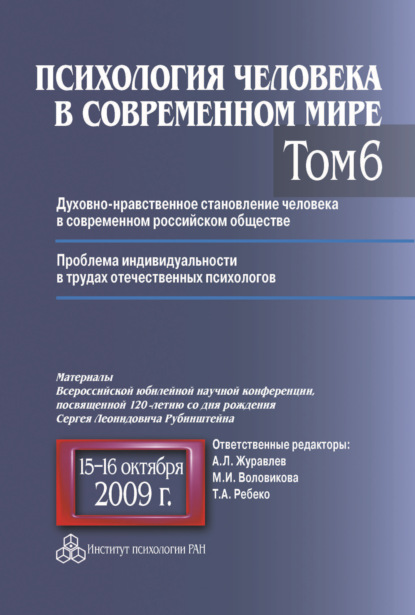Seewölfe Paket 34

- -
- 100%
- +
Sie waren am Heck angelangt und hielten sich fest. Jung Hasard leuchtete mit der Laterne auf das Ruder. Er schraubte den Docht so hoch, bis es entsetzlich nach Lampenöl stank. Aber wenigstens konnten sie auf diese Weise etwas erkennen.
„Das war der Schlag, den der Rudergänger verspürt hat“, sagte Ferris nach einem kurzen Blick. „Genau hier hat die Kugel das Ruder gestreift. Der Schaft hat etwas abgekriegt, aber nicht wesentlich.“
Ferris ließ die Lampe noch höher und dichter halten. „Weiter unten sieht es etwas schlechter aus.“
Er zeigte dem Exschmied von Arwenack die Stelle. Shane, der ohnehin kein Freund von großen Worten war, nickte bedächtig.
„Hätte schlimmer sein können. Wir haben noch mal Glück gehabt. Vier Fingerlinge und vier Ruderösen sind hinüber.“
„Und im Blatt fehlt ein kleines Stück vom oberen Teil“, setzte Ferris hinzu. „Aber das kann man später einflicken. Die Ösen und Fingerlinge sind wichtiger. Wir müssen ein paar neue anfertigen. So, wie es jetzt steht, läßt sich das Schiff nur sehr schwer manövrieren. Außerdem besteht die Gefahr, daß noch mehr bricht.“
Die Stellen wurden genau begutachtet.
Von oben erklang Hasards Stimme. „Wie sieht es aus?“
Ferris sagte es ihm. Die nächste Frage lautete, wie lange die Reparatur dauern würde.
„Vier bis fünf Stunden mindestens. Wir müssen neue Ösen und Fingerlinge anfertigen. Aber wir gehen gleich an die Arbeit. Anschließend kümmern wir uns um den Fockmast, Sir.“
„Sehr gut. Jeder wird mithelfen, damit wir wieder seetüchtig sind.“
„Die Sache hat nur einen kleinen Haken“, wandte Ferris ein. „Wir müssen ein Stück achteraus verholen, bis wir auf den Mangrovenwurzeln sitzen, sonst können wir an das Ruder nicht heran. Das dürfte mit einigen Schwierigkeiten verbunden sein. Und es kostet uns ebenfalls noch etliches an Zeit.“
Von oben war ein unterdrückter Fluch zu hören.
„Gut, das schaffen wir schon“, sagte der Seewolf. „Solange der Wind nicht bläst, können die anderen die Bucht ebenfalls nicht verlassen, und das ist unser Vorteil. Wir holen inzwischen das zerschossene Segel ein.“
Die Schritte entfernten sich. Ferris leuchtete noch einmal genau alles ab. Er war ein gründlicher und gewissenhafter Mann. Manche wurden ungeduldig, wenn er so gründlich und schon fast pedantisch vorging, aber der Zimmermann hatte auch ein dickes Fell. Er war nicht eher zufrieden, bis er genau wußte, wo er ansetzen mußte. Letztlich war es ihnen bisher allen zugute gekommen.
Neben der Jolle war ein leises Platschen zu vernehmen.
Philip fuhr herum und leuchtete auf die Wasseroberfläche. Aber da waren nur Nebelschwaden zu sehen.
„Gibt’s hier Krokodile?“ fragte er leise.
„Kann schon sein“, erwiderte Ferris. „Ich habe zwar noch keine gesehen, aber wir sollten vorsichtig sein.“
Die Aussicht, daß es an den Ufern des Tapti Krokodile geben könnte, war nicht gerade ermunternd. Immerhin mußten sie achtern das Schiff so weit in die Mangroven setzen, daß sie von den hohen Stelzwurzeln aus arbeiten konnten. Wenn da Krokodile lauerten, würde das die Arbeit erheblich behindern.
„Fertig“, sagte Ferris. „Kehren wir um und holen das Zeug, das wir brauchen.“
Hasard stellte die beiden Laternen auf die Ducht und wollte gerade Platz nehmen, als sein Blick erstarrte. Wie gebannt blickte er auf das Dollbord der Jolle.
Dort tat sich etwas, das nicht mit rechten Dingen zuging.
Philip folgte dem Blick seines Bruders und hielt ebenfalls unwillkürlich die Luft an. Nur Ferris und Shane hatten noch nichts bemerkt.
Eine dunkle, triefende Hand schob sich wie der Arm einer Leiche aus dem unsichtbaren Wasser und umfaßte das Dollbord.
Die Jolle schwankte ein wenig, und jetzt fuhren auch Ferris und Shane herum und starrten auf die triefende Hand. Eine zweite tauchte aus der Finsternis auf und griff ebenfalls nach dem Dollbord.
Ein Kopf schob sich blubbernd aus dem Wasser und wurde erst dann sichtbar, als er auf gleicher Höhe mit dem Dollbord war.
Jung Hasard wollte gerade zuschlagen, als er im schwachen Widerschein der Laternen das Gesicht erkannte.
Der unheimliche Geist aus der Tiefe war kein anderer als Don Juan, den der schwache Lichtschein angelockt hatte. Für ihn war es in der Bucht die einzige Orientierungsmöglichkeit gewesen.
Er spie einen Strahl Wasser aus und grinste. Die Männer halfen ihm in die Jolle.
„Wollte euch nicht erschrecken“, sagte er und wischte sich das Wasser aus dem Gesicht. Von seinen Haaren tropfte es, und aus seinem Hemd lief ein regelrechter Sturzbach, als er auf der Ducht saß.
„Mann, habe ich einen Schreck gekriegt!“ sagte Hasard. „Du bist hier aufgetaucht wie ein Geist – wie ein Wassermann, würde Granddad jetzt wohl sagen. Der hätte dir wahrscheinlich gleich eins mit dem Riemen über den Schädel gezogen. Du mußt ganz durchgefroren sein.“
„Im Gegenteil, das Wasser ist fast lauwarm.“
„Erzähle mal“, sagte Ferris erleichtert. „Hast du was erreicht?“
„Ich berichte gleich, sobald wir an Bord sind. Dann können es alle hören.“
„Wir wollten gerade zurück. Daß du uns gefunden hast, grenzt fast an ein Wunder“, sagte Shane anerkennend. „Du hast doch überhaupt nichts gesehen.“
„Nicht viel“, gab der Spanier zu. „Eigentlich so gut wie gar nichts. Aber dann entdeckte ich plötzlich den schwachen Lichtschein und hielt darauf zu.“
Sie zogen sich mit der Jolle wieder am Rumpf entlang und enterten auf.
Inzwischen hatten die anderen Arwenacks mitgekriegt, daß Don Juan wieder zurück war.
Hasard nahm ihn gleich in Empfang. Will Thorne brachte sofort ein paar trockene Klamotten, doch der Spanier wehrte dankend ab.
„Ihr seid doch auch alle klatschnaß“, sagte er. „Wir unterscheiden uns also nicht voneinander.“
„Zieh das trotzdem an, Juan“, sagte Will Thorne. „Du wirst dich gleich etwas wohler fühlen.“
Der Kutscher brachte eine Buddel und goß eine Muck voll, die er Juan reichte. Sie waren alle sehr besorgt um ihn.
Auch der Profos, der jedoch sofort monierte, daß er ebenfalls klatschnaß sei, und wegen der Gerechtigkeit soll doch lieber jeder auch gleich vorsorglich einen kleinen Schluck nehmen. Wegen der Erkältung natürlich und so.
Das wurde von Hasard akzeptiert, und so war die Buddel auch schnell gelenzt.
„Warst du an Bord?“ fragte Hasard gespannt.
„Ja, es ging völlig problemlos. Kein Mensch hat mich erkannt oder gar zur Kenntnis genommen. Einer sah den anderen nur als Schatten.“
„Trotzdem war es verdammt riskant.“
„Keine Sorge. Ich konnte mich ins Batteriedeck schleichen, und es gelang mir auch, vier Culverinen so zu präparieren, daß sie Garcia und seinen Leuten um die Ohren geflogen sein dürften. Ich nahm mehr als die doppelte Pulvermenge. Unterwegs hörte ich einmal ein entsetzliches Krachen, konnte jedoch nichts sehen. Ich nehme aber an, daß zwei Rohre krepiert sind. Garcia hatte einen Anschlag auf uns vor. Er bemannte eine Jolle und schickte sie in die Richtung, in der er unser Schiff vermutete. Wir nahmen zwei Drehbassen mit und sollten aus allernächster Distanz auf die Schebecke feuern.“
„Wir?“ fragte Hasard irritiert.
„Ja, wir“, bestätigte Don Juan bescheiden. „Ich war natürlich auch mit an Bord.“
Der Seewolf pfiff leise durch die Zähne. Sie sahen ihn grinsen.
„Nun, wir suchten natürlich alles ab, aber der Stückmeister hatte sich in dem Nebel wohl völlig verirrt, und so fanden wir die Schebecke nicht. Soll ja vorkommen im Nebel.“
Die anderen Arwenacks grinsten jetzt ebenfalls. Sie stellten sich den Wolf mitten unter den Schafen vor, und niemand hatte ihn erkannt.
„Und dann?“ fragte Hasard weiter.
„Na, dann nahm ich eine Axt, die ich schon an Bord der ‚Aguila‘ gefunden hatte, und hackte den lieben Dons die Planken durch, während sie mitten in der Bucht waren. Es war ein grandioses Schauspiel, als die Jolle absoff und immer noch keiner wußte, was denn eigentlich passiert war. Ich habe mich wirklich köstlich amüsiert. Sie nahmen wohl an, die Schebecke habe gefeuert. Sie dürften sich auch gewundert haben, daß nur sieben Mann zurückkehrten, obwohl acht losgepullt waren. Ich denke, das wird Garcia ein fast unlösbares Rätsel aufgeben.“
Hasard lachte laut los. Die Arwenacks stimmten in das Lachen ein und konnten sich kaum beruhigen.
„Und keiner hat was gemerkt?“ fragte Hasard ungläubig.
„Nein, niemand. Der Nebel war so dicht, daß man die Hand nicht vor den Augen sah. Die Kerle üben sich immer noch im Phantomschießen und wissen nicht mal, daß wir längst verschwunden sind. Sie feuern in regelmäßigen Abständen, in der irrsinnigen Hoffnung, doch noch einen Zufallstreffer anzubringen.“
„Das ist ein ganz dicker Hund“, sagte Matt Davis. „Da wäre ich gern dabeigewesenen.“
„Zu zweit hätten wir auch nicht mehr ausrichten können und wären nur aufgefallen“, sagte der Spanier.
Wie zur Bestätigung von Juans Worten ging das Phantomschießen in der anderen Bucht plötzlich wieder los.
Der Nebel dämpfte die Geräusche zwar erheblich und verzerrte sie so, daß sich die Richtung nicht bestimmen ließ, aber Hasard und die anderen glaubten deutlich herauszuhören, daß der Krach wesentlich lauter war. Sie konnten sich das aber auch nur einbilden.
„Dann beginnen wir jetzt mit der Arbeit“, sagte Hasard. „Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren.“
6.
César Garcia konnte es drehen und wenden, wie er wollte. Er fand keinen „Schuldigen“, so sehr er sich auch bemühte, Licht in das geheimnisvolle Dunkel zu bringen. Seine Laune war dementsprechend auf einen absoluten Tiefpunkt gesunken.
Zudem erhielt er zu später Stunde noch Besuch von Francis Ruthland, der zusammen mit seinem Kumpan Lefray von der „Ghost“ herübergepullt war.
„Was will der Kerl?“ fragte Garcia mißmutig seinen Ersten. „Herumschnüffeln, was hier passiert ist?“
„Er wird neugierig sein.“
Garcia mochte Ruthland nicht sonderlich, aber sie hatten sich aus dem Grund zusammengetan, um den Seewolf zur Strecke zu bringen. Jeder hatte allerdings ein anderes Motiv. War es bei dem Spanier reiner Haß, so attackierte Ruthland den Seewolf aus kommerziellen Gründen. Er sah in ihm einen lästigen Konkurrenten, der ihm die dicksten Brocken vor der Nase wegschnappen würde.
Ruthland wiederum verstand nicht, daß ein Mann wie Garcia ausschließlich vom Haß getrieben wurde. Dabei sprang nichts heraus, es brachte keinerlei Vorteile, und es war auch kein Geld dabei zu verdienen. Aber Garcia hatte das größere und stärker armierte Schiff. Zusammen konnten sie es schaffen, den Seewolf aus dem Weg zu räumen.
Ziemlich ungnädig empfing der spanische Capitán die beiden ungleichen Männer in seiner Kammer.
Die beiden nahmen unaufgefordert Platz.
Garcia musterte den massigen und schweren Ruthland ein paar Augenblicke und sah in helle Fischaugen. Unter dem linken Auge hatte er eine Narbe, die im Schein der Laterne ständig zu zucken schien. Mit dem sauber gestutzten Bart sah Ruthland ja noch einigermaßen annehmbar aus.
Wenn Garcia jedoch zu dem anderen Kerl blickte, dann schluckte er jedes Mal hart. Hugh Lefray erinnerte ihn ständig an einen bösartigen Dämon. Schuld daran war das blinde, rechte Auge. Der Augapfel war weißlich, ohne die Spur einer Pupille, und das verlieh ihm sein unheimliches Aussehen.
Wenn dieses Ungeheuer dann auch noch grinste, rann Garcia ein kalter Schauer über den Rücken.
„Was gibt es?“ fragte der Spanier kurz.
„Das wollte ich Sie fragen“, erwiderte der Engländer. „Wir haben fürchterliches Geschrei und entsetzliches Krachen gehört, aber wir konnten uns das nicht zusammenreimen. Stimmt’s, Hugh?“
„Stimmt“, sagte Lefray einsilbig. Er blickte hoch und sah Garcia an, dem dieser Blick äußerst tückisch erschien.
„Zwei Kanonenrohre sind krepiert“, sagte Garcia. „Dabei wurden ein paar Männer getötet. Ist das alles, was Sie wissen wollten?“
„Tut mir leid, Capitán. Aber man sollte mit der Bemessung der Pulverladungen sehr vorsichtig sein.“
„Erzählen Sie das Ihrer Großmutter, aber nicht mir“, schnaubte der Spanier. „Ich bin mit Kanonen großgeworden und aufgewachsen. Hier war einwandfrei Sabotage im Spiel.“
„Sabotage? Einer Ihrer Leute?“
„Ich weiß es nicht. Ich habe auch eine Jolle zur Schebecke hinübergeschickt. Sie ist auf recht mysteriöse Art und Weise gesunken. Niemand kann sich erklären, wie das passiert ist.“
„Das war sehr leichtsinnig“, sagte Ruthland tadelnd. „Wenn die Jolle unterwegs war und wir gerade dann gefeuert hätten, wäre ein Unglück passiert. Wir sollten derlei Aktionen miteinander absprechen, Capitán. Das soll kein Vorwurf sein. Ich bin aber aus einem anderen Grund hier. Wir vermuten, daß die Schebecke den Standort gewechselt hat. Sie scheint nicht mehr an derselben Stelle zu liegen.“
„Und das vermuten Sie so einfach?“ fragte Garcia höhnisch.
„Ich habe zwei Mann in einer Jolle kreuz und quer durch die Bucht geschickt, aber sie haben die Bastarde nicht gefunden.“
Garcia lachte stoßartig auf.
„Wir sollten derlei Aktionen miteinander absprechen!“ zitierte er Ruthland. „Denn auch wir feuern in unregelmäßigen Abständen, und dabei hätte es leicht das Leben Ihrer Leute kosten können. Sie werfen mir quasi vor, unüberlegt zu handeln, und verhalten sich nicht anders. Ist das Ihre ganze Logik?“
Ruthland ließ sich nicht anmerken, daß er sich ärgerte. Er sah Garcia an, den im Dienst ergrauten Capitán Ende der Vierzig, wie er kleinwüchsig und verhärmt dahockte und den Kopf zwischen die Schultern zog. Wie ein kleiner Geier saß er da, der auf Aas lauerte. Aber der Spanier war ein harter, unbeugsamer Mann, an Bord seines Schiffes als Tyrann verschrien und gefürchtet.
„Nun gut, lassen wir das. Wir haben ein gemeinsames Ziel vor Augen. Für mich steht fest, daß der Seewolf mit seinem Schiff verschwunden ist. Allerdings kann ich mir nicht erklären, wie er aus der Bucht gesegelt ist. Es geht kein Wind, und sehen kann er ebensowenig wie wir.“
Garcia stand langsam auf und ging vor dem Tisch auf und ab.
„Wenn es stimmt, daß er wirklich verschwunden ist, gibt es dafür eine einfache Erklärung“, sagte er nachdenklich. „Im Gegensatz zu meiner Galeone und Ihrer Karavelle kann eine Schebecke gerudert werden. Die Kerle haben Riemen an Deck gebracht und sind lautlos aus der Bucht gerudert. Das ist ein guter Vorteil für sie.“
„Aber ihr Ruder ist beschädigt, das weiß ich genau. Sie hatten erhebliche Schwierigkeiten damit. Wenn sie auf dem Tapti von der Strömung erfaßt werden, sind sie hilflos. Sie sehen auch das Ufer nicht.“
„Sie haben wohl noch nicht gemerkt, daß wir es mit ausgefuchsten Bastarden zu tun haben, mein Lieber. Das nennt man taktischen Rückzug. Zum einen ist die Strömung nicht so stark, und außerdem können sie mit den Riemen manövrieren. Versetzen Sie sich doch mal in die Lage von Killigrew. Was würden Sie denn jetzt tun?“
„Ich würde den Tapti hinunterrudern und verschwinden.“
„Das sähe Ihnen ähnlich. Der Seewolf handelt ganz anders. Der verschwindet nicht mit einem angeschossenen Ruder. Ich werde Ihnen sagen, was er vorhat.“
„Wie wollen Sie die Gedanken eines anderen Menschen kennen?“ fragte Lefray hämisch.
„Indem ich versuche, mich in meinen Gegner hineinzudenken. Aber diese Art dürfte Ihnen vermutlich völlig fremd sein.“
Lefray zuckte zusammen.
„Na, dann lassen Sie mal hören“, entgegnete er bissig.
„El Lobo rudert auf den Tapti und läßt sich dort langsam flußabwärts treiben“, erklärte Garcia. „Er kennt die Strecke ebenso gut oder schlecht wie wir auch. Er wird die nächste Bucht auf der anderen Seite anlaufen und dort unverzüglich mit der Reparatur beginnen. So gut glaube ich ihn zu kennen. Sobald sein Schiff wieder in Ordnung ist, wird er uns angreifen. Wir werden auf der Hut sein müssen. Er ist nicht der Mann, der eine Schlappe auf sich sitzen läßt. Es besteht demnach die Möglichkeit, daß er hier wieder auftaucht und aus dem schützenden Nebel heraus angreift. Er wird das ganz überraschend tun.“
„Vielleicht war er schon hier“, sagte Ruthland hinterhältig grinsend, „und Sie haben es nicht bemerkt.“
„Sie sind ja verrückt!“
„Sagten Sie vorhin nicht etwas von Sabotage und von einem mysteriösen Untergang der Jolle, den Sie sich nicht erklären können? Möglicherweise war einer der Bastarde unerkannt bei Ihnen an Bord und hat ein bißchen manipuliert. Bei dem Nebel, in dem einer den anderen nicht sieht, wäre das kaum aufgefallen.“
Garcia starrte den Engländer an, als sähe er ihn zum erstenmal. Seine Unterlippe begann zu zittern, der Blick seiner Augen wurde kalt und bösartig.
Das ist natürlich die Erklärung, dachte er, und er spürte, wie es ihm eiskalt durch die Adern rann. Aber das wollte und konnte er vor Ruthland nicht zugeben, ohne sich bis auf die Knochen zu blamieren. Er schluckte heftig und nahm wieder Platz.
Einer der Bastarde bei ihm an Bord! Das war einfach unvorstellbar, aber nicht unmöglich. Es schüttelte ihn richtig.
„Ist Ihnen nicht gut?“ fragte Ruthland, dem die Reaktion des Spaniers nicht entgangen war.
„Es ist der Haß, der mich zittern läßt“, sagte Garcia gallig. „Ich darf gar nicht an diesen Bastard denken, ohne gleich aus der Haut zu fahren. Aber was Sie da eben andeuteten, ist natürlich Quatsch. Bei uns hat sich niemand an Bord eingeschlichen. Meine Leute sind gut gedrillt und arbeiten Hand in Hand. Ein Fremder wäre selbst bei dichtestem Nebel sofort aufgefallen.“
„Dann wird sich das Rätsel ja wohl bald aufklären“, sagte Ruthland gleichgültig. „Ich wollte Ihnen nur mitteilen, daß der Nebel innerhalb der Bucht langsam zerfließt. Vor der Siedlung steht eine dichte, aufquellende Wolkenbank. Weiter vorn zerfasert der Nebel, und es gibt hellere Flecken. Ich nehme an, daß er sich im Laufe der Nacht ganz auflösen wird. Was gedenken Sie dann zu tun, um Killigrew zuvorzukommen? Wir sollten das beizeiten absprechen.“
„Gar nichts gedenke ich zu tun, gar nichts. Ich werde nur scharf aufpassen, daß sich uns niemand nähert.“
„Sie wollen die Hände in den Schoß legen?“ fragte Ruthland ungläubig.
„Soll ich vielleicht meine Leute vor die Segel stellen und in sie hineinblasen lassen?“ brauste Garcia auf. „Ohne Wind sind wir hilflos und können uns nicht rühren. An was dachten Sie denn?“
„Ich dachte daran, daß wir ein paar Jollen vor die Galeone spannen und sie aus der Bucht pullen.“
„Sie haben offenbar noch nie eine Galeone gesegelt, Mister, sonst hätten Sie diesen lächerlichen Vorschlag gar nicht erst vorgebracht. Wollen Sie ein Kriegsschiff flußaufwärts pullen und es trotzdem kampfbereit halten? Das ist absurd! Über diesen Vorschlag erübrigt sich jede weitere Diskussion. Wir warten auf Wind, und wenn wir den haben, greifen wir an.“
„Dazu müßte man erst mal wissen, in welcher Bucht Killigrew zu liegen geruht. Weiter flußaufwärts gibt es unzählige kleine Buchten.“
Sie standen sich wie Kampfhähne gegenüber und starrten sich an.
Garcia hielt den Engländer für einen lausigen Handelsfahrer, der keine Ahnung von seemännischer Kriegsführung hatte.
„El Lobo ist nicht flußaufwärts gegangen“, erklärte er. „Der liegt in der nächstbesten Bucht, wie ich vorhin schon sagte. Er hat keine Zeit zu verlieren und rudert daher nicht umständlich flußaufwärts. Sie dürfen diesen Mann nicht unterschätzen, der verschenkt keine einzige Stunde unnötig, wenn er in Bedrängnis ist.“
Ruthland wollte gerade zu einer scharfen Erwiderung ansetzen, als es deutlich hörbar über ihren Köpfen knarrte.
„Wind“, sagte Lefray andächtig. „Es kommt Wind auf. Ein Luftzug ist durch die Takelage gefahren.“
Garcia stand kommentarlos auf und ging nach oben. Er sah sich nicht mal um, ob die beiden Männer ihm folgten.
An Deck prallte er fast mit dem Ersten Offizier zusammen.
„Ich wollte Ihnen gerade Meldung erstatten, Capitán“, sagte Molina. „Der Nebel löst sich langsam auf. Man kann bereits vereinzelt Sterne und ein Stück der Mondsichel erkennen. Weiter vorn lichtet sich der Nebel ebenfalls.“
Garcia gab keine Antwort. Er starrte in die Nebelschwaden und warf einen Blick zum Himmel. Tatsächlich sah er ein paar Sterne funkeln. Nur über dem Fluß hing der Nebel zäh wie weißlicher Brei. In der Bucht aber gab es bereits ein paar dünne Stellen.
Der Luftzug war kaum spürbar, doch er wiederholte sich nach einer Weile. Diesmal war er etwas stärker und ließ die Pardunen leise summen.
Für Garcia war das Musik, eine liebliche Melodie, die der Wind da flötete. Er beobachtete, wie ein Luftzug schwallartig einen Nebelhaufen auflöste. Lange, weiße Fahnen wehten davon, riesigen Leichentüchern nicht unähnlich, die aus feuchten Gräbern flatterten.
Ein dünnes Lächeln umspielte seine Lippen. Es war noch finster, aber ihm erschien es, als sei jetzt heller Tag. In der Finsternis konnte man wenigstens etwas wahrnehmen, im dichten Nebel war das unmöglich. Die Sterne waren es, die einen schwachen Abglanz zur Erde warfen, und in diesem schwachen Licht ließen sich Einzelheiten erkennen.
„Dann geht es ja wohl bald los“, raunte Ruthland und rieb sich die Hände.
Garcias schlechte Laune war wie weggeblasen.
„Ja, jetzt geht es bald los“, sagte er fanatisch. „Jetzt werde ich den Mann zur Strecke bringen, den ich um die halbe Erde gejagt habe. Er wird uns nicht mehr entwischen. Ich schlage vor, Sie lassen eine kleine Jolle besetzen und schicken sie auf den Fluß. Die Männer sollen erkunden, wo El Lobo steckt. Ich gehe immer noch davon aus, daß er in der angegebenen Bucht liegt. Wenn wir die Bestätigung haben, und der Wind noch etwas auffrischt, segeln wir los. Die Kerle sollen auch genau die Beschaffenheit der Bucht erkunden. Das ist wichtig für unseren Angriff. Wenn wir die Szene kennen, können wir entsprechend handeln. Bis die Männer wieder zurück sind, haben wir vermutlich soviel Wind, wie wir brauchen.“
„Sie haben mehr Männer, Capitán“, sagte Ruthland. „Wäre es da nicht besser, einige von Ihren …“
„Nein, ich brauche alle Leute auf den Gefechtsstationen. Schließlich sind wir das kampfkräftigere Schiff. Also los, auf was warten Sie denn noch, zum Teufel?“
Ruthland konnte es nicht ausstehen, Befehle zu empfangen, noch dazu von einem Spanier, der sich etwas hochnäsig und in jedem Fall sehr überlegen gab. Erst wollte er aufbrausen und sich den Ton verbitten, doch schließlich kuschte er widerwillig. Garcia hatte das bessere Argument zur Hand und ließ sich auf keine Diskussion ein.
„Na schön, wie Euer Majestät befehlen“, sagte er frostig. „Los, Hugh, pullen wir zurück!“
Ziemlich verbiestert verließen sie das Schiff und enterten in ihre Jolle ab, um zur „Ghost“ zu pullen.
Garcia sah ihnen nach, wie sie im schwächer werdenden Nebel langsam zu Schemen zerflossen.
„Dieser Engländer ist ein Idiot“, sagte er zu Molina. „Und dieser andere Compadre erinnert mich an einen wandelnden Leichnam. Ohne uns wären diese Kerle fängst ausgekniffen und hätten den Schwanz eingezogen. Sie sind großmäulig, haben aber Angst, allein gegen El Lobo anzutreten.“
„Brauchen wir Ruthland eigentlich unbedingt?“ fragte der Erste. „Ich kann die Burschen auch nicht ausstehen.“
„Wir haben einen übermächtigen, listenreichen und harten Gegner vor uns“, sagte Garcia belehrend. „Da kann man nicht so wählerisch sein. Wenn El Lobo gegen zwei Schiffe kämpft, hat er die schlechteren Karten, und wir sind im Vorteil. Außerdem betrachte ich diesen Kerl eher als Kanonenfutter. Sobald ich den englischen Bastard habe, kann sich Ruthland zum Teufel scheren.“
Etwas später sahen sie, wie drüben zwei Mann in einer kleinen Jolle lospullten und im Nebel verschwanden.
Sie sahen aber noch mehr. Der Platz, wo die Schebecke des Seewolfs gelegen hatte, war verwaist. Dort tummelten sich nur ein paar Nebelfetzen auf dem Wasser, drumherum war alles pechschwarz.
„Der Bastard ist tatsächlich weg“, murmelte der Erste. „Ganz so, wie Sie vermutet haben, Capitán.“
„Reine Logik“, erklärte Garcia überheblich. „Man muß nur die richtigen Schlüsse ziehen, und genau das habe ich getan.“
Er erwartete eine bewundernde Antwort, doch die blieb aus. Der Erste räusperte sich nur verhalten.