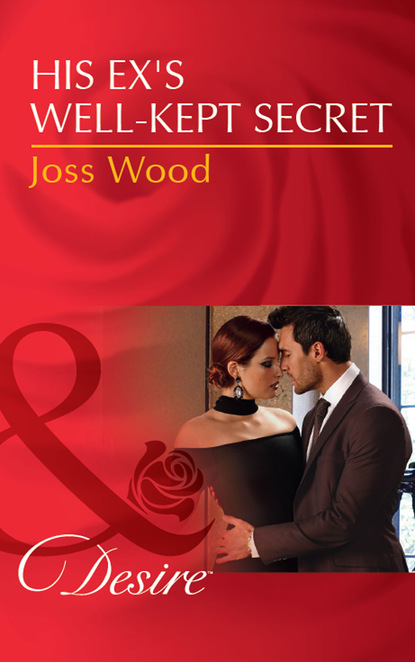Seewölfe Paket 34

- -
- 100%
- +
„Zum letzten Mal! Legt die Waffen nieder!“ Die Stimme de Pereiras überschlug sich fast.
Doch der Kreis um ihn und seinen Offizier wurde immer enger. Sein Degen nutzte ihm ebensowenig wie Cegos die Pistole, deren Hahn er in der Aufregung nicht mal gespannt hatte. Die Übermacht war zu groß, und die Männer schienen zu allem entschlossen zu sein.
„Man wird euch wegen Meuterei hängen, wenn ihr nicht Vernunft annehmt!“ Zum ersten Male verriet de Pereiras Stimme, daß er Angst hatte.
Bei Cegos hingegen war sie offenkundig. Seine Augen waren weit aufgerissen, die Hand, die die Pistole hielt, zitterte wie Espenlaub.
Jorge Alameda, der hochgewachsene, kräftige Schiffszimmermann, verzog das bärtige Gesicht zu einem spöttischen Grinsen.
„Seht nur!“ rief er. „Die Senhores haben die Hosen voll. Laßt euch bloß nicht von ihren Drohungen einschüchtern!“
De Pereira war längst klar geworden, was seit Tagen in der Luft gelegen hatte. Und er fand einige seiner stillen Vermutungen bestätigt. Langsam und fast unmerklich hatte sich da – offenbar mit dem Zutun Jorge Alamedas – einiges innerhalb der Mannschaft zusammengebraut.
Die Zwischenfälle, die mit dem Streit Vascos und Picos ihren Anfang genommen hatten, waren lediglich der auslösende Faktor für die womöglich von langer Hand geplante Meuterei gewesen.
Doch diese Erkenntnis nutzte ihm jetzt nichts mehr. Die Lawine, die ins Rollen geraten war, konnte niemand mehr aufhalten. Der Machtwechsel an Bord der „Madre de Deus“ war so gut wie besiegelt.
Die wenigen Männer, die sich auf dem Vorschiff mit den Meuterern angelegt hatten, wurden rasch niedergekämpft und – sofern sie noch am Leben waren – mit lautem Gejohle über Bord geworfen.
„Jeder Widerstand ist sinnlos“, sagte Jorge Alameda. „Legen Sie Ihre Waffen nieder, Senhores. Das Schiff wird von der Mannschaft übernommen.“
De Pereira und Cegos blieb keine andere Wahl. Sie warfen ihre Pistolen und Degen auf die Planken.
„Das wird schwerwiegende Folgen haben“, versprach der entmachtete Kapitän, der seine ohnmächtige Wut nur mühsam unterdrücken konnte. „Keiner von euch wird jemals nach Portugal zurückkehren können, ohne dem Henker übergeben zu werden.“
De Pereira erntete lautes Gelächter.
„Wer sagt denn, daß wir nach Portugal zurückkehren möchten?“ fragte der bärtige Alameda. „Die ‚Madre de Deus‘ ist ab sofort ein Freibeuterschiff …“
„Eine Piratengaleone!“ unterbrach de Pereira wild.
Jorge Alameda lachte laut auf. „Was soll diese abwertende Bemerkung, Senhor de Pereira? Waren nicht Sie es, der diese feine Handelsgaleone für so manchen einträglichen Raid mißbraucht hat – in der Eigenschaft als Piratenkapitän sozusagen?“
„Das waren kleine und unbedeutende Nebengeschäfte“, erwiderte de Pereira.
Alameda, der von den übrigen Meuterern ganz offenkundig als Anführer akzeptiert wurde, lachte abermals.
„Nur keine Verniedlichung! Die Beute war stets beachtlich und in erster Linie für Sie natürlich. Das Fleisch für den Kapitän – die Knochen für die Mannschaft, das war stets Ihr Wahlspruch, Senhor. Doch wir sehen nicht mehr ein, daß wir uns einerseits für einige reiche Säcke in Lissabon abschinden und andererseits für Ihre Privatgeschäfte die Köpfe hinhalten sollen. Ab sofort sind wir freie Männer auf einem freien Schiff und tätigen unsere Geschäfte auf eigene Rechnung.“
Die Mannschaft bestätigte die Worte Alamedas mit lautem Jubelgebrüll.
„Und was soll mit den sauberen Senhores geschehen?“ rief ein schmächtiger Kerl aus den hinteren Reihen. „Sollen wir die etwa auf unsere Kosten durchfüttern?“
„Kommt gar nicht in Frage“, antwortete ein anderer. „Die knüpfen wir an die Großrah.“
Gemessen an der allgemeinen Zustimmung, wurde diese Lösung von vielen begrüßt – am meisten von jenen, die schon einmal auf Befehl des Kapitäns oder des dürren Offiziers mit der Neunschwänzigen Katze Bekanntschaft geschlossen hatten und jetzt offenbar glaubten, ihre persönlichen Rachegelüste befriedigen zu können.
Doch nun zeigte sich zum erstenmal, daß Jorge Alameda tatsächlich das Sagen hatte.
„Warum solche Umstände?“ rief er. „Schicken wir die Senhores doch lieber auf eine letzte große Fahrt, damit sie in gewohnter Weise selbst ihren Kurs bestimmen können!“
Was der Schiffszimmermann damit meinte, wurde – zum Entsetzen de Pereiras und Cegos – rasch erkennbar.
Der laut jammernde Cegos mußte mit ansehen, wie man Miguel de Pereira auf einer Gräting festband und diese unter dem Hohn und Spott der Mannschaft über Bord warf.
Dann deutete Jorge Alameda auf ihn. „Mal sehen, ob dieser dürre Hering so gut schwimmen kann, daß er das schmucke Schiff seines Kapitäns einholt. Der braucht ja schließlich jemanden, der seine Befehle entgegennimmt.“
Augenblicke später wurde auch Rafael Cegos, begleitet vom höhnischen Gelächter der Meuterer, über das Schanzkleid gehievt.
Nach dem Auftauchen wischte er sich das Wasser aus den Augen und stellte – von Todesangst gepackt – fest, daß die Gräting, an die man den entmachteten Kapitän der „Madre de Deus“ gefesselt hatte, rasch davontrieb.
2.
Kahles, zerklüftetes Gestein gab dem Ufer der Bucht ein trostloses Aussehen. Doch schon weniger als hundert Schritte landeinwärts strich der Südwestwind durch das Blattwerk von Mango- und Papayabäumen, die zusammen mit Tamarisken, Akazien und Bodhibäumen weite Teile der Küste in üppiges Grün tauchten.
Die kleinen, aber festen Häuser, die sich bis dicht an das Ufer hinzogen, hoben sich in ihrer Farbe kaum von den Felsen der Umgebung ab. Und hätte ein merkwürdig aussehender, zylindrischer Rundturm, der abseits des Dorfes wie ein kleines Bollwerk auf den Klippen stand, nicht auf eine menschliche Ansiedlung hingewiesen, wären die Häuser kaum aufgefallen.
Im Dorf der Parsen herrschte seit Stunden eine rege Betriebsamkeit – wie immer, wenn eine Handelsfahrt nach Bombay bevorstand.
Die Felder waren fruchtbar, und ihr Ertrag ging weit über den Bedarf der Dorfgemeinschaft hinaus. Die Bauern brachten deshalb große Mengen von Hirse, Mais und Gerste, aber auch Zuckerrohr, Erdnüsse und Gewürze auf dem Rücken von Maultieren zu den vier pinassenartigen Einmastern, die neben zahlreichen Fischerbooten am Ufer der Bucht vor Anker lagen.
Einer der kleinen Segler gehörte Yasna, einem kräftigen, hochgewachsenen Mann, der trotz seines geringen Alters zu den Dorfoberhäuptern zählte.
Yasna war harte Arbeit gewohnt, und seine Felder warfen dadurch reiche Ernten ab. Auch jetzt packte er ordentlich mit zu, um die Überschüsse auf die Pinassen zu verladen.
„Die Fahrt wird sich lohnen“, sagte er zu Laneh, einem anderen jungen Bauern. „Vom Erlös werden wir auf den Märkten von Bombay viel Nützliches einkaufen können.“
Auch Laneh war zufrieden. Er lächelte erwartungsvoll.
„Ich werde vor allem Stoffe mitbringen. Das gibt neue Bekleidung für die ganze Familie. Und die Straßen der Gaukler werde ich mir auch nicht entgehen lassen. Die Fakire, die Seiltänzer und Feuerschlucker – sie faszinieren mich immer wieder.“
Für die hart arbeitenden Männer in dem entlegenen Dorf stellten die Handelsfahrten zu der großen Stadt, in der es soviel zu erleben und zu sehen gab, die Höhepunkte des Jahres dar.
Weitere Maultiere trabten heran – schwer beladen mit Mais und Hirse. Yasna zählte die Säcke noch einmal durch, bevor sie an Bord gebracht wurden.
Dabei erreichte ihn die grausame Nachricht.
„Yasna, Yasna!“ Das Entsetzen, das in der Stimme des Nachbarn durchklang, ließ den jungen Bauern nichts Gutes erwarten.
„Was ist, Meso? Warum bist du so aufgeregt?“
„Dein Vater – es tut mir so leid, Yasna …“
„Nun sag doch endlich, was passiert ist, Meso.“ Yasna packte den kleinen, rundlichen Mann an den Schultern und schüttelte ihn.
„Er – er ist auf das Dach seines Hauses gestiegen, um nach den Gewürzkräutern zu sehen, die dort zum Trocknen liegen“, berichtete der Nachbar keuchend. „Dabei muß dem alten Mann schwindlig geworden sein. Jedenfalls stürzte er ab. Er hat es nicht überlebt.“
Für einen Augenblick war das Gesicht des jungen Bauern wie versteinert. Seine Augen blickten hinaus aufs Meer.
„Komm mit mir, Meso, und hilf mir, ihm den letzten Dienst zu erweisen“, sagte er dann mit leiser Stimme.
Die beiden Männer verließen das Ufer der Bucht und eilten ins Dorf, in dem sich das Unglück rasch herumsprach.
Die Totenzeremonie mußte eingeleitet werden, und das war Yasnas Aufgabe. Die Parsen nahmen ihre Religion sehr ernst. Nicht zuletzt deshalb hatte die kleine Volksgruppe der Anhänger Zarathustras, deren Vorfahren schon Jahrhunderte vor Christus von Persien nach Indien eingewandert waren, bis jetzt Eigenständigkeit bewahrt.
Während der Priester im Tempel des heiligen Feuers benachrichtigt wurde, sorgte Yasna dafür, daß der Leichnam seines Vaters in einem Raum seines Hauses aufgebahrt wurde. Der Totenzeremonie stand nichts mehr im Wege; der Kampf zwischen Ahura Mazda, dem Fürsten des Lichts, und Ahriman, dem Fürsten der Finsternis, konnte stattfinden.
Während die Frauen laut klagten, legte Yasna die Trauerkleidung an.
„Holt den vieräugigen Hund“, bat er. „Wenn Ahriman, der Herr des Bösen, den Leichendämon Nasu in Gestalt einer Aasfliege entsendet, soll ihn der Bann des Lichtes treffen.“
Der Hund wurde in die Aufbahrungskammer geführt. Sein drittes und viertes „Auge“ wurde von zwei weißen Stirnflecken symbolisiert.
Ein solcher Hund gilt als teufelsaustreibend, er vermag durch seine Blicke den Zauber der Dämonen zu bannen.
„Der Priester kommt“, meldete nun Meso, der bereits vor dem Hauseingang Ausschau gehalten hatte.
Das Weinen der Frauen verstummte.
Wenig später betrat der in ein weißes Gewand gekleidete Mann das Haus des Verstorbenen. Er trug in einer Schale das heilige Feuer bei sich, um damit den Aufbahrungsraum symbolisch zu reinigen.
Nach diesem Ritual begannen zwei Männer aus dem Dorf an der Leiche Wache zu halten, und der Priester sprach die Totengebete des Avesta.
Als die Zeit für die letzte Reise des verunglückten alten Mannes gekommen war, wurde er von zwei weißgekleideten Totenträgern übernommen. Es begann eine einsame Reise zu einem einsamen Ort – zu jenem merkwürdigen Rundturm nämlich, der außerhalb des Dorfes stand.
Den massiv erbauten Turm umgab eine Aura des Unheimlichen, obwohl er keineswegs durch eine imposante Höhe beeindruckte. Trotz seines beträchtlichen Durchmessers war er nur fünfzehn bis zwanzig Fuß hoch und hatte weder Fensteröffnungen noch Schießscharten. Beides wurde von seinen stillen Bewohnern auch nicht gebraucht, denn das seltsam anmutende Bauwerk war nicht für die Lebenden, sondern für die Toten bestimmt.
Es handelte sich um einen „Turm des Schweigens“ – ein Bauwerk, dessen Stille nur vom Geschrei der über ihm kreisenden Geier unterbrochen wurde. Und das insbesondere dann, wenn den Vögeln auf der Plattform des Turmes der Körper eines Verstorbenen zum Fraß vorgelegt wurde.
Da den Parsen ein Leichnam als „unrein“ gilt, soll er durch diese Bestattungsart der Berührung mit den Elementen entzogen werden.
Yasna hielt seine Gefühle unter Kontrolle. Er stand mit den anderen Männern des Dorfes vor dem Haus seines Vaters und sah den Totenträgern nach, die mit ihrer traurigen Last dem „Turm des Schweigens“ zustrebten.
Meso, der Nachbar, legte ihm eine Hand auf die Schulter.
„Dein Vater war ein guter Mann“, sagte er, „Ahriman und seine Dämonen werden ihm nichts mehr anhaben können. Für uns aber wird das Leben weitergehen, und zu diesem Leben gehört die Arbeit. Was wirst du tun, Yasna? Soll die Reise nach Bombay zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden? Falls du dich dazu entschließen solltest, schlage ich vor, daß wir die Boote wieder entladen, damit vor allem das Getreide nicht zu lange den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.“
Yasna schüttelte den Kopf. „Wir werden nach Bombay segeln, Meso, und zwar so, wie wir das vorgesehen hatten. Die Fahrt ist wichtig für unser ganzes Dorf, und sie war auch in Sinne meines Vaters. Um das Erbe, das er hinterlassen hat, kann ich mich auch noch nach unserer Rückkehr kümmern.“
Nachdem Yasna hoch kurze Zeit im Kreis seiner Familie verbracht hatte, setzte er zusammen mit Meso die Arbeit fort. Die vier Einmaster sollten wie geplant im ersten Morgengrauen des nächsten Tages auslaufen.
Doch die nächste Schreckensbotschaft ließ nicht lange auf sich warten.
„Ein fremdes Schiff!“ rief ein junger Bursche und deutete mit ausgestrecktem Arm hinaus auf die See.
In der Tat – ein riesiges Schiff näherte sich der Bucht. Die drohend aus der Bordwand blickenden Kanonenrohre sorgten dafür, daß die Dorfbewohner in helle Aufregung gerieten.
3.
Die Schebecke der Seewölfe segelte über Backbordbug liegend auf Südkurs. Ihr Ziel war Bombay, die Hauptstadt von Maharashtra.
Als besonders gut konnte man die Stimmung an Bord nicht gerade bezeichnen. Der ganze Ärger über die gescheiterte Surat-Mission steckte den Arwenacks noch zu sehr in den Knochen, und gar mancher von ihnen wünschte sich im Augenblick nichts sehnlicher, als sich einen gewissen Francis Ruthland persönlich vorknöpfen zu können.
Edwin Carberry, der Profos der Seewölfe, rieb sich allein schon bei dem Gedanken an eine solche Begegnung die mächtigen Pranken.
„Vor allem würde ich diesem lausigen Hundesohn gern die hellen Fischaugen etwas dunkler einfärben“, verkündete er Batuti, dem Mann aus Gambia. „Zuerst veilchenblau, dann grün und zum Schluß gelb. Selbst seine eigene Großmutter würde den Kerl nicht mehr erkennen.“
Batutis Augen waren auf die kabbelige Wasserfläche gerichtet.
„In Gambia“, so erklärte er, „verfährt man anders mit solchen Leuten. Der Stamm der Mandingos würde Ruthland ausstoßen und ihn mit einer Ziegenhaut voll Wasser und etwas Nahrung aus dem Dorf vertreiben. Und kein anderes Dorf der Mandingos würde ihn jemals aufnehmen. Er müßte sein weiteres Leben allein im Busch verbringen. Das ist schlimm, Ed, sehr schlimm.“
Diese Meinung teilte Edwin Carberry ganz und gar nicht.
„Das ist viel zu mild für einen tückischen Ziegenbock“, entschied er. „Mit dem entsprechenden Proviant könnte sich der Kerl ja unter jedem schattigen Baum gemütlich niederlassen. Nichts da – ich würde ihn zu Fuß die Wüste Sahara durchqueren lassen, aber ohne eine Ziegenhaut voll Wasser, sondern mit einer Pütz voll eingesalzener Heringe.“
Mac Pellew, der die Kombüse verlassen hatte, um Gemüseabfälle über das Schanzkleid zu kippen, hatte die letzten Worte Carberrys noch mitgekriegt und stieß ein meckerndes Lachen aus.
„Du hast wohl heute deinen rachsüchtigen Tag, wie?“
Der Profos bedachte den sonst meist recht griesgrämig dreinblickenden Koch mit einem finsteren Blick.
„Fang du nicht auch noch an, mit meinen Nervenfäden Zupfgeige zu spielen, du Trauerkloß. Verhol lieber in die Kombüse und rühr fleißig die Suppe um.“
Immerhin, da hatte ihnen die alte Lissy eine ganz schön dicke Suppe eingebrockt, als sie den Seewolf beauftragte, zum Wohle Englands nach Indien zu segeln, um dort den Boden für Handelsbeziehungen vorzubereiten. Zunächst war dieser königliche Auftrag den Arwenacks noch ziemlich reizvoll erschienen.
Nur hatten sie die Rechnung ohne den besagten Francis Ruthland gemacht – einen Kauffahrer und skrupellosen Geschäftsmann, der den vermeintlichen „großen Kuchen“ in Indien für sich allein haben wollte.
Er war den Seewölfen heimlich gefolgt und bereitete ihnen seitdem Schwierigkeiten, wo immer sich eine Möglichkeit dazu bot. Dabei war es sein erklärtes Ziel, die vermeintlichen Konkurrenten auszuschalten. Sie sollten auf keinen Fall nach England zurückkehren.
Mac Pellew hatte inzwischen wieder sein gewohnt essigsaures Gesicht aufgesetzt und strebte der Kombüse zu.
„Mir bleibt ohnehin nichts anderes übrig, als die Suppe umzurühren“, nörgelte er. „Ich habe die ganze Kocherei mal wieder allein am Hals.“
„Und was treibt der Kutscher?“ wollte der Profos wissen. „Haben wir nicht zwei Kombüsenhengste an Bord, was, wie?“
Mac winkte ab. „Der betätigt sich mal wieder als Knochenflicker. Dieser Holzkasten hier ist ja kein Schiff mehr, sondern ein schwimmendes Hospital. Bald haben wir nur noch Kranke an Bord. Beim Backen und Banken merkt man allerdings nichts davon, da hauen selbst die Todkranken rein wie die Scheunendrescher.“
Mac Pellew verschwand murmelnd und brummelnd in der Kombüse, und gleich darauf war ein lauter Fluch zu hören, weil er sich womöglich an irgendeinem heißen Kessel die Finger verbrannt hatte.
Das bekümmerte Carberry jedoch nicht. Vielmehr war es das Wort „Hospital“, das ihn von seiner Taurolle hochpurrte. Als Profos war er schließlich für Zucht und Ordnung zuständig, und diese Zuständigkeit bezog er selbstverständlich auch auf grassierende Seuchen und Epidemien. Es ging ja nicht an, daß aus diesem flotten Schiffchen ein schwimmendes Hospital wurde.
„Räucherspeck und Rübensuppe!“ schnaubte er und fügte zu Batuti gewandt hinzu: „Du kannst ja allein weitermachen.“
„Weitermachen? Mit was denn?“ fragte Batuti verwundert.
„Mit dem Einfärben von Ruthlands hellen Fischaugen, mein Freund. Und vergiß nicht die Reihenfolge der Farben: zuerst veilchenblau, dann grün, dann gelb. Ich muß jetzt meines Amtes walten, damit das Siechtum an Bord gestoppt wird.“
Zum Äußersten entschlossen, schob der Profos das mächtige Rammkinn vor, legte das zernarbte Gesicht in Falten und marschierte gewichtig über die Planken – mit Kurs auf die Krankenkammer.
„Wohin so eilig, Ed?“ rief der Seewolf lächelnd vom Achterdeck. Er sah dem Profos regelrecht an, daß er der Erfüllung einer wichtigen Aufgabe zustrebte.
„Bin auf dem Weg zum Hospital – äh, zur Krankenkammer, Sir.“
„Bist du etwa krank?“ fragte Hasard.
„Ich und krank? Nein, Sir. Aber der Kutscher hat alle Hände voll damit zu tun, die Seuchen und Epidemien an Bord zu bekämpfen. Der Bursche hat kaum noch Zeit für die Kombüse, und das kann ja nicht angehen, Sir.“
Bevor der Seewolf nach der Art der Seuchen und Epidemien fragen konnte, verschwand der Profos unter Deck.
Der Kutscher, der nicht nur ein guter Koch, sondern auch ein hervorragender Feldscher war, hatte tatsächlich allerhand zu tun. Die Patienten drängten sich sozusagen in der Krankenkammer und warteten auf ihre Behandlung.
Der blonde, sehr hagere Mann hatte gerade Will Thorne, den alten Segelmacher, in der Mangel. Der lag auf dem Bauch, und der Kutscher drückte während seiner Untersuchung so lange seinen Rücken ab, bis er laut aufstöhnte.
„Da haben wir’s“, stellte der Kutscher zufrieden fest. „Hier läuft ein Nerv, der entzündet zu sein scheint. Die Schmerzen strahlen ähnlich wie bei Ischias durch die linke Gesäßhälfte bis ins Bein. Das kriegen wir wieder hin, Will. Sobald ich die anderen behandelt habe, werde ich dich kräftig einreiben, damit die Durchblutung gefördert wird. Morgen wird das Ganze wiederholt …“ Er unterbrach seine Erklärungen, als er den Profos eintreten sah. „Sag bloß, du hast dir auch eine Blessur geholt, Ed?“
Der Profos grinste von einem Ohr bis zum anderen. „Das würde dir so passen, Kutscher, wenn du mich auch mit deiner stinkenden schwarzen Salbe einreiben könntest, was, wie?“
„Aber klar doch“, entgegnete der Kutscher. „Ein größeres Vergnügen könnte ich mir kaum vorstellen.“
„Da spielt sich aber nichts ab“, erklärte der Profos. „Meine Knochen sind heil, an denen hast du nichts zu suchen mit deinem gräßlichen Salbenzeug. Wegen mir wird dieses Schiffchen jedenfalls nicht zu einem schwimmenden Hospital, klar?“
„Sagtest du eben ‚Hospital‘?“ fragte der Kutscher erstaunt.
Der Profos nickte. „Du hast richtig gehört, mein Freund. Deine Lauscher sind noch völlig in Ordnung. So, nun wird es aber Zeit, daß ich mir einen Überblick über den Ernst der Lage verschaffe. Wer gehört hier zu den Siechen?“
Der Kutscher holte eine kleine braune Flasche aus seinem Medizinkasten und öffnete sie.
„Wenn man dich reden hört, Ed, könnte man gerade meinen, wir hätten die Pest an Bord. Aber falls es dich beruhigt – hier gibt es keine Siechen. Und ein Hospital wird ebenfalls nicht gebraucht. Will hat’s im Kreuz, aber in ein paar Tagen wird er wieder herumhüpfen wie ein Veitstänzer. Plymmie, unsere verehrte Hunde-Lady, hat sich einen Holzspan in die rechte Hinterpfote getreten, und hätte Paddy, der das bemerkt hat, nicht soviel Schiß vor Hunden, hätte er dem armen Tier längst selber helfen können. Dann haben wir da noch Old Donegal, der sich an einem hervorstehenden Nagel eine ziemlich tiefe Schramme in einen gewisse edlen Körperteil gerissen hat. Für ihn ist diese wohlriechende Tinktur bestimmt, damit er nicht den Wundbrand kriegt. Und wenn mich meine Augen nicht täuschen, handelt es sich bei dem Gentleman, der da gerade mit einem Gesicht, das tiefste Pein erkennen läßt, zum Schott hereinschneit, um meinen geschätzten Kollegen Mac Pellew, der sich in der Kombüse wieder mal die Finger verbrannt hat. Aber keine Bange, die schwarze Salbe wird hier hervorragende Dienste leisten. Er wird rasch in die Kombüse zurückkehren können, und du, verehrter Mister Carberry, wirst pünktlich zum Backen und Banken deine Erbsensuppe in der Kumme haben.“
„Uff“, schnaufte der Profos, „das war mal eine lange Rede.“
„Du brauchst ja nicht die Luft anzuhalten, während ich was sage“, entgegnete der Kutscher freundlich.
Für Old Donegal war das Grund genug für ein glucksendes Lachen.
„Schade, daß du nicht ein bißchen länger geredet hast, Kutscher, sonst wäre noch ein Erstickungsanfall zu behandeln gewesen.“
Der Profos bedachte Ed Old Donegal mit einem strafenden Blick. Dann zog er es jedoch vor, sich aus der Krankenkammer zurückzuziehen, zumal der Kutscher – wie es schien – das „allgemeine Siechtum“ dank seinen übelriechenden Arzneien gut im Griff hatte.
Bevor er den Raum verließ, drehte er sich noch einmal um.
„Übrigens, Mister O’Flynn: Wenn du dir demnächst wieder eine Schramme holst, dann laß gefälligst dein zartes Hinterteil aus dem Spiel und verpaß dir den Kratzer ins Holzbein. Dann kannst du damit unseren Schiffszimmermann von der Arbeit abhalten, und nicht den Koch, der Wichtigeres zu tun hat, als angekratzte Achtersteven mit Tinkturen zu beträufeln. Und was dich betrifft, verehrter Mister Pellew: Wenn du unser Schiffchen noch mal als schwimmendes Hospital bezeichnest, fülle ich dir einen ganzen Topf heißer Erbsensuppe in deine Pluderhose und binde sie unten zu, du blaukarierter Zackenbarsch.“
Unter dem allgemeinen Gelächter schloß der Profos das Schott und verholte wieder an Deck.
„Dein Gesicht ist so ernst, Ed“, sagte der Seewolf. „Wir haben doch hoffentlich nicht die Pestilenz an Bord?“
Carberry winkte ab.
„Ach was, Sir, außer ein paar angekratzten und angesengten Affenärschen ist nichts weiter.“
„Brrrh!“ Luke Morgan schüttelte sich, bevor er zu einem Tuch griff, um sich die Nässe vom nackten Oberkörper zu wischen. Der kleine, drahtige Mann mit dem dunkelblonden Haar und der Messernarbe auf der Stirn hatte einen heftigen Regenschauer oben im Ausguck abgewettert.
„Plymmie kann das wesentlich besser“, bemerkte Old Donegal, der auf seinem Holzbein herangestakt kam. „Ich meine natürlich das Schütteln.“
„Was du nicht sagst.“ Luke Morgan grinste. „Ich dachte schon, du meinst das Aufentern und Ausschau halten.“
„Nun – äh, das kannst du natürlich besser, denn du bist ja keine Hündin“, meinte Old Donegal.
„Vielen Dank für diese Feststellung.“ Luke grinste noch breiter. „Sie kam gerade noch rechtzeitig, sonst hätte ich angefangen, zu bellen.“
Tückisch und wechselhaft, wie der Sommermonsun war, hatten sich die dunklen Regenwolken zum größten Teil wieder aufgelöst, und die Sonne brach durch.
Noch während Luke Morgan damit beschäftigt war, sich abzutrocknen, ertönte ein lauter, krächzender Schrei über der Kuhl. Danach näherte sich lauter Flügelschlag, und Sir John, der karmesinrote Aracanga-Papagei landete auf Lukes Schulter.
„Noch eine Nuß!“ forderte der bunte Vogel.