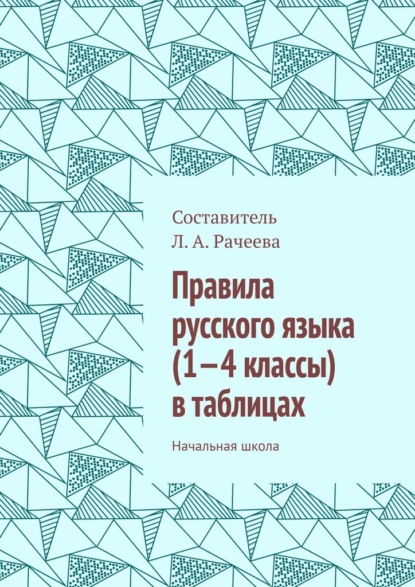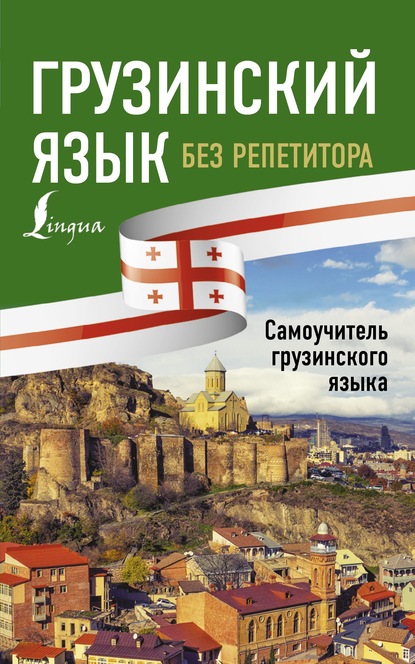Seewölfe Paket 34

- -
- 100%
- +
Greefken, der irgendwo neben dem Ruder im Dunklen saß, drehte die Sanduhr um. Das Glasen hallte über das nasse Deck. Der Bootsmann packte den Handlauf und zog sich ächzend in die Höhe.
„Hoffentlich muß ich die Ablösung nicht an Deck prügeln“, murmelte er und schlurfte zum nächsten Niedergang.
Swieten blieb sitzen und fühlte, wie ihm die Augen zufielen. Jetzt war er sogar zu schlapp zum Gähnen.
Die „Zuiderzee“ lag in einer Bucht, die nach Nordosten offen war. Der trockengefallene Boden bestand aus schlickigem Lehm. Bei höchstem Stand der Flut hatten sie dicht vor dem Ufer den Anker geworfen und das Heck zum Strand schwojen lassen.
Die drei Mann der Ablösung, Taesert, Geuze und Overleek, stolperten an Deck. Sie hielten freiwillig die Köpfe in den niederprasselnden Regen.
„Bringt Swieten nach unten“, sagte Antony halblaut. „Und zieht ihm die Stiefel aus. Brecht ihm aber nicht die Zehen.“
Er selbst war barfuß. Von den vielen Füßen der Crew war auch jede Planke des Decks gezeichnet. Nasser Schlick war überall verteilt und verschmiert. An einigen Stellen lagen Werkzeuge herum. Der lange Regen hatte Sand und Schmutz über das gesamte Deck verteilt.
„Verstanden, Bootsmann“, lautete die Antwort der Seeleute. Sie trugen den Schiffszimmermann, der mit seinen wenigen Leuten die meiste Arbeit geleistet hatte, unter Deck.
Die „Zuiderzee“ war bei einsetzender Ebbe auf den weichen Grund gesetzt worden. Die gesamte Mannschaft schuftete und half, ohne daß der Kapitän jemanden anzutreiben brauchte. Die Jakobsleiter wurde ausgerollt, und je mehr das Wasser fiel, desto besser konnte an der Außenbeplankung gearbeitet werden. Mit schmatzenden, gurgelnden Geräuschen sackte der Kiel tiefer in den Schlick.
Die morschen, gebrochenen Planken wurden, halb unter Wasser, herausgestemmt und ersetzt, während von binnen möglichst viele Platten, Leinwand und Stoff gegengehalten wurden. Ununterbrochen arbeitete die Pumpe und lenzte Wasser nach außenbords.
Die Holländer standen im warmen Wasser und arbeiteten. Schließlich konnte der Rumpf gekrängt werden, so daß das Leck über dem Wasserspiegel lag.
Jetzt drang kein Wasser mehr ein. Auch von innen, vom Laderaum aus, konnten die Männer arbeiten. Sie ersetzten eins der morschen Teile nach dem anderen. Der Kapitän stand an der Pumpe und lenzte, auch der Erste schuftete und war schweißüberströmt. Schließlich gurgelte der letzte dünne Wasserstrahl aus der Öffnung des Pumpenrohres.
Die Unruhe im Schiff weckte schließlich, jetzt, zwischen Mitternacht und Morgen, Martin Lemmer, den Ersten Offizier, auf. Barfuß schleppte er sich an Deck und versuchte, dem Regen auszuweichen. Schwach lag der Schein der blakenden Hecklaterne auf dem nassen Deck.
„Welch ein Saustall“, murmelte Lemmer. „Die Kerle müssen richtig zusammengebrochen sein.“
Er spürte seine eigene Schwäche und grinste. Langsam tappte er entlang des Schanzkleides und wich den Spänen, Plankenstücken und Pützen aus. Vor einer Culverine blieb er stehen und erinnerte sich daran, daß vor weniger als vierundzwanzig Stunden der Kapitän noch überlegt hatte, ob die Geschütze mitsamt den Lafetten an Land gebracht werden sollten.
Dieser Dries Versteeg, dachte der Erste zufrieden, fast bewundernd, er hat seine verdammten Geschütze sogar schußfertig. Aber Feuergefechte wird’s heute nacht wohl keine geben.
Er nickte der Wachablösung zu und blieb unter der Fock stehen, die als Regenschutz schräg über das Vorschiff gespannt war. In der Mitte hing sie schwer durch, dort hatte sich das Regenwasser gesammelt. An den fremden Küsten dieses unbekannten Teiles der Welt war es warm. Unter den Umständen der letzten Tage hatte diese Wärme das Schiff und die Mannschaft vor Schlimmerem bewahrt.
„Vorderindien“, sagte Lemmer leise vor sich hin und wußte, daß es die richtige Entscheidung war, die Crew so lange wie möglich schlafen zu lassen und dann mit einem kräftigen Essen zu versorgen, „eine schöne Begrüßung hält das Land für uns bereit.“
Sie waren den Portugiesen davongesegelt, hatten Piraten unbekannter Nationalität abgewehrt, kein Mann war ernsthaft krank geworden oder gar auf See geblieben. Die Stürme hatten die „Zuiderzee“ arg gezaust und gebeutelt, aber nicht wirklich in Gefahr gebracht.
Martin Lemmer fuhr mit der Hand über sein Kinn. Die Bartstoppeln kratzten. Er winkte ab, gähnte und verzog sich wieder in die warme Koje, in der es nicht weniger als im übrigen Schiff stank. Trotzdem schlief er binnen Minuten erneut ein.
Die Stunden schlichen dahin, und aus dem Wolkenbruch des frühen Abends wurde im Verlauf der Nacht ein dünnes Nieseln. Zwei Stunden vor Sonnenaufgang vertrieb der Monsunwind die Wolken und den Regen völlig.
Es merkte kaum einer der Männer unter Deck, wie die Flut das Wasser in die Bucht zurückbrachte und schließlich ein langes Zittern und ein stärkerer Ruck durch den Rumpf ging. Masten und Tauwerk schienen sich zu schütteln, aus der Fock schwappte klatschend das Wasser heraus und verbreitete sich auf den Decksplanken.
Als Kapitän van Stolk aufwachte, schwamm sein Schiff wieder. Unter dem Kiel waren fünf Handbreiten Wasser, die Ankertrosse hatte sich ebenso gespannt wie die beiden Leinen zum Land.
Zeeren und Samuel, die Köche, hatten ihr Geschirr auf die Kuhl geschleppt. Der Hunger und noch mehr das Aroma aus den Mucks des Ersten und des Kapitäns, feinster Rum nämlich, brachten einen nach dem anderen auf die Beine. Mit verschlafenen Augen, schweißverklebtem Haar und unrasiert erschien die Crew des holländischen Handelsschiffes auf der Kuhl.
„Hoffentlich seid ihr einigermaßen wach“, sagte Willem van Stolk und setzte sich auf ein leeres Wasserfäßchen. „Nach dem Freudenmahl wird erst mal das Schiff aufgeklart.“
„Schon gut, Willem“, antwortete Martin Lemmer in gemütlichem Tonfall. „Ich kümmere mich darum. Wir haben das Aufklaren genauso nötig wie unser alter Kasten.“
„Ich hab’s nicht eilig“, sagte der Kapitän und blinzelte in die Sonne. „Meint ihr, daß wir morgen früh weitersegeln können? Schließlich sind wir nicht nur zum Ausschlafen hier.“
„Das habe ich gemerkt.“
Martin Lemmer setzte sich neben den Kapitän und ließ es sich, ohne viel dabei zu reden, genauso schmecken wie die anderen Seeleute. Die zweite Portion Rum gluckerte in die Becher.
„Ist das Leck völlig dicht?“ fragte der Kapitän nach einer Weile.
Swieten legte die Hand an die Stirn und nickte. „Ich habe alle Planken kontrolliert, ebenso die Plankennähte. Leckstellen habe ich nicht mehr feststellen können.“
Die Sonne war höher geklettert und leuchtete über die Wipfel der Bäume in die kleine Bucht und auf die „Zuiderzee“. Aus der dumpfen Schwüle war trockene Hitze geworden. Willem van Stolk stand auf und ging zwischen den Männern der Crew hindurch bis zum Schanzkleid zwischen der Back und dem Galionsdeck. Schweigend musterte er das Ankertau und die kleinen Wellen, die sich am Bug der Karavelle brachen. Im klaren Wasser huschten Fischschwärme hin und her und führten gleichzeitige Wendungen aus.
„Gut so“, meinte der Kapitän zu sich und ging zu seiner Crew zurück. „Wir brauchen nicht zu verholen. Das Schiff liegt gut und sicher, denke ich.“
Er wandte sich an einen Koch und sagte: „Wir brauchen heißes Wasser. Ziemlich viel. Das Schiff sieht genauso verwahrlost aus wie wir alle. Die ‚Zuiderzee‘ ist schließlich kein Seelenverkäufer.“
„Verstanden, Schipper“, sagte der Erste. „Wir wollen ja auch bei den eingeborenen Fischern und Muschelsammlern einen guten Eindruck hinterlassen.“
Van Stolk lachte. „So ist es.“
Willem van Stolk, vierundvierzig Jahre alt, war weder ein Antreiber noch ein Kapitän von der Sorte, die es nicht vertragen konnte, wenn es der Crew gutging und die Seeleute sich ausruhten. Die Crew stammte fast vollzählig aus demselben Ort und segelte schon seit langer Zeit auf der „Zuiderzee“ zusammen.
Wenn es sein mußte, schufteten sie vierundzwanzig Stunden ununterbrochen und wie die Wilden. Das hatten sie während der beiden vergangenen Tage wieder einmal bewiesen. Jetzt wollte er es langsam angehen lassen, er brauchte ebenso Erholung wie seine Leute. Er lehnte sich gegen das Schanzkleid und hielt dem Koch auffordernd den leeren Becher entgegen.
„Noch einen Schluck“, schlug er vor, „dann fangen wir an, Leute.“
Nachdem die Köche das leere Geschirr eingesammelt hatten und der letzte Rum getrunken war, ging die Crew daran, das Schiff aufzuklaren. Sie holten eine Pütz nach der anderen voller Salzwasser an Bord, schrubbten die Decksplanken, schossen die Leinen auf und spülten den Schlick durch die Speigatten und die Öffnungen im Schanzkleid außenbords.
Ein paar enterten über die Wanten auf und brachten die Rahruten und die Schoten in Ordnung. Swieten, der Zimmermann, und der Kapitän packten zwei Lampen und stiegen in den Kielraum hinunter.
Mit dem Stiel des Kuhfußes prüfte Swieten die Planken. Das Geräusch klang vertrauenerweckend.
„Gute Arbeit, Swieten“, sagte van Stolk. Er fuhr mit der Hand über die neu eingesetzten und gegengenagelten Teile. „Hält das die Rückfahrt auch noch aus?“
„Das weiß ich nicht“, erwiderte der Zimmermann. „Hier jedenfalls sind die Planken dicht. Ich habe alles angeschaut und abgeklopft, auch von außenbords.“
„In Ordnung“, sagte der Kapitän. „Die Luken offenlassen und holt die Ballen zum Trocknen an Deck, solange es nicht regnet.“
„Habe ich schon angeordnet“, antwortete Martin Lemmer und deutete nach oben. „Luken und Grätings sind offen, die Grätings werden geputzt. Und dann hieven wir das nasse Zeug an Deck.“
„Gut. Dann kann ich mich also in Ruhe rasieren, wie?“ fragte der Kapitän und nahm die Lampe vom Haken.
„Selbstverständlich. Ich hab’s auch vor.“
„Dann hätten wir dieses Abenteuer auch wieder überstanden“, murmelte der Kapitän. Sein Tonfall drückte seine Zufriedenheit aus.
Er stieg vom Bug bis zum Heck durch alle Laderäume und inspizierte jeden Winkel zwischen und hinter dem Ladegut. Immer wieder klopfte er mit dem Messergriff gegen das Holz und lauschte auf den Klang. Schließlich enterte er wieder aus der stickigen Tiefe an Deck.
„Alle herhören!“ rief er. „Wir klaren auf und legen einen Ruhetag ein. Morgen früh gehen wir wieder in See. Beeilt euch mit der Ladung – keiner weiß, wann es wieder regnet.“
„Jawohl, Schipper!“ schrien die Männer voller Begeisterung.
Der größte Teil der Decksplanken war mittlerweile so sauber, wie es sich für ein gutgeführtes holländisches Kauffahrerschiff gehörte.
Bis Mittag hatten die Holländer in strahlendem Sonnenschein und der trockenen Hitze ihre „Zuiderzee“ auf Hochglanz gebracht. Kapitän, Erster und Bootsmann wuschen sich das Haar, stutzten die Bärte und schabten sich die Stoppeln vom Hals und von den Wangen.
Greefken war über die Wanten in den Großmasttopp aufgeentert und suchte die Umgebung mit dem Spektiv des Kapitäns ab.
„Was siehst du durch den Kieker?“ rief Antony Leuwen von der Kuhl. „Nur Wasser und Vogelschwärme, wie?“
„Und Fischerboote. Mehr als ein Dutzend. Dort drüben, an Backbord, muß ein Fischerdorf sein!“ rief der Ausguck, ehe er den Kopf drehte und über die Bäume des Ufers hinwegzublicken versuchte. Seit Sonnenaufgang kreisten die Vögel über der Bucht. An die verschiedenen Laute der Tiere, von denen sie nur selten eins sahen, hatten sich die Holländer inzwischen gewöhnt.
„Bewegen sich die Fischerboote auf uns zu?“ wollte der Erste wissen. Er trocknete mit einem leidlich sauberen Tuch sein Haar und wischte den Schaum aus dem Gesicht.
„Nein, Martin. Sie haben uns zwar gesehen, aber wir sind für sie nicht wichtig. Vielleicht wissen sie, daß keiner von uns gern Fisch ißt.“
Die Crew brach in Gelächter aus. Durch die Luken wurden feuchte oder nasse Ballen und Kisten aufwärts auf die trockenen Planken gehievt. Die Crew riß die Deckel auf, schlug die Leinwand um die Planken auseinander und zerrte das nasse Zeug in die Sonne.
Die Köche brutzelten und kochten unter Deck, nachdem sie das Essen im hellen Sonnenschein vorbereitet hatten. Um die Abfälle, die über das Schanzkleid flogen, versammelten sich die Fische.
„Ein guter, ruhiger Tag“, sagte der Kapitän schließlich. Er saß mit nacktem Oberkörper in der Sonne und schaute sich die Umgebung in aller Ruhe durch das Spektiv an. Er hatte das Schiff tatsächlich an eine kaum bewohnte Stelle der Küste gesegelt. Größere Siedlungen gab es wohl weiter im Osten oder mit Gewißheit an der Ostküste im Süden des Landes.
Ein paar Männer wuschen ihre Hemden, einige rasierten sich, drei Mann lagen auf der Back und dösten im Schatten. Der Rumpf der „Zuiderzee“ hob und senkte sich in den Wellen und zerrte an den Tauen. Martin Lemmer schaute nach den Wasserfässern und entschied, daß der Vorrat reichte.
Ohne Eile wurden die trockenen Kisten wieder in die Laderäume abgefiert. Durch die offenen Luken zog muffiger Dunst ab. Dries Versteeg, der Stückmeister, kümmerte sich schweigend um die Culverinen und putzte die Drehbassen, nachdem er die Rohre gesäubert und getrocknet hatte.
„Willst du die Fischerboote bekämpfen, Dries?“ rief Antony.
„Ganz bestimmt nicht. Aber Feuchtigkeit in den Rohren, das ist nicht mal für leere Geschütze gut.“
„Recht hat er. Laß dich nicht aus der Ruhe bringen“, sagte Greefken.
Am Schanzkleid, in den Wanten und überall im Tauwerk hingen die hassen Tücher und Kleidungsstücke. Die Sonne brannte fast senkrecht aus einem wolkenlosen Himmel herunter. Vermutlich würde der Regen nicht bis zum Abend auf sich warten lassen. In den zurückliegenden Tagen hatte es fast regelmäßig am späten Nachmittag zu regnen angefangen.
Die Mannschaft klarte auch unter Deck auf, die Kojen wurden ebenso gelüftet wie die Kammern. Der Erste und der Navigator überprüften die Karten, ließen sich nach dem Essen ein paar Becher Wein bringen und sagten sich, daß die Stunden des Nichtstuns ohnehin so selten waren. Viele Arbeiten, für die sonst keine Zeit blieb, wurden am Nachmittag zumindest angefangen.
Vier Stunden vor der Abenddämmerung hatte sich der Himmel mit dunklen Wolken überzogen.
„Wir müssen das Deck räumen!“ rief Willem van Stolk. „Und dann zurrt die Persenninge über die Grätings.“
„Verstanden, Willem.“
Der Erste stand auf und steckte das Messer, mit dem er die Fingernägel geputzt und geschnitten hatte, in den Stiefelschaft.
„Packt mit an“, sagte er. Ein Stück Ladegut nach dem anderen, leidlich trocken, wurde durch die Luken gehievt. „Das Deck wird gleich wieder von selbst gespült.“
Eine halbe Stunde danach sammelten die Holländer ihre trockenen Hemden und Tücher ein. Vor der Sonne, die über den Baumwipfeln des Uferwaldes hing, schob sich die erste graue Nebelwolke.
„Das war’s“, sagte Willem van Stolk und rieb einige Tropfen Öl zwischen den Handflächen. Dann verteilte er das Öl in seinem Gesicht. „Der Regen ist pünktlich.“
Die Helligkeit nahm ab, aus den treibenden Wolken wurde eine zusammenhängende dunkle Wand. Der Wind, der durch die Bäume fauchte, kräuselte die Wellen der Bucht und ließ die „Zuiderzee“ schwanken. Die Blicke der Holländer wanderten zum Himmel, aber noch regnete es nicht. Martin Lemmer teilte die Wachen ein und stellte das Kommando für den nächsten Morgen zusammen.
„Wir gehen ankerauf und steuern, solange der Wind nicht zu stark ist, nach Südosten“, sagte er. „Auf den Karten habe ich zwei Häfen ausgemacht: Bharuch und Khambhat. Je nachdem – einen laufen wir an. Also: zuerst einen Becher Tee, ein Stück Brot, und dann staken wir aus der Bucht.“
„So halten wir’s“, sagte der Stückmeister:
„So versuchen wir’s jedenfalls“, schloß der Kapitän und verschwand in der Kapitänskammer.
Es dauerte noch eine Stunde, bis die Monsunwolken den gesamten Himmel bedeckten und die Windstöße schwere Regentropfen heranwirbelten. Auf den trockenen Planken erschienen unzählige kleine Punkte, und schließlich folgten die Regengüsse in schrägen Bahnen. Binnen weniger Atemzüge waren die Ränder der Bucht hinter den graublauen Vorhängen aus Wasser unsichtbar geworden.
Die Mannschaft der „Zuiderzee“ verzog sich unter Deck und wartete, während das Rauschen und das Plätschern über ihnen immer lauter wurde.
Kapitän Philip Hasard Killigrew stand schräg hinter dem Rudergänger und hielt sich an einem Fall fest. Die Schebecke kreuzte gegen Wind und Strömung, Kurs Süden lag an. Die Sicht betrug nicht mehr als eine Kabellänge. Die Männer, die sich noch an Deck aufhielten, trugen die langen Segeltuchjacken und troffen, wie alles andere, vor Nässe.
Pete Ballie umklammerte die Pinne, die Schebecke krängte nach Backbord. Der Bug hob und senkte sich und setzte krachend in die See. Ein salziger Schauer wehte vom Bugspriet her und stob über die Decksplanken.
„Eine feine Segelei ist das aber nicht, Sir!“ schrie Pete und stemmte sich gegen das nasse Holz der Pinne. „Wo sind wir eigentlich?“
„Auf jeden Fall weit von Ufern und Sandbänken entfernt, Pete!“ rief der Seewolf zurück. „Du hast recht. Wir hätten irgendwo vor Anker gehen sollen.“
„Zu spät jetzt.“
„Stimmt“, antwortete Hasard. „Noch ein paar Stunden, dann ist alles vorbei. Dann sehen wir auch, wo wir sind.“
„Hoffentlich.“
Der Regen war warm wie immer in diesen Tagen und Nächten. Leichter Dunst zog auf, die Wellen waren weniger hoch als befürchtet. Wenn die Karten richtig gezeichnet waren, und bisher waren sie erstaunlich genau gewesen, dann befanden sie sich jetzt etwa querab der Narbada-Mündung. Der Seewolf überlegte, ob es Zeit für die nächste Kursänderung sei. Schließlich wollte er nicht weiter südlich, womöglich nahe Surat, nach Ruthland suchen, sondern im Westen der trichterförmigen Bucht.
„Wir fallen nach Westen ab!“ rief er.
Ben Brighton zeigte von der Kuhl her klar. Das matte Licht der Hecklaterne reichte gerade bis zum Großmast.
„Abfallen, Pete“, befahl Hasard.
Die Schoten wurden gefiert, während Pete Ballie Ruder legte.
Jeder, der in diesem scheußlichen Regen an Deck stand, starrte in die Dunkelheit hinaus und versuchte zu erkennen, in welchem Fahrwasser sich die Schebecke befand. Aber es gab nichts anderes zu sehen als dunkle Wellen mit winzigen Schaumkronen, und auch die Geräusche ließen nicht erkennen, ob Untiefen oder Riffe lauerten.
Der Bug der Schebecke hatte sich westwärts gerichtet. Die Dreieckssegel waren getrimmt, die Schoten belegt. Der Regen fiel jetzt von Backbord ein.
Der Seewolf fühlte sich noch immer unbehaglich wie seit Anbruch der Nacht. Längst hatte er eingesehen, daß es besser gewesen wäre, irgendwo in Ufernähe vor Anker zu gehen.
„Ich kann nur hoffen“, sagte er halb zu sich selbst, „daß die Sonne uns zuliebe etwas früher aufgeht.“
Die Schebecke schob sich weiter durch Regen und Dunkelheit. Die Männer hofften, am nächsten Tag auf die „Ghost“ zu stoßen. Und dann würden die Kanonen sprechen.
5.
„Alle Mann an Deck!“
Francis Ruthland beugte sich weit über das Schanzkleid. Der Bug der „Ghost“ driftete, Handbreite um Handbreite, durch das pechschwarz erscheinende Wasser. Die Männer stakten von der Kuhl aus mit den Riemen, stemmten deren Blätter gegen die Hochwurzeln der Mangroven und schoben das Schiff aus dem Versteck.
Die Enden der Rahruten schrammten an den Lianen entlang. Als sich der Bugspriet um die Krümmung schob, blinzelte Ruthland überrascht. Vor der Karavelle stand eine dünne Nebelwand, von der die Sicht auf das freie Wasser versperrt wurde.
Luftblasen platzten an der Oberfläche des ruhigen Wassers. An der Bordwand rieben sich federnd die Äste, die Halme von bambusartigen Gräsern raschelten.
„Gut so!“ rief Francis Ruthland. „Bringt das Heck mehr nach Backbord! Verdammter Dunst.“
Die Morgendämmerung war kurz, die Helligkeit nahm zu. Noch leuchtete die Sonne nicht durch den Nebel. Die Riemen polterten, das Wasser plätscherte, und die Vögel lärmten an Land und über den Masttopps.
Knarrend schwang das Heck herum. Eine Reihe nachdrücklicher Stöße der Riemen, teilweise gegen das Ufer, teilweise im Wasser und im schlickigen Grund, schoben die „Ghost“ in den Nebel und in Richtung des freien Wassers.
Hugh Lefray gab das nächste Kommando. Die Geitaue des Focksegels wurden gelöst, das Segel, noch naß vom nächtlichen Regen, sackte schwer nach unten und sprühte einen Tropfenregen nach allen Seiten. Wieder schoben die Ruderer an, die Karavelle kam gut frei und verschwand im Dunst. An Backbord erschien im Nebel ein hellerer Fleck, der anzeigte, daß die Sonne sich über die Kimm hob.
„Weiter draußen“, rief Ruthland, „löst sich der Nebel auf! Spätestens in einer Stunde. Und dann geht’s nach Süden!“
„Ich denke, wir gehen auf den Seewolf los?“ schrie Lefray vom Quarterdeck.
Giftig erwiderte der Kapitän: „Was meinst du, wo wir den Bastard treffen?“
„Na gut, im Süden. Und woher weißt du das so genau?“ fragte der einäugige Kumpan.
„Weil er uns im Süden sucht. Deswegen“, lautete die Antwort.
Ruthland war davon überzeugt. In der letzten Nacht hatten sie lange über den Seewolf und seine Männer gesprochen.
Mit einem letzten Schwung glitt die Karavelle vollends in den Nebel. Die Farbe des Wassers änderte sich, als die lautlosen Wirbel hinter dem Heck sich auflösten.
Grauer Dunst umgab die „Ghost“, als sie das tiefe, sichere Wasser außerhalb der Bucht erreichte und in den Bereich einer schwachen Brise gelangte. Die Leinwand des Segels wehte schlapp hin und her und trocknete nur langsam.
„Stückmeister?“ rief Ruthland.
Von der Kuhl ertönte augenblicklich die Antwort. „Sir?“
„Alle Geschütze müssen feuerbereit sein. Auch die Drehbassen. Im Lauf des Tages stoßen wir auf Killigrew. Und dann mußt du besser zielen als jemals zuvor. Verstanden, David?“
„Sehr wohl, Sir?“ gab David Lean zurück und rieb sich die Hände.
Die Riemen polterten, als sie unter Deck und im Beiboot verstaut wurden. Das Großsegel wurde getrimmt und die Schot belegt. Eine Strömung packte die Karavelle und zog sie langsam, fast kraftlos, aus der Bucht und durch den Dunst, der langsam eine rötliche Färbung annahm. Hinter dem Schiff und über den Masten schrien unzählige Vögel, die in unsichtbaren Schwärmen kreisten.
„Kurs halten. Wir haben keine Eile“, sagte Ruthland.
„Aye, aye, Sir.“
David Lean und fünf aus der Deckscrew schleppten Pulverfässer, Kugeln und Werkzeug an Deck. Eine Persenning nach der anderen wurde losgebändelt und verstaut. Die breiten Räder der Lafetten rumpelten über die Planken, die Rohre wurden überprüft. Sorgfältig kontrollierten der Stückmeister jedes einzelne Geschütz samt Pulvermenge und lud nach, wenn er es für notwendig hielt.
Pugh schleppte die Drehbassen auf beiden Armen vom Vorschiff und achtern auf die Kuhl, setzte sie schweigend ab und warf einen prüfenden Blick auf die Segel. Aus dem Stoff tropfte noch immer Wasser, aber der Wind war kräftiger geworden und schob die Karavelle zunächst ostwärts.
„Noch eine Stunde“, sagte Ruthland und sprang von der Back mit einem Satz auf die Kuhl. „Dann segeln wir mit gutem Wind.“
Der Nebel schien dünner zu werden, die Hitze begann ihn aufzulösen. Der Wind nahm zu, und schließlich lag die „Ghost“ gut auf dem Ruder.
Francis Ruthland ballte die rechte Hand zur Faust und sagte erleichtert: „Wir gehen auf Südkurs, und wenn wir bis in die Nacht kreuzen müssen.“
Zwei Stunden nach Sonnenaufgang hatte sich der Nebel restlos aufgelöst. Die „Ghost“ befand sich im freien Fahrwasser, aber in jeder Richtung der Windrose befanden sich Inseln, schoben sich Landzungen vor, tauchten langgestreckte Sandbänke auf.
Plötzlich vernahmen die Kerle fernen Donner. Als sie genau hinhörten, stellten sie fest, daß es unzweifelhaft Geschützdonner sein mußte. Sie konnten deutlich die einzelnen Abschüsse unterscheiden.
Der Geschützlärm erklang aus dem Norden des Inselgewirrs.
Hasard blinzelte, seine Augen tränten vor Müdigkeit. Aber er hob wieder das Spektiv ans Auge und musterte durch die Linsen die Umgebung. Die Schebecke lag auf Westkurs, und das Wasser neben der Bordwand war dunkelblau. Um das Schiff hatte sich, mehrere Seemeilen im Umkreis, eine freie Zone gebildet.