Seewölfe Paket 31
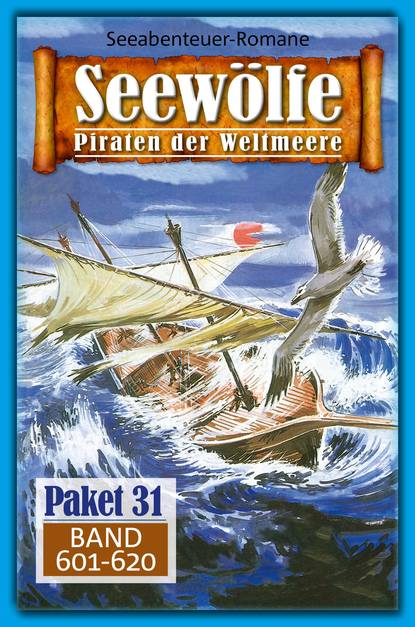
- -
- 100%
- +
Leer wie das Odadahraun, jenes riesige Gebiet aus dunklem Geröll und Schutt, das vor Urzeiten aus dem Weltinneren ausgeworfen worden war, blieb auch das Meer auf der Fahrt zwischen Island und den Färöern.
Ins Odadahraun flüchteten die Gesetzlosen und Ausgestoßenen vor den Bewaffneten Dänemarks. Von See aus war diese Landschaft jenseits des erderschütternden Feuerbergs nicht zu sehen. Aber zwischen der Brandung und den bizarren Hängen der Berge erstreckten sich ebenfalls riesige Strecken leerer Landschaft, die sich jetzt in der Dunkelheit verbargen.
Die Seewölfe schliefen, wenn überhaupt, sehr unruhig. Mit jeder Seemeile, die sich die Schebecke von Island, der Insel aus Eis und Feuer, entfernte, schien sich die Lage ein klein wenig zu bessern – die Schebecke stampfte weniger, glitt mit scharfem Rauschen durch weniger harte Wellen, legte sich nicht so weit über. Trotzdem blieb es ein wilder und schneller Ritt über die Wellen des Nordmeeres.
Dan O’Flynn blinzelte in der Morgensonne. Für wenige Augenblicke waren Wolken und Seenebel aufgerissen und zeigten über dem winzigen, tief roten Sonnenball fahlblauen Himmel.
„Sollte das scheußliche Wetter etwa zu Ende sein?“ fragte er sich halblaut, sog tief die kalte, frische Luft ein und hoffte, daß der Kutscher und Mac Pellew ein kräftiges Frühstück zustande brachten. „Schön wär’s. Aber ich kann es nicht recht glauben.“
Die See schien sich beruhigt zu haben, denn das Schiff lag bei guter Geschwindigkeit wenigstens jetzt stabil vor dem Wind. Das Essen schien sicher zu sein.
„Ich glaube es auch nicht“, erklärte Pete Ballie, der vor einer Stunde das Ruder übernommen hatte. „Der Wind ist gut – noch.“
Er wehte bis zur Stunde aus dem westlichen Quadranten und wechselte nur seine Stärke.
„Er wird so bleiben, schätze ich“, meinte Dan. „Wir sollten in Lee der Färöer bleiben. Wenn wir nicht abgetrieben sind, müßten wir sie heute abend Steuerbord voraus zum erstenmal sehen.“
„An mir soll es nicht liegen“, sagte Pete und hob die Schultern. „In Lee, das ist gut. Dann sollten wir wohl ohne viel Aufregung auf Südkurs gehen können.“
„Sollten wir, ja. Hasard hat aber vielleicht etwas anderes vor.“
„Bis wir die Schafinseln erreichen, vergeht noch viel Zeit“, sagte der Rudergänger und stemmte sich gegen die Pinne. „Da kann noch viel passieren.“
„Da bin ich ganz sicher.“
Die Insel im Nordatlantik, gelegen im Dreieck zwischen Island, Schottland und Norwegen, waren keinem der Seewölfe besonders gut bekannt. Auch Dans Karten ließen an Deutlichkeit einiges fehlen. Die ungezählten Klippen, Schären und Inselteile waren langgezogen und zeigten von Nordwesten nach Südosten.
An den wenigsten Stellen, das hatte man den Seewölfen berichtet, gab es geschützte Anlegeplätze. Nahezu alle Klippen waren steil, zerklüftet und kaum besteigbar. Millionen von Seevögeln aller Arten nisteten hoch auf den schrundigen Felsen. Etwa siebzig Seemeilen, ließ sich aus der Karte herauslesen, betrug die größte Länge des Archipelagos.
„Das einzige, das sicher ist“, bemerkte Dan philosophisch, „ist, daß alles unsicher bleibt.“
„Hast du heute deinen klugen Tag?“ fragte Pete.
Dan nickte langsam. „Er hat gerade angefangen.“
Gerade eine Stunde lang überschüttete die Sonne das Meer und die gischtenden Wellenkämme mit ihrem roten Licht, das sich nach und nach gelb und schließlich weiß färbte. Dort, wo Island verschwunden war, zogen wieder schwarze Regenwolken auf. Sie wechselten ihre Farbe und wirkten so drohend wie immer, wenn sie sich aus dem Westen heranwälzten und das Licht aufzusaugen schienen.
„Du solltest dich gut festhalten“, rief Dan, nachdem er einen langen Rundblick auf die Dünung und den Horizont gerichtet hatte. „Das böse Nordmeer wird uns beweisen, daß es keinen Spaß versteht.“
Die Seefahrer kannten die Farben und deren Bedeutung, wenn sich die Wolken auf diese Art hochtürmten, wenn der Wind auf eine besondere Art schneidend zu heulen begann, und wenn er von den Wellen den Gischt fast waagerecht wegriß und in die Luft wirbelte.
„Es geht gleich wieder los“, knurrte Pete. „Hoffentlich haben wir noch Zeit, den Tee runterzuschütten.“
Jeder der Crew, der an Deck erschien, musterte die Segel, hörte das Knarren der Gaffelruten, warf einen besorgten Blick zum Himmel und zu den Wellen und sah ein, daß die nächsten Stunden hart werden würden. Daß auch der Wind in kurzer Zeit drehen konnte, hielten sie alle für möglich. So schnell wie es ging, aßen und tranken sie, dann bezog die Wache ihre Stationen. Die Mannen schlugen ihre Sorgleinen an.
Hasard enterte den Niedergang auf und winkte ab, als er in die sorgenvollen Gesichter schaute.
„Ich weiß“, sagte er. „Die ruhigen Stunden sind wieder vorbei. Ein Glück, daß wir Tageslicht haben.“
„Das wird sich auch bald ändern“, erwiderte Dan O’Flynn.
Es dauerte keine halbe Stunde, dann packten Wind und Brecher wieder das schlanke Schiff. Die Schebecke schwang sich auf den Kamm einer riesigen Dünungswoge, der Sturm wimmerte im stehenden und laufenden Gut, die Leinwand, mittlerweile völlig trocken, schien reißen zu wollen. Masten und Segel und der Schiffskörper verhielten sich, als spanne die Schebecke die Muskeln an.
Das Schiff schnitt vor dem achterlichen Starkwind rauschend und mit gurgelnder Kielspur durch das Wasser. Aber das war nur der Anfang einer rasend schnellen, gefährlichen Fahrt, die zwar die Stunden einer Reise verringerte, die Gefahren aber steigerte. Das gute Dutzend Seewölfe, das sich auf Deck bewegte, duckte sich, klammerte sich an Tampen und Spieren und bereitete sich auf schwierige Manöver vor.
Es war, als wäre die Schebecke in einen kreisförmigen Sturm, in einen Wetterwirbel geraten. Der Sturm heulte zuerst aus Westen heran, raste dann mit eisiger Kälte aus Norden, schließlich drehte er zurück auf Süd und zwang die Seewölfe, in zunehmender Dunkelheit in großen Schlägen zu kreuzen.
Selbst gegen Mitternacht war die Kraft des Sturms noch nicht gebrochen.
2.
Von Steuerbord prasselten Gischtflocken und Seewasser über das Schanzkleid. Der Wind ließ die Schebecke nach dieser Seite krängen. Die nächste Welle donnerte hohl gegen die Planken, stieg steil an ihnen aufwärts und kippte über Deck.
Breite Wasserflächen rannen auseinander und wuschen das austrocknende Salz von den Planken. Der Wind heulte in den Segeln und im Tauwerk. Mit Wind aus Nordosten kämpfte sich die Schebecke auf südlichem Kurs durch die Finsternis. Piet Straaten und Jan Ranse standen gemeinsam am Ruder, und auch die beiden Rudergänger hatten sich mit Sorgleinen gesichert. Die Schleier und Wirbel der Wassertropfen verdunkelten immer wieder die Flammen der Laternen.
Alles in dieser Nacht schien Stampfen, Schlingern und Lärm zu sein. Wer unbedingt an Deck sein mußte, hielt sich im Windschutz auf. Bill und Blacky stemmten sich gegen ein Süll und lehnten gegen das Schanzkleid. Dicht über ihre Köpfe zischte das Wasser.
Das letzte Segelmanöver war eine halbe Stunde her. Es würde sich so bald nichts an der Segelstellung ändern.
Jeder an Bord war sicher, daß sich das Schiff, vor Legerwall sicher, weit auf See befand. Island lag hinter der Kimm. Morgen, gegen Mittag, hatte Dan O’Flynn errechnet, sollten die Färöer recht voraus aus der See auftauchen.
Es war fast unmöglich, an Deck zu stehen, obwohl quer und längs Manntaue gespannt waren. Auch an ihnen lief das Wasser hinunter.
„Fehlt nur noch ein Seegewitter!“ brüllte Bill seinem Nachbarn ins Ohr. Ihre Segeltuchhüte hielten gerade noch die ärgste Nässe ab. Unter den hochgestellten Kragen bissen Schweiß und Salzwasser.
„Mir reicht’s auch so.“
Es war inzwischen kaum mehr zu unterscheiden, ob das Wasser über Deck nur Spritzwasser war, ein starker Regen oder beides. Im Augenblick war der Tropfenhagel so dicht, daß es sich wohl um Sturm und Regen handeln mußte. Die festgezurrten Culverinen auf der Kuhl zerrten an den Brooktauen.
Die Geräusche, mit denen sich die Schebecke durch das aufgewühlte Meer kämpfte, waren vertraut, obwohl sie sich mit unverminderter Lautstärke ständig wiederholten, wirkten sie beruhigend und einschläfernd. Ununterbrochen hob und senkten sich Bug und Heck, und ebenso ununterbrochen klatschten die Wasserberge auf das Deck hinunter.
Es wurde eine Spur heller. Die Tropfenwirbel um die Laternen rissen für einen langen Augenblick ab, und eine Art trügerische Ruhe kehrte für etliche Atemzüge ein.
Dann bohrte sich der Bugspriet wieder in die nasse Finsternis, und alles war wie zuvor. Die Finsternis füllte sich mit einem nicht abreißenden Hagel aus riesigen Wassertropfen.
Mit beiden Fäusten hielten sich Bill und Blacky an dem längs der Bordwand gespannten Tau fest. Trotzdem wurden sie von Zeit zu Zeit durch die Bewegungen des Schiffes hochgerissen, hingen für kurze Zeit in der Luft und krachten wieder schwer aufs Deck zurück.
„Sucht uns der Sturm? Oder haben wir ihn mal wieder gefunden?“ fragte brüllend Blacky.
„Er verfolgt uns. Weit und breit kein ruhiger Hafen.“
„Nein“, sagte Blacky und schluckte Wasser. „Und Thorshavn ist noch weit.“
Wieder duckten sie sich und versuchten, mit ihren Körpern die nächsten harten Bewegungen der Schebecke abzufangen. Sie schauten ab und zu nach achtern und erkannten schwach die Silhouetten der Rudergänger, die wahrlich keine leichte Nacht hatten. Einige Dutzend Atemzüge später stieß Bill seinen Nachbarn mit dem Ellbogen an.
„Was ist?“
Bill deutete schräg nach Steuerbord und schrie: „Die Fockschot!“
„Verdammt! Schnell, Bill!“ schrie Blacky und stemmte sich hoch. Die Leeschot hatte sich lose gearbeitet. Noch hielten die Kreuzschläge auf der Klampe, aber sie waren in der Dunkelheit nicht gut genug zu erkennen. Bevor das Dreiecksegel sich löste, die Schot brach oder etwas Schlimmeres passierte, mußte die Schot neu belegt werden. Als Blacky auf den Beinen stand, legte sich die Schebecke wieder weit über, richtete sich auf und schien in die nächste Welle springen zu wollen.
„Ich helf dir.“
Bill schwankte und taumelte ebenso wie Blacky. Sie versuchten, sich quer über die Breite des Decks über die Kuhl zu hangeln. Ihre Sohlen rutschten auf dem Deck, die Mischung zwischen Regen- und Meerwasser war glatt wie Eis. Mit beiden Händen klammerten sich die beiden an das Manntau, das straff gespannt war, aber unter ihrem Gewicht hin und her pendelte.
Handbreit um Handbreit, vor dem hart gespannten Lateinersegel, bewegten sich Blacky und Bill auf die Leeschot zu. Unter ihnen ächzten die Planken. Bill tauchte unter dem Sicherungstau hinweg und streckte die Hand nach der schlagenden Schot aus, um sich hinüberzuziehen. Er spannte die Muskeln und fühlte, wie ihm das Unterliek des Segels in den Nacken schlug. Sein rechtes Schienbein krachte gegen die Lafette der Culverine, und der jähe Schmerz ließ ihn aufschreien.
Er hielt sich fest, streckte sich und fluchte ingrimmig, bis der rasende Schmerz langsam abklang. Neben ihm schob sich Blacky heran und tastete nach dem Schanzkleid. Von Backbord wischte wieder ein Brecher über das Deck und traf beide Männer an der Schulter.
Nur wenig Licht aus der Hecklaterne und nicht viel mehr vom Buglicht fiel auf die Kreuzschläge und den Slipstek der Fockschot. Im nächsten Sturmstoß killte das Segel, die Schot wurde den beiden Männern aus den Händen gerissen.
„Festhalten, Blacky!“ brüllte Bill.
Er sicherte sich mit einer Hand und versuchte, das Ende zu belegen, das durch seinen breiten Gürtel lief. Blacky packte Bill mit dem linken Arm um die Brust. Gemeinsam kippten sie hin und her, nur durch die Enden ihrer Leinen gesichert, waren den Stößen ausgeliefert und schufteten verbissen und keuchend an der widerspenstigen Schot.
Irgendein Knoten löste sich, wahrscheinlich der des quergespannten Manntaus.
Die nächste Bewegung schleuderte beide Männer in das Segel. Die nasse, harte Wand aus Leinen prellte sie wieder zurück. Sie kippten rückwärts über den Lauf des verpackten Geschützes, ihre Finger glitten von den nassen Kardeelen des Tauwerks ab.
Der obere Rand des Schanzkleides schlug mit unwiderstehlicher Gewalt gegen ihre Rücken. Fest aneinandergeklammert gingen sie schreiend in der nächsten Welle über Bord. Noch im Fall versuchten sie, eines der wirbelnden und peitschenden Taue zu fangen.
Als sie in das kochende und brodelnde Wasser klatschten, ließen sie ihre Gürtel los. Das Wasser schlug schäumend über ihnen zusammen. Bill schluckte Wasser, vollführte einige hilflose Bewegungen und fühlte, wie er unter Wasser gedrückt wurde.
Wo war Blacky?
Unsichtbar rauschte die Schebecke an ihnen vorbei, weiter in die Nacht. Die Männer wurden wild umhergeworfen, untergetaucht und wieder an die Oberfläche gerissen.
Zuerst packte sie die Todesangst, als sie durch die gischtende Hölle gewirbelt wurden. Als sie auftauchten und zum erstenmal hustend und würgend wieder Luft holen konnten, merkten sie beide, daß sich im Inneren ihrer Jacken Luft gefangen hatte und sie leichter an der Oberfläche schwammen.
Zwei, drei Atemzüge später, von den Wellen umhergeschleudert, fingen sie an, wie rasend und brüllend zu rufen. Es gab keine Antwort, niemand hörte sie. Waren sie verloren? Hatten die Rudergänger nicht gesehen, daß zwei Mann abgekantet waren?
Sie hatten keine Gelegenheit, über etwas nachzudenken. Ihr Lebenswille besiegte fast sofort die Angst. Die Angst würde später zurückkehren, aber auch wieder verblassen, sobald die Erschöpfung einsetzte.
Seewasser brannte in ihren Augen, in den Nasen und im Mund. Sie schnappten keuchend nach Luft und versuchten zuerst, nicht unterzugehen. Ohne daß sie sahen, in welche Richtung, wurden sie davongewirbelt. Keiner hörte durch das Heulen des Windes und die Laute der Wellen den anderen rufen und schreien.
Strömung packte sie, zog sie hierhin und dorthin, trieb sie in irgendeine Richtung.
Die Langschäfter füllten sich mit Wasser. Zuerst war die See eiskalt gewesen, jetzt schien sich das Wasser zu erwärmen. Selbst in ihrem Zustand wußten Bill und Blacky, daß dies nicht so war. Der Luftvorrat in den Jacken, auch in den Taschen, hielt ihre Körper halb und die Köpfe ganz aus dem Wasser. Blind vom Salzwasser, taub vom Getöse der Wellen, mit schwindender Hoffnung und mit einem Rest Lebenswillen vollführten sie Schwimmbewegungen und glaubten zu spüren, daß sie sich tatsächlich in einer starken Strömung befanden, die sie mit sich zerrte.
Die Schebecke? Wo war das Schiff?
Es gab nicht einmal Mondlicht oder einzelne blinkende Sterne. In der grenzenlosen Finsternis der Sturmnacht im Nordmeer verloren sich auch die winzigen Lichter des Schiffes.
Nachdem die Rudergänger dreimal nach den beiden Männern gebrüllt hatten, wurde auch Hasard endgültig aus seinem Halbschlaf gerissen.
Er stürmte an Deck und schrie: „Was ist los? Wo sind die Kerle?“
Vom Grätingsdeck herunter, aus der halben Dunkelheit, tönte die Antwort Jan Ranses: „Keine Ahnung! Vielleicht unter Deck? Die Fock muß durchgesetzt werden!“
„Sie sind nicht unter Deck!“ brüllte der Seewolf zurück.
Hinter ihm tauchte Ben Brighton auf. „Und das Segel – Mann! Sie sind nicht da! Über Bord gegangen!“
„Wir haben sie nicht gesehen!“ schrie Piet Straaten.
Einige Atemzüge lang herrschte äußerste Verwirrung. Dann sicherten sich der Erste und Batuti. Sie holten die Fock wieder dicht und belegten die Schot neu.
Fieberhaft dachte der Seewolf nach, während unter Deck noch einmal nach Bill und Blacky gerufen und gesucht wurde. Beidrehen? fragte er sich. Mann über Bord, gleich zwei seiner Seewölfe? Mitten in der schwärzesten Finsternis? In Wirklichkeit hatte bei diesem Sturm keiner, der über Bord gegangen war, eine Chance des Überlebens.
Es mußte alles unternommen werden, was den beiden helfen konnte.
Der Seewolf schrie: „Bringt mehr Laternen. Vielleicht sehen sie uns doch noch.“
„Aye, Sir“, erklang es aus dem Niedergang. „Sofort.“
Der Sturm heulte und rüttelte an der Takelage. Es war höllisch gefährlich, in den Wind zu gehen.
Aus dem Schiffsinneren rief Big Old Shane: „Unter Deck sind sie nicht, Sir! Willst du sagen, sie sind tatsächlich dort draußen …?“
„Ja. Vielleicht leben sie noch.“
Die Rudergänger versuchten, einen Kurs durch die Kreuzseen zu finden, der das Schiff nicht so sehr umherwirbelte und hin und her warf. Die Seewölfe schwankten mit brennenden Laternen über Deck und bändselten sie an. Hin und wieder versuchten sie, über das Schanzkleid zu peilen, aber schon während sie in die Dunkelheit starrten, wußten sie, daß sie nichts und niemanden sehen würden.
Aber jetzt bildete die Schebecke tatsächlich eine leuchtende Insel in der Dunkelheit.
„Können wir’s riskieren?“ brüllte Jan Ranse und winkte.
„Wir müssen!“ rief der Seewolf. „Klar zum Beidrehen! Vielleicht sehen wir sie.“
Die Crew eilte übers Deck. Die Schebecke schwang sich in die Höhe und sackte wieder in die Wellentäler, aber sie wurde nicht in wilden Rucken umhergeschleudert. Langsam schwang das Heck herum. Die Wellenkämme waren die einzigen helleren Flecken und Streifen, die man von Bord aus erkennen konnte. Die Seewölfe schrien in alle Richtungen, dann hielten sie den Atem an und versuchten, eine Antwort zu hören.
Es gelang Al Conroy sogar, zwei Drehbassen abzufeuern. Sie entluden sich mit grellen Feuerstrahlen und dumpfen, aber überraschend lauten Explosionen.
„Sie werden es nicht schaffen“, sagte Ben Brighton zu Hasard. „Wenn sie uns sehen, dann können sie nicht gegen die Wellen anschwimmen.“
„Wir müssen sie rausfischen!“ stieß Hasard hervor. „Wir können sie nicht einfach aufgeben.“
Er gab seine Befehle, nachdem er zu berechnen versucht hatte, in welche Richtung Sturm, Wellengang und Strömung die beiden Männer mitgerissen hatte. War es wirklich so? Oder irrte er. Die Schebecke schwang wieder herum, legte sich nach Backbord und dann Steuerbord über und stampfte dorthin, wo die Seewölfe ihre Freunde vermuteten. Drei Mann standen vorn mit Wurfleinen, selbst mit dicken Leinen gesichert.
Wieder schrien sie die Namen der Verschwundenen.
„Keine Antwort. Es ist sinnlos“, brummte Hasard zu sich selbst redend. „Aber wir suchen, bis es hell wird.“
Er kletterte, selbst in Schwierigkeiten, sich festzuhalten, zum Kompaß hinauf und beobachtete die Nadel über der Rose. Die Schebecke bewegte sich auf einem seltsamen und gefährlichen Kurs in südliche Richtung. Wahrscheinlich würden die Färöer beim ersten Licht an Backbord voraus auftauchen.
„Sagt es weiter!“ brüllte er auffordernd, obwohl er ahnte, daß Bill und Blacky vermutlich sterben würden – wenn sie nicht schon ertrunken waren. „Wir suchen zunächst weiter, bis es hell wird! Dann können wir vielleicht in Thorshavn Hilfe erhalten.“
„Verstanden“, antwortete Ben. „Habt ihr verstanden, was Hasard sagt?“
„Aye, aye, Sir.“
Wie ein Stück Holz tanzte die Schebecke auf den Wellen, und immer wieder hob sich der Bug aus dem Gischt. Die Arwenacks kämpften mit ihrem Schiff um jede Fadenlänge der Strecke. Der Sturm tobte mit wechselnder Wut und aus drehenden Richtungen bis zum Morgengrauen.
Als sich die Wolken schwarz gegen den grauen Himmel abhoben und das Meer wieder grau und grün von der Heckspur durchschnitten wurde, suchten alle Seewölfe mit rotgeränderten, tränenden Augen die Wasserfläche ab.
Was sie erwartet hatten, traf ein: weder von Bill noch von Blacky gab es eine Spur. Aber sie fanden auch keine bewegungslos treibenden Körper in hellen Segeltuchjacken.
Blacky konnte nicht mehr denken. Er spürte nur unablässig, daß etwas mit ihm passierte. Eins wußte er: er lebte – noch.
Die Kraft des Wassers und der Wellen zog seine Glieder auseinander und stauchte sie wieder zusammen. Als er begriff, daß er in diesen chaotischen Kreuzseen vielleicht überleben konnte, unterstützte er dieses Ziehen und Stauchen durch eigene Bewegungen. Er hielt sich über Wasser und zwang sich dazu, das Salzwasser auszuspucken und langsam, überlegt, die Luft einzuziehen und auszublasen.
Die Finsternis um ihn herum war vollkommen. Es gab weder Licht noch irgendeinen Widerschein der Sterne oder des Mondes. Blacky erkannte nicht, wohin er schwamm, und in welche Richtung ihn eine Strömung riß, die er zu spüren glaubte.
Er verlor zuerst das Gefühl für Zeit. War er vor einer Stunde oder vor zwei Dutzend Atemzügen über Bord gegangen?
Er zwang sich, richtige Schwimmzüge auszuführen, bis sich der Körper daran gewöhnt hatte und nahezu mechanisch in Bewegung blieb. Blacky begriff, daß ihn die Luft in der dicken gewachsten Kleidung wärmte und an der Oberfläche hielt. Irgendwann würde das aber vorbei sein.
Er hob den Kopf und versuchte, die Schwärze voraus mit seinen Blicken zu durchdringen. Sie mußten es gemerkt haben. Warum unternahmen sie nichts? Lichter setzen, nach ihm und Bill suchen, schreien und mit den Geschützen Signale geben?
Nichts. Nur pechschwarze Finsternis und das Heben und Senken, Umherwirbeln und Zusammenbrechen der Wellen.
„Warum ausgerechnet ich? Warum wir beide?“ keuchte er.
Wieder spuckte er salziges Wasser aus und versuchte mit aller Kraft, seine Panik zu unterdrücken. Er mußte die winzigen Möglichkeiten, die er hatte, richtig ausnutzen.
Er mußte am Leben bleiben!
Bei Tageslicht würden ihn die Freunde suchen und finden. Ihn und Bill. Der Seewolf würde auf keinen Fall weitersegeln und seine Leute einem nassen, tödlichen Schicksal ausliefern. Darauf konnte sich Blacky mit absoluter Sicherheit verlassen.
Später merkte er, daß er tatsächlich von irgendeiner Strömung gepackt worden war. Sie zog ihn mit sich. Immer dann, wenn er versuchte, blind der nächsten Welle auszuweichen oder zu verhindern, daß sie genau über seinem Gesicht brach und ihn mit Wasser und Gischt überschüttete, drehte sich sein Körper in die alte Lage zurück und wurde durch das Wellental gezogen. Aber das Vorhandensein einer Strömung besagte nicht, daß sie ihn an einen Ort brachte, der Rettung bedeutete.
Vielleicht riß sie vor England ab, vor Norwegen oder Skagen. Alles war denkbar, alles war wahrscheinlicher als eine Insel recht voraus. Er würde treiben, bis er von der Kälte des Wassers bewegungsunfähig geworden war, bis er einschlief und ertrank.
Er wollte leben!
Unaufhörlich kämpfte er mit sich selbst. Er kämpfte gegen die Versuchung an, aufzugeben und sich treiben zu lassen, in dieser spürbaren Strömung. Er kämpfte gegen die Wellen und gab es schließlich auf, weil er erkannte, daß sich die Wellen innerhalb bestimmter Grenzen bewegten. Und er kämpfte – das war für ihn das Schwierigste – gegen seine verzweifelten, sinnlosen und sich überschlagenden Gedanken an. Er fing an, laut mit sich selbst zu sprechen.
„Wenn ich das überlebe“, schrie er in den heulenden Sturm, kriegte den Mund voller Wasser und spuckte es hustend und würgend wieder aus, während Hitzewellen durch seine Glieder rannen, „wenn ich überlebe, werde ich mich Ironman nennen!“
Er verstand, daß er dazu jedes Recht hatte. Wenn er überlebte. Wahrscheinlich war er in ein paar Stunden tot.
Oder vielleicht sehr viel früher, wenn der riesige Ozean des Nordmeeres die letzte Wärme aus seinem Körper gesogen hatte.
Auf diese Weise verging die Zeit.
Waren es Atemzüge, Stunden oder Jahre? Bei dem Versuch, die Zeit auszurechnen, verwirrten sich Blackys Gedanken, und an seinem inneren Auge zog sein Leben vor ihm vorbei. Es war farbig, wahrheitsgetreu und außerordentlich genau.
Vom Waisenhaus, wo man ihn wegen seiner etwas bräunlichen Haut den Namen Blacky gegeben hatte, wohl auch wegen der dunkelbraunen Augen und der schwarzen Haare, bis zu dem Tag, an dem er an Bord der „Marygold“ aufgewacht war, in den Dienst unter Francis Drake gepreßt, über die schönen Tage und Nächte in vielen Teilen der Welt, die er an Bord der „Seewolf“-Schiffe verbracht hatte, bis zur heutigen Nacht.
Er verlor die Besinnung.
Sein Körper trieb in den Wellen, wurde herumgewirbelt, unter Wasser gedrückt, über den Gischt hinausgehoben und von einer starken, seltsamen Strömung mitgerissen.
Irgendwann kam er wieder zu sich.






