Seewölfe Paket 31
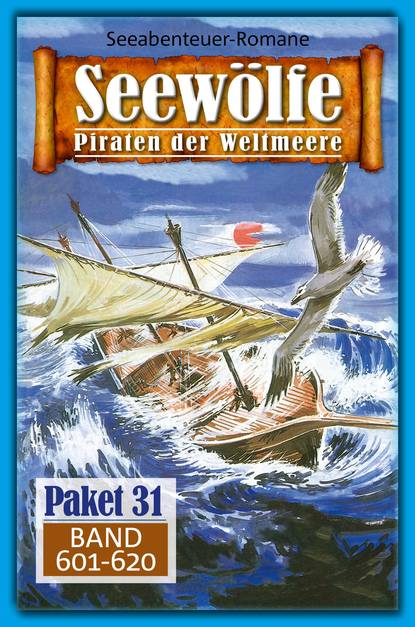
- -
- 100%
- +
Er blinzelte mit roten, salzverkrusteten Augen. Noch immer – oder schon wieder? – war Nacht. Schwach und ohne sich danach richten zu können, nahm Blacky wahr, daß sich etwas verändert hatte. Die Geräusche waren anders geworden. Es gab ein Echo, einen Widerhall, etwas, das ihn zu anderer Zeit in helle Aufregung versetzt hätte.
Aber Blacky war zu schwach. Er spürte nicht mehr, ob er sich bewegte oder herumgeworfen wurde. In seinen Ohren dröhnten überlaut die Geräusche und deren Widerhall. Zischen und Poltern, Krachen und ein schauerliches Wimmern, in das sich schrille Schreie mischten.
Dumpf merkte er, wie seine Gedanken schwanden, als würden sie von einem riesigen schwarzen Loch aufgesogen. Gleichzeitig hob eine unwiderstehliche Kraft seinen Körper, dessen Glieder kraftlos schlenkerten, in die Höhe und ließ ihn wieder fallen. Übelkeit packte ihn, er würgte Wasser heraus, ohne es zu merken, und als er wieder scheinbar senkrecht aufwärts gerissen wurde, hustete und würgte er, schnappte nach Luft und schwankte zwischen Erwachen und dem Augenblick, in dem der letzte Lebensfunken seinen Körper verlassen würde.
Blacky lebte noch, als ihn die nächste Brandungswelle packte.
Sie stieg senkrecht an einer riesigen, schwarzen Felswand hoch, erreichte ein breites Sims und zerfetzte in Gischt und Wasserfluten, die durch die Spalten prasselten, das Sims überfluteten und langsam wieder abflossen. Der schwere Körper wurde gegen die Felsen geschleudert, überschlug sich und blieb in der Kante zwischen Sims und senkrechter Wand liegen.
Über Blacky fingen große Vögel, die in Spalten nisteten, aufgeregt zu kreischen an.
Aber Blacky sah und hörte nichts mehr.
Gegen Ende der Nacht erreichten die Wellen an diesem Teil des Strandes ihre größte Höhe und Wucht.
Zwischen den Inseln, wo die Brandung riesige Felsblöcke herausgerissen und neunzig Fuß weit auf den Strand geschleudert hatte, brachen sich die Wellen, und als die riesige Brandungswoge zurückflutete, ließ sie am dunklen Strand aus Sand und Geröll eine leblose Gestalt zurück.
Es war in dieser Nacht die schwerste, höchste und kräftigste Welle gewesen, denn die nachfolgenden liefen mit zischenden Schaumstreifen zehn Fuß vor der Gestalt aus.
Die Insel, zu drei Vierteln eine Tafelbergfläche, bestand aus zwei Dritteln schroffer Felsabstürze. Das letzte Drittel fiel als grasbewachsener Hang zum Meer hin ab und endete in einem wild gezackten Strand.
Vor undenklich weit zurückliegender Zeit schien die Insel aus der Tiefe der Erde aufgetaucht zu sein. Die Schichten des Gesteins waren schon im ersten grauen Licht der schwindenden Nacht zu erkennen. Tuffstein und Basalt wechselten mit verwitterten Lavamassen ab. Der Sand war grobkörnig und dunkel. Zwischen der riesigen Mauer aus Treibgut ragten kantige, schrundige Steintrümmer in die Höhe.
Wieder rauschte eine Brandungswelle heran, kippte und überschlug sich und wirbelte die Sandkörner am Strand durcheinander. Zwischen den senkrechten Wänden der Insel pfiff der Sturm mit schneidender Kälte heran. Die Gestalt mitten im Wall aus Treibholz, feuchten Algen und toten Fischen bewegte sich nicht, nur der Sturm fuhr in das nasse, dunkelblonde Haar und trocknete es.
Im ersten Licht fing die Insel plötzlich zu leben an. Über die Kante des Taleinschnitts tappte langsam eine kleine Herde Schafe. Aus zahllosen Löchern in den Steilklippen flatterten Vögel auf und gingen auf die Jagd und auf Futtersuche. Gellende Schreie ertönten, das Klagen der Möwen, die Laute von Baßtölpeln, Luramen und Alken.
Die Vögel flatterten in dem Sturm, der abblätternde Steinteilchen von den Klippen riß. Um die einzeln stehenden Felsnadeln, oft hundertfünfzig Fuß hoch, gurgelte der Wind ebenso drohend wie entlang der weniger schroffen Strände. Hin und wieder jagte er einen Nebelfetzen zwischen den Inseln hindurch. Der Himmel blieb dunkelgrau, im Dunst waren einzelne Wolken nicht mehr zu unterscheiden.
Die Gestalt bewegte sich, als der Wind abflaute.
Zwischen diesem Teil der Inselwelt beruhigte sich das Meer. Bill zog das rechte Bein an, bewegte seine Arme und zog mit den gespreizten Fingern tiefe Rillen in den Sand.
Er hob den Kopf, schüttelte sich und fing sofort zu zittern an. Ganz langsam kam er in die Höhe und blieb auf den Knien und den Ellbogen. Er zuckte zusammen und kippte zur Seite. Bill zog die Knie an die Brust, schob die Hände tief zwischen die Knie und zitterte noch stärker. Seine Zähne schlugen klappernd aufeinander. Wie ein verwundetes Tier robbte er weiter, vom Wasser weg, mitten durch Tang und Algen und bleichgescheuertes Holz. Er wußte nicht, was er tat, aber er unternahm genau das Richtige. Er hinterließ eine zwanzig Fuß lange Zickzackspur, ehe er wieder ohnmächtig zusammenbrach.
Der Schmerz weckte ihn auf. Glühende Stiche fuhren durch seine Haut. Er hob mit blinden Augen die Hände und bedeckte sein Gesicht damit. Jetzt zuckte der Schmerz durch seine Finger.
Blacky gewann das Bewußtsein, als er abwehrende Bewegungen ausführte und zusammenzuckte, weil etwas genau in seine Ohren schrie.
Es dauerte unendlich lange, bis er die drei Möwen erkannte, die um seinen Kopf flatterten und nach seinen Augen hackten. Er handelte instinktiv, packte einen Vogel und hieb mit dem flatternden, kreischenden Ding nach den anderen. Sie flüchteten, und er schleuderte die Möwe kraftlos von sich.
Dann holte er tief Luft und schaute sich um. Er begriff in qualvoller Langsamkeit, wo er sich jetzt befand.
Er hockte etwa dreißig Fuß über der Brandung. Von hier aus sah er weit auf die dunkelgrauen Wellen hinaus, von denen der Sturm die Schaumkronen wegriß. Rechts endete das fünf Fuß breite, trümmerübersäte Sims an einem überhängenden Abhang aus schwarzem, nassem Gestein, auf denen der Kot unzähliger Vögel breite Spuren hinterlassen hatte.
Dann sah er die vielen Vögel.
Sie landeten über ihm, und von dort flogen sie auch auf. Die meisten flatterten hinaus auf die See und fischten, indem sie sich ins Wasser stürzten. Durch das Winseln des Windes ertönten ihre Schreie, und je mehr sich Blackys Gedanken klärten, desto deutlicher und lauter wurde das Vogelgeschrei.
„Ich bin also doch ein Ironman“, stieß er hervor.
Als er versuchte, sich an den schrundigen Felsen in die Höhe zu ziehen, überfielen ihn die Schmerzen. Jeder Teil des Körpers schmerzte. Unter den Jackenärmeln sickerte Blut hervor. Als er sich über das Gesicht strich, spürte er, daß die Schnäbel der Vögel die verschorften Wunden und Schnitte wieder aufgerissen hatten. Auch die Handflächen waren blutverschmiert.
Mit zitternden Knien stand er schließlich, hielt sich am Felsen fest und drehte den Kopf nach links.
Der Einschnitt in der steilen Wand ging weiter. Vorsichtig setzte er einen Fuß vor den anderen. Ihm war übel wie nie zuvor in seinem Leben. Er fror, seine Haut war fast gefühllos geworden. Die Augen brannten, und die Lippen waren aufgerissen. Als er stöhnend den Kopf in den Nacken legte und nach oben schaute, sah er, daß es zwei- oder dreihundert Fuß senkrecht in die Höhe ging.
Hunger, Durst, Kälte und Erschöpfung ließen ihn taumeln. Mit beiden Händen klammerte er sich an den vorstehenden Felsplatten an und krallte sich in die Spalten. Von unten dröhnte das Donnern einer schweren Brandung herauf.
Er lebte. Er hatte sich irgendwie retten können. Aber als er den Abgrund neben sich sah und erkannte, wie weit entfernt das Meer dröhnend gegen den Fuß der Felswand schlug, schüttelte er den Kopf.
Er konnte sich nicht vorstellen, daß er hierher aus eigener Kraft gelangt war. Die kleinste Bewegung rief stechende Schmerzen hervor. Blacky wankte weiter auf dem Sims. Er stolperte über Steinbrocken, und in den blutenden Schnitten seiner Haut brannte das ätzende Wasser, das mit Guano durchsetzt war.
Das trümmerübersäte Sims, einmal breit, dann wieder gefährlich schmal, folgte den Vorsprüngen und Spalten des Steilfelsens. Ungefähr zweihundert kleine Schritte weit schleppte sich Blacky auf diesem Weg, und ebenso langsam gelangte er zu sich.
„Jetzt mußt du zeigen, Ironman, was du kannst“, murmelte er und lehnte sich schwer gegen den nassen schwarzen Fels.
Der schmale Weg war zu Ende. Direkt vor seinen Stiefelspitzen fiel der Abgrund senkrecht bis zum Wasser.
Links vom Absturz sah Blacky einen schrägen Spalt, tief eingeschnitten und angefüllt mit wuchtigen Felsblöcken. Der Spalt schien bis zum Ende der Felsen hinaufzuführen.
„Der einzige Weg“, murmelte Blacky.
Das Blut strömte schneller durch seinen zerschlagenen, zerschundenen Körper. Trotz der triefend nassen Kleidung und des schneidenden Windes wurde es an einigen Stellen der Haut warm. Dort nahmen die stechenden Schmerzen noch zu, aber sie hielten ihn wach. Er mußte Wasser finden und etwas in den Magen kriegen. Er sprach sich selbst Mut zu und enterte den Spalt. Mühsam zog und kletterte er um die Felsen herum, suchte Griffe und Spalten für seine Hände und Fußspitzen.
Der Spalt war nicht sonderlich steil, aber schwer zu erklettern. Keuchend und in Schweiß gebadet zwang sich „Eisenmann“ um die Blöcke herum, rutschte immer wieder ab und schlug sich Knie und Schienbein blutig, fluchte und zog sich von Absatz zu Absatz.
Ständig mußte er die gierigen Möwen abwehren. Die meisten anderen Vögel kümmerten sich nicht um ihn. Schließlich, in der oberen Hälfte der kleinen Schlucht, lief ein dünner Strahl Wasser über den dunklen Stein und plätscherte über die Kante, die wie eine Nase geformt und verwittert war.
Blacky legte den Kopf schief und ließ den Wasserstrahl zwischen die Lippen rinnen, schluckte und trank, bis er nicht mehr konnte. Dann ließ er Wasser in seine hohle Hand laufen und wusch sich sooft wie möglich das Salz aus dem Gesicht und dem Haar.
„Also“, murmelte er und fühlte sich ein wenig besser. „Verdursten kann ich nicht mehr.“
Mit jedem Fußbreit, den Blacky auf seiner mühsamen Klettertour schaffte, spürte er seine Erschöpfung deutlicher und stärker. Aber das Klettern lenkte ihn ab.
„Kann das sein?“ fragte er sich und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht, wobei er die Hälfte der verkrusteten Wunden wieder aufriß. „Sind das die Färöer?“
Er wußte von Dan, daß die Färöer, die Schafinseln, weit und breit das einzige Stück Land in diesem Nordmeer waren. Es war denkbar, daß der letzte Sturm sie sehr viel weiter über die Wellen gejagt hatte, als Hasard und Dan O’Flynn ausgerechnet hatten. Blacky schüttelte den Kopf, als könne er die Müdigkeit dadurch verscheuchen und krallte sich in den Fels, mitten in einem Schwarm von Lummen oder anderer Vögel. Noch fünfzehn Fuß, dann hatte er die Kante erreicht.
Als er sich umdrehte, zuckte er zusammen. Er hatte nicht gedacht, daß er so hoch hinaufgeklettert war. Seine Fingerspitzen bluteten. Mindestens zweitausend Fuß hoch!
Er blickte weit hinaus über das Meer.
Kein Schiff in Sichtweite. Von der Schebecke keine Spur. Soviel Glück hatte er also nicht. Und wo er sich wirklich befand, ob er auf der Insel überleben konnte, das würde sich zeigen.
Mit letzter Kraft stemmte er sich hoch, kletterte, wich scharfen Kanten aus und schlug nach den aufgeregten Möwen, die schrien und nach ihm hackten.
Dann kippte er über die letzte Kante. Bisher hatte er sich in Lee befunden, jetzt pfiff der Wind wieder über seinen Kopf. Er schaute geradeaus.
„Ironmans Insel“, flüsterte Blacky.
Vor ihm dehnte sich eine große, fast völlig ebene Fläche aus, die in jene Richtung, in die er blickte, leicht abfiel. Halbmondförmig zeigten sich die Nester Tausender von Vögeln entlang der Felskante. Dürres Gras war zu sehen, aber meist hockten die Vögel auf dem blanken Fels. Weiter weg, in der Mitte der langgezogenen Hochfläche, sah Blacky dunkelgrünes Gras wuchern.
Er schleppte sich über die Kante, ging ein Dutzend Schritte mit wackligen Knien und stolperte. Er fiel auf die Knie und die ausgestreckten Hände. Die Erschöpfung hatte ihn wieder eingeholt. Übergangslos schlief er ein und verkroch sich instinktiv in die schwere, starre Segeltuchjacke.
3.
Philip Hasard Killigrew hatte die tiefen, schwarzen Fjorde zwischen den langgestreckten Inseln abgesucht, jeden Quadratfuß, als das Schiff auf West-Ost-Kurs an Kalsö, Kunö und Viderö vorbeigesegelt war. Jetzt, nachdem die Schebecke in Lee der Insel Fuglö auf Südkurs gegangen war, hatten sich das Meer beruhigt. Seit Stunden hatten die Seewölfe kaum etwas anderes getan als das Wasser, die Brandung und die riesigen, drohenden Klippen abzuforschen.
„Man sagt, es seien die höchsten Huks der Welt“, murmelte Dan O’Flynn und ließ das Spektiv sinken.
„Schon möglich. Ich denke dran, daß dort vielleicht Bill und Blacky ihre Knochen zerschmettert haben“, antwortete Hasard. „In Thorshavn finden wir Leute, die uns suchen helfen, nicht wahr?“
„Ganz bestimmt, Sir.“
Die Seewölfe hatten begriffen, daß die Stürme und die riesigen Wellen vor den nördlichen Felsabstürzen keineswegs von Riffen oder Schären gebremst wurden. Während die Kraft des Wassers und des schmirgelnden Sturms, von Eis, Regen und Salz die helleren Gesteinsschichten lockerte und wegschliff, widerstand der schwarze Basalt. Die Küstenlinie bestand aus nichts als wilden, zackigen und kantigen Formen, die jedem Seemann das Fürchten lehren konnten.
„Svinö querab, Sir! Nichts zu sehen von Blacky oder Bill!“ rief Carberry vom Vorschiff her.
Die Schebecke lag ruhig und lief gute Fahrt. Kurz nach Anbruch der Helligkeit und zur selben Zeit, als sich aus dem Morgennebel die wuchtigen Umrisse der nördlichen Inselkanten hervorschoben, war die Wucht des Sturms gebrochen.
„Verstanden, Ed!“ rief der Seewolf zurück. „Weiterhin Ausschau halten!“
„Aye, Sir.“
Die Irrfahrt in der Nacht hatte die Schebecke, ohne daß etwas zu sehen gewesen wäre, in die unmittelbare Nähe der Färöer gebracht. Irgendwo zwischen den achtzehn Inseln waren die Körper an den Strand oder auf die Felsen geschmettert worden oder trieben in der Strömung, der die Seewölfe gerade noch entgangen waren.
„Sie sind tot, Dad“, sagte Jung Hasard. „Niemand hält es im kalten Wasser lange aus.“
Sein Vater schüttelte den Kopf. Er wollte es nicht glauben, obwohl ihm die Erfahrung sagte, daß sein Sohn und die Mehrzahl der Crew recht haben mußten.
„Als Blacky und Bill über Bord gingen“, sagte Hasard, „waren sie verdammt nahe an diesen Inseln.“
Er zeigte nach Nordwesten, dorthin, wo sich die Schebecke in der Nacht während der Suche, mit kurzen Schlägen kreuzend, durch den Sturm gekämpft hatte.
„Du meinst, sie haben schwimmen können? Sie haben irgendwo die Küste erreicht? Einen Felsen, eine Bucht?“
Hasard nickte seinem Sohn zu. „Ja. Das ist möglich. Vielleicht war die Strömung ihre Rettung. Entweder finden wir sie lebend, oder wir finden ihre Leichen.“
Hasards Stimme verriet seine Entschlossenheit. Sie waren schon ein paar Male hart an die drohenden Vogelklippen herangefahren und hatten Ausschau gehalten. Aber außer toten Vögeln, Federn und Treibgut war nichts zu sehen gewesen, das auf Bill oder Blacky hingedeutet hätte.
Nach einer Weile brach Hasard wieder sein nachdenkliches Schweigen.
„Die Leute von Thorshavn werden uns helfen. Sie sind gute Seefahrer. Ich weiß, daß wir Blacky und Bill finden – lebendig oder …“
Er sprach nicht weiter, hob das Spektiv wieder ans Auge und fuhr fort, die Wellen und die Ufer abzusuchen.
Gegen Mittag wachte Bill auf und fror jämmerlich. Er taumelte auf die Füße und warf unsichere Blicke in alle Richtungen. Er sah nichts, woran er sich halten konnte: kein Wasser, kein Essen, keine Hütte. Er war am Leben, aber auf einer menschenleeren Insel gestrandet.
Auch dort, wo sich das Wasser langsam vom Strand zurückzog, gab es keine Spuren davon, daß hier Menschen lebten. Keine Boote, keine Netze, keine Reste eines Stegs, soweit Bill den Strand überblicken konnte.
„Ich bin am Leben“, sagte er laut, nur um eine Stimme zu hören. „Aber das Schwierige kommt erst.“
Bill wankte weiter vom Strand weg und auf das erstaunlich sattgrüne Gras zu.
„Feuer“, murmelte er nach einer Weile.
Holz gab es genug. Der flache Strand war von Treibholz übersät. Er erinnerte sich an die Methoden, auf einfache Art Glut und Feuer zu erzeugen. Zuerst mußte er eine Quelle oder einen Tümpel voller Süßwasser finden.
Er hob den Kopf, als er plötzlich ein Geräusch hörte, das nicht in das Rauschen der Brandung, das auf und abschwellende Wimmern und Jaulen des Windes und das Geschrei der vielen Vögel paßte.
„Das sind – Schafe!“ stieß er halb erschrocken, halb verblüfft hervor.
Die nasse Kleidung scheuerte auf der Haut, als er auf die Tiere zuzurennen versuchte. Sie sprangen blökend davon und den Hang hinauf. Nach einigen Schritten gab Bill auf. Überall dort, wo sich Salz abgesetzt hatte, riß die Haut auf und schmerzte. Zwischen den Tieren sah er keine kleinen Lämmer, also war es sinnlos, angesichts der halbwilden Tiere an fette Schafsmilch zu denken.
Oder doch nicht? Er wußte es nicht. Er war Seemann, kein Schäfer.
Aber die Schafe führten ihn vielleicht zum Süßwasser. Während er versuchte, die schwere Jacke auszuziehen, stolperte er schwankend hinter den Tieren her. Der Hunger wühlte in seinen Eingeweiden. Der Durst wurde übermächtig, aber Bill zwang sich, nicht aufzugeben.
Auf seinem Weg schaute er sich immer wieder genau um. Vielleicht fand er etwas, das ihm helfen konnte. Er sah noch mehr Treibholz und all das, was das Meer nach langer Irrfahrt ans Ufer spült. Aber es waren weder Töpfe noch Kessel darunter. Im Zickzack sprangen die Schafe den Hang hinauf und beäugten mißtrauisch den Eindringling. Auch gab es weder Zäune noch Gehege, nicht einmal eine verfallene Hütte.
„Die Färöer sind dänisch“, brummelte Bill. „Gut, daß es hier keine Dänen gibt. Da brauche ich nicht auf Nils zum Dolmetschen zu warten.“
Endlich hatte er das starre, salzverkrustete Zeug von den Schultern. Er zog die Jacke hinter sich her und versuchte sich zu erinnern, was er in den Taschen hatte. Glücklicherweise – und das war für ihn noch seltsamer als der Umstand, daß er überlebt hatte – schien kein Knochen gebrochen. Aber jeder Muskel schrie auf, wenn er bewegt wurde.
In halber Höhe des Hanges entdeckte Bill im Gras einen dunklen Zickzackstreifen. Er bewegte sich darauf zu und erkannte schließlich, daß es sich um Wasser handelte. Ein Wasserlauf, der von der Hochfläche kam und hier versickerte.
„Noch zwanzig Schritte …“, keuchte er, dann fiel er vornüber und schob mit zitternden Händen das Gras auseinander. Darunter war weißes Geröll und glatter Fels, über das Wasser lief.
Bill trank mit einer Hast und Gier, die ihn überrascht hätte, wenn er es gemerkt haben würde. Er schöpfte mit beiden Händen das eiskalte Wasser an die Lippen und trank, so schnell und so viel er konnte. Keuchend hielt er inne, als er nicht mehr konnte.
Obwohl seine Finger vor Kälte zitterten, wusch sich Bill das Salz aus dem Gesicht und dem stacheligen Bart, streifte die Ärmel hoch und tauchte die entzündeten, roten Unterarme ins Wasser. Er schrie, als der Schmerz einsetzte.
„Verdammt! Gut, daß mich keiner hört und sieht.“
Wieder trank er und fühlte, wie langsam, trotz der erbärmlichen Kälte, das Leben in ihn zurückkehrte. Das Wasser, das in seinen Bauch gluckerte, verdrängte das nagende Hungergefühl.
„Ich brauche einen Überblick“, sagte er zu sich und stapfte weiter hangaufwärts.
Die Schafe sprangen nach links weg und fingen in sicherer Entfernung zu grasen an. Bisher hatte Bill noch nicht einen einzigen Baum gesehen. Wahrscheinlich gab es überhaupt keine Bäume auf den Schafsinseln.
Obwohl jede Bewegung eine neue Anstrengung bedeutete und der Schmerz in den vielen offenen Wunden biß, schleppte sich Bill vorwärts und aufwärts und gelangte zwei Stunden später auf den höchsten Punkt der Insel.
Er stand sehr weit im Süden und war auf den größeren der beiden Strände geworfen worden. Direkt unter ihm, am Ende einer langen Gefällstrecke, ragte eine Landzunge flach ins Meer.
Alle anderen Teile der Insel, soweit er dies sehen konnte, fielen mehr oder weniger steil ab. Die Insel war langgezogen und reichlich schmal. Ihre Felsenmasse zeigte in Nordsüdrichtung. Obwohl über dem Wasser leichter Nebel lag, konnte Bill im Westen eine weitaus größere Insel erkennen, und im Osten ragten ebenfalls unterschiedlich große Felsmassen aus dem Nordmeer. Er kannte den Namen der Insel nicht, auf der er zu überleben gezwungen war.
„Den einen Strand kenne ich schon“, murmelte er.
Er wußte auch, wo es Wasser gab, also sollte er sofort den anderen Flachstrand untersuchen. Beide Teile waren durch wuchtige, weit vorspringende Felsformationen voneinander getrennt, und nur auf dem Wasserweg war eine Verbindung zwischen ihnen möglich.
Bill begab sich auf den Weg hinunter und ging an ein paar Nestern vorbei, in denen Eier lagen. Er bückte sich, wehrte die Vögel ab und hob ein Ei auf. Als er es schüttelte, meinte er, daß es noch warm und vermutlich frisch gelegt war.
Er drückte die Schale auf, verzog angewidert das Gesicht und trank das Ei leer. Die glitschigen Reste warf er nach einem Vogel, der ihn attackierte.
„Es gibt Besseres“, murmelte er, aber der Trost blieb zurück, daß er nicht verhungern würde. Hatte er erst einmal ein Feuer, würde er die Vögel fangen und braten können.
Bill entdeckte auf halber Höhe eine Höhle. Ein tiefer Spalt in den Felsen war durch überhängendes Gestein geschützt. Wollreste, Schafsmist, ein paar Knochen und die Reste einer Feuerstelle bewiesen, daß sich die Schafe hierher flüchteten und vor nicht allzu langer Zeit hier jemand ein Feuer unterhalten hatte. Von der Höhle führte ein Pfad, den die Hufe der halbwilden Tiere getreten hatte, zum Strand hinunter.
Auch hier gab es mehrere Rinnsale, die über Felsen liefen und von Schafen und Vögeln als Tränke benutzt wurden. Zwischen den schiffsgroßen Felstrümmern auf dem Strand lagen riesige Mengen Treibholz und Schwemmgut. Bill zwang sich dazu, im Lee eines Felsens Holz zusammenzutragen und auf einen Haufen zu werfen.
Im nassen Schwemmgut fand er Muscheln und Fischgräten in großen Mengen, einen kleinen und einen großen Napf aus grünspanigem Metall, mehr als nur verbeult, Tauwerkreste und, an einigen Steinen, dicke Moospolster. Er riß das Moos ab und stopfte es sich ins Hemd, um es zu trocknen.
Auch hier – kein Boot, nichts, aus dem sich ein Boot herstellen ließ oder wenigstens ein Floß. Der flache Bereich, den das Meer bis hoch in den Hang hinauf mit Schwemmgut bedeckt hatte, maß in der Länge nicht mehr als zweihundert Schritte. Nach zwei Stunden Arbeit war der Holzstapel riesengroß geworden.
Trotz Hunger und Erschöpfung hatte Bill so etwas wie einen Plan entwickelt, der ihm auf mehrfache Weise helfen sollte.
Er riß und zerrte, bis er das Messer aus dem Stiefelschaft fischen konnte. Dann versuchte er, ein geeignetes Stück Holz in dünne Stäbe zu schneiden und zu hacken. Sorgfältig gestaltete er halb im Inneren seines Holzstapels ein windgeschütztes Nest, in das er alles packte, was leicht brannte: eine Unmenge Vogelfedern, möglichst viel dünnes und trockenes Holz, noch mehr Moos und trockenes Gras.
Er fand ein zerbrochenes Brett, das von einem Boot oder Schiff stammte. Aus seiner Jacke kramte er ein Stück Takelgarn, vier Fuß lang und band es an beiden Enden eines rindlosen, etwas gebogenen Astes.
In einen einigermaßen geraden Stock schnitzte er eine Kerbe und spitzte den Stock an beiden Enden zu. Er sah, daß es in kurzer Zeit wieder dunkel werden würde.
Während sich die Regenwolken über anderen Teilen der Färöer entleert hatten, war es an diesem Ende der langen, schmalen Insel noch trocken geblieben. Bill baute alles, was er brauchte, vor sich auf und hockte sich auf einen Stein.
„Vielleicht habe ich Glück. Noch mehr Glück“, sagte er und wollte im Augenblick nichts anderes, als lange und tief schlafen.
Er wickelte das dünne Garn in die Kerbe des Stockes, preßte das eine Ende in ein Loch des Brettes und das andere hielt er mit einem flachen Stein unter Druck. Probeweise bewegte er den Ast hin und her – der Stock drehte sich ohne Schwierigkeiten und einigermaßen gleichmäßig.






