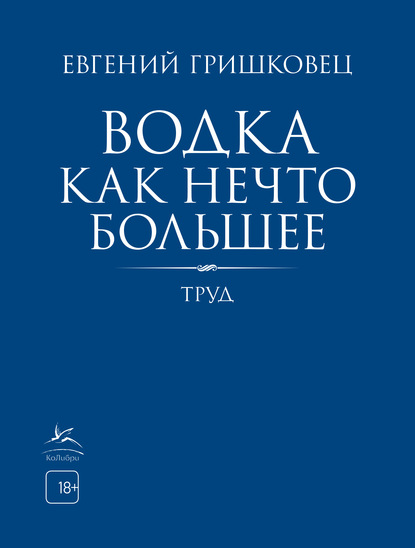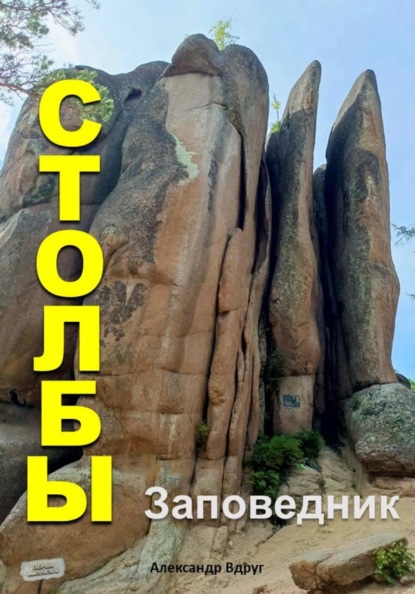Seewölfe Paket 31
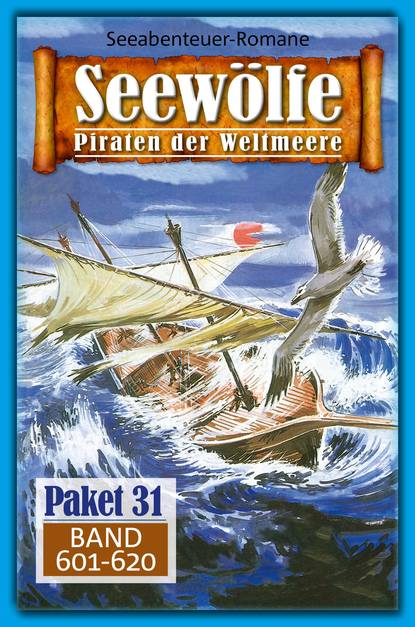
- -
- 100%
- +
„Es sieht gut aus, Ben!“ rief Hasard.
Es gelang ihnen, das Ende noch einmal um den Bugspriet zu legen und das Stag noch dichter zu holen. Dann belegten sie das Tau auf einer starken und massiven Bugklampe.
„Fertig, Sir“, rief der Erste und kroch, nachdem er sich umgedreht und neu gesichert hatte, unter den Schotleinen hindurch und auf den nächsten Niedergang zu. Die Schebecke kippte vom Kamm einer riesigen Welle ins Tal hinunter, legte sich weit üben, und wurde von der nächsten Welle getroffen.
Inzwischen war keine der Wogen kleiner als dreißig Fuß. Waagerecht riß der Sturm Gischt, Wasser und Schaum von den Kronen und jagte dieses Gemenge weiter südwärts.
Der Seewolf und Ben Brighton enterten unter Deck, ließen sich schwer fallen, wo sie gerade standen.
„Das ist der Sturm aller Stürme“, keuchte der Seewolf, riß sich die nasse Kopfbedeckung herunter und paßte seinen Körper dem Schlingern und Bocken des Schiffes an. Jung Hasard gab ihm ein einigermaßen trockenes Tuch.
„Das hat niemand ahnen können“, meinte der Erste. „Das Schiff hält es aus. Du solltest die Rudergänger wieder ablösen lassen, Sir.“
Unter Deck war es dämmerig, nur zwei geschützte Lampen brannten. Einige Männer hockten hier und klammerten sich ebenso fest wie jeder, der sich auf die Planken hinauswagte.
Mit einiger Mühe gelang es den beiden, einige Schlucke aus einem halbleeren Krug zu trinken. Der Tee, reichlich gesüßt und mit Branntwein gestreckt, war kalt.
„Hat euch Dan sagen können, wieviel Fuß hoch das Wasser über dem Watt steht?“ wollte der Kapitän wissen und zog mit wilden Verrenkungen die triefende Jacke aus. „Wir haben zehn Fuß Tiefgang.“
„Auch wenn die Ebbe einsetzt“, erwiderte Jung Philip und wickelte eine trockene Jacke aus, „sagt Dan, sei es ungefährlich. Der Sturm preßt das Wasser gegen das Land. Die Küste ist an vielen Stellen eingedeicht, hat er aus seinen Karten herausgelesen.“
„Wenigstens eine Sorge weniger“, sagte Hasard zufrieden. „Ich denke, daß Pete ans Ruder gegen sollte. Er wird mehr zu tun haben, als ihm lieb ist.“
„Ich helfe ihm“, rief Jung Hasard. „Einverstanden, Dad?“
„Aber nur unter der Bedingung“, sagte der Seewolf und trocknete Brust, Schultern und Arme ab, ehe er ein dickes, trockenes Hemd anzog, „daß du dich mit einer Sorgleine absicherst, klar?“
„Aye, Sir“, erwiderte sein Sohn. „Ich hole Pete.“
Er duckte sich und hangelte sich entlang der Schotten und Verstrebungen in die Richtung auf den Bugteil. Überall unter Deck saßen und kauerten die Männer der Crew und hielten sich fest, fluchten leise oder laut und packten die Gegenstände, die sich ständig losrissen.
Deutlicher war das Geräusch der Pumpe zu hören, ebenso laut plätscherte das Wasser durch den Niedergang herein und durch die Luken, die einen Spalt weit geöffnet waren. Es stank nach kaltem Schweiß und salziger, triefender Nässe.
Von der Insel Sylt wußten die Seewölfe nicht allzu viel. Auf ihr lebten Deutsche und Dänen. Im Jahr 450 waren von dort die Sachsen und Angeln zur englischen Insel aufgebrochen. Die „Manndränke“, eine mörderische Sturmflut, hatte aus einer annähernd runden Insel das meiste Land weggeschwemmt und eine langgestreckte, T-förmige Masse Land zurückgelassen. 1362 hatte die Nordsee, so wie heute, ihre wilde Wut ungezähmt gezeigt, viele Menschen ertränkt und auch Teile der Küste für alle Zeiten verändert.
„Weiß man mehr über unseren Hafen?“ rief der Erste auffordernd in die halbe Dunkelheit. „Dan, wie steht’s?“
Sie würden es also riskieren, entweder westlich um Sylt herum oder zwischen der Insel und den malträtierten Deichen des Festlandes vor dem Wind zu segeln.
Dan O’Flynn kam heran und sagte: „Es muß ein größeres Dorf sein, denn es liegt an einem breiten Kanal zwischen den Deichen. Die Deiche laufen in kleine Hügel aus, und auf ihnen stehen angeblich Türme. Ich glaube nicht, daß wir jetzt Feuer oder Rauch sehen werden.“
„Name?“ fragte der Seewolf kurz.
„Hoyer“, erwiderte Dan O’Flynn. „Aber damit sind meine Karten erschöpft. Mehr weiß ich nicht. Ich habe überall nachgesehen und mir den Schädel blutiggeschlagen.“
„Das ist schon mehr, als ich zu hoffen wagte“, brummte der Seewolf, lehnte sich zurück und atmete tief ein und aus. Er genoß für einige Atemzüge die größere Ruhe unter Deck, bis er den Lärm hörte, mit dem die Rudergänger an Deck kletterten und die beiden durchnäßten und erschöpften Männer mit lautem Gebrüll ablösten. Da trieb es den Seewolf aus der Dämmerung hier unten wieder zurück aufs Achterdeck des Schiffes. Er mußte sehen, wohin sie der Kurs führte und der Sturm verschlug.
„Habt ihr noch einen Schluck für mich?“ fragte er.
Der Kutscher hielt ihm einen anderen Krug entgegen. Hasard trank mit gierigen Schlucken, dann zwängte er sich in die trockene Jacke und knöpfte sie sorgfältig zu.
„Hoffentlich schaffen wir es, bevor es dunkel wird“, sagte er und glaubte selbst nicht recht daran. „Sonst wird das die schlimmste Nacht unseres Lebens.“
„Das Schlimmste ist“, rief er Profos, „daß wir an Deck nichts tun können! Nicht helfen. Völlig sinnlos.“
„Das wird sich in Landnähe ändern“, sagte der Erste und schloß ebenfalls seine Jacke. „Oder wenn’s an Deck Kleinholz gibt, was Rasmus verhüten möge.“
„Das Schiff ist gut“, sagte der Seewolf mit Überzeugung. „Und die vielen Reparaturen in London, die neuen Segel – heute wissen wir, was es wert war. Bis nach Oyer muß das Schiff durchhalten. Und wir auch.“
„Hoyer“, verbesserte ihn der Erste. „Na denn, sehen wir uns wieder die verdammten Wellen an.“
Sie kletterten an Deck und sicherten sich auf dem Achterdeck. Der Seewolf kontrollierte die Knoten, mit denen sich die neuen Rudergänger gesichert hatten. Einwandfrei. Pete Ballie verstand es am besten, die Schebecke schnell, schonend und in den günstigsten Winkeln und Lagen durch das tobende Meer zu steuern.
Philip Hasard Killigrew brachte mit einiger Mühe das Spektiv ans Auge und suchte denjenigen Teil des Horizonts ab, der nicht von Wolken und Nebel bedeckt war. Wenn sich die Schebecke durch eins der gewaltigen Wellentäler quälte, verschwanden selbst die höchsten Landmarken unter der bewegten Kimm – und keine von ihnen war besonders auffallend.
„Sylt voraus“, sagte er schließlich. „Es kann nichts anderes sein. Wie ist der Kurs?“
„Südost-zum-Süden“, sagte sein Sohn. „So haben wir das Ruder übernommen.“
„Kurs halten, Freunde“, mahnte der Seewolf. „Es ist unsicher. Ich weiß noch nicht, ob wir die Insel runden müssen.“
„Es geht schneller, wenn wir direkten Kurs nehmen“, sagte Pete Ballie.
„Und es ist gefährlicher“, entgegnete der Seewolf. „Wenn wir auf Grund laufen, ob es Schlick oder Sand ist, dann können wir nur noch beten, sonst nichts mehr.“
An Backbord schob sich das Land aus der unübersehbar großen Masse der riesigen Wellen heraus. Es war flach, und die größten Erhebungen schienen Bäume zu sein, die auf den Deichen oder knapp dahinter wuchsen. Nicht ein einziges Feuer funkelte, kein Leuchtturm war zu sehen, nur das spitze Dach einer Kirche.
Römö hatten sie längst hinter sich gelassen. Die dänische Insel verschwand hinter der kochenden und brodelnden Kulisse. Der Sturm schien nicht stärker geworden zu sein, aber die Wellen wuchsen weiter an. Als winziger Lichtpunkt war die Sonne weit im Westen hinter Nebel und Wolkenmassen zu ahnen.
Unverändert ging der wilde, krachende Ritt weiter.
Dreißig Fuß oder mehr: die Wellen rollten aus dem nördlichen Quadranten an und folgten einander in quälender, stetiger Folge. Die nächste Welle war niedriger und brach mit weniger lautem Getöse, die darauffolgende stellte sich wieder als Wogengigant dar, die gierig nach dem Schiff langte und ungeheure Wassermassen auf das Deck prasseln ließ.
Schwerfällig erholte sich, in allen Verbänden ächzend, die Schebecke von diesem Überfall, schüttelte das Wasser ab und kletterte wieder die nächste Welle hinauf. Aus den Segeln lief das Salzwasser. Die Wucht des entfesselten Wassers riß nach und nach Holz in Form von unterarmlangen Splittern aus dem Klüverbaum.
Das Schanzkleid bis zum Drehpunkt der Pinne war zerschmettert.
Die Culverinen ruckten bei jeder schweren Bewegung in den Befestigungen. Die Brooktaue waren zum Zerreißen gespannt. In den Planken hatten die Lafetten Eindrücke hinterlassen, die mindestens zwei Finger tief waren. Das stehende und laufende Gut hielt wie durch ein Wunder. Der Seewolf und sein Erster konnten nicht eine einzige geschamfilte Stelle entdecken. Meist waren die Planken nicht zu sehen, denn Wasser schwappte hin und her und lief dann zögernd ab.
„Insel voraus. Welchen Kurs?“ rief Pete Ballie und stemmte sich wieder gegen die Pinne.
„Also gut, Kurs Südost, laßt die Insel an Steuerbord. Vielleicht nutzt es uns etwas.“
„Aye, aye, Sir.“
Es war nicht zu sehen und nicht zu spüren, daß Pete Ballie den Kurs nach exakt Südost legte. Deutlich hoben sich, wenn das Schiff auf einer Welle ritt, die Sanddünen gegen das Wasser ab. Auch leewärts der Insel sah das Meer nicht weniger tobend aus als an allen anderen Stellen. Es wurde plötzlich dunkler. Vielleicht erreichten sie tatsächlich im letzten Licht das kaum bekannte Ufer des Festlandes.
In rasender Fahrt näherte sich die Schebecke der Nordspitze der Insel. Als die Dünen und dahinter die windgepeitschten Bäume schärfer zu sehen waren, riß der Seewolf das Spektiv aus der weiträumigen Tasche und versuchte, das Linsenrohr ruhig zu halten.
„Verdammt“, murmelte er. „Ich dachte, wir wären auf der ganzen Nordsee das einzige Schiff von Verrückten, die bei diesem Wetter segeln.“
„Was siehst du?“ fragte Ben und drehte sich herum, als ein Brecher über die gesamte Breite des Grätlingsdecks wischte und die Steuerbordseite des Schanzkleides aus den Nuten riß.
„Boote – Menschen – vielleicht Fischer.“
„Wo?“ fragte der Erste Offizier. „Recht voraus?“
„Stimmt. Recht voraus. Wir überlaufen sie. Zwei Boote. Hier, schau selber durch.“
Er stützte den Ersten, während Ben Brighton versuchte, in dem wild tanzenden Bild mehr zu erkennen als mit dem bloßen Auge. Nach und nach erkannte er zwei kleine Boote, die Masten und zerfetzte Segel aufwiesen. Die Masten standen noch, die Segel schienen um die Gaffel gewickelt zu sein oder in Fetzen hinunterzuhängen.
Die Boote lagen gefährlich tief im Wasser, und Ben vermochte nicht zu sagen, ob es jeweils zwei Menschen waren oder mehr. Der Gischt ließ das Bild immer wieder undeutlich werden. Eins war absolut sicher. Die beiden Boote waren in Seenot, und die nächste Welle konnte die Insassen herausschleudern.
Die beiden Männer wechselten einen langen Blick, dann zeigte der Seewolf zwölf Finger und deutete zur Kuhl.
„Verstanden. Ich sage es den anderen“, erklärte der Erste und trat seinen gefährlichen Weg bis zum Niedergang an. Er erreichte ihn und wurde nur zweimal von den Beinen gerissen.
„Pete! Hör zu. Recht voraus sind mindestens vier Fischer in Seenot. Wir müssen sie herausholen.“
„Ob wir das überleben?“ schrie Pete zurück. „In den Wind gehen – das wirft uns um.“
„Die Schoten loswerfen“, sagte Hasard, „um Fahrt zu vermindern.“
„Dann fangen wir die Schoten nie wieder ein. Ich denke nach, was wir tun können.“
„Du mußt schnell denken!“ rief der Seewolf laut zurück. „Da ist nicht mehr viel Zeit.“
„Alles klar.“
Bockend und stampfend arbeitete sich die Schebecke weiter nach Süden, erreichte die Höhe der nördlichen Inselspitze und gelangte keineswegs in ruhigeres Wasser. Ungehindert heulte der Sturm über die Insel hinweg, und jetzt riß er nicht nur Wasser, sondern auch Sandkörner mit sich, die auf der Haut winzige Schnitte erzeugten, wenn sie voll trafen.
Nach und nach erschienen zwölf Mann der Seewölfe-Crew an Deck und seilten sich an. Sie trugen Wurfanker, jede Menge Tauschlingen, und von unten her wurden lange Bootshaken aus dem Niedergang geschoben.
Hasard brüllte: „Hinüber nach Backbord, und daß sich jeder sichert!“
„Aye!“
Edwin Carberry, Batuti und Don Juan de Alcazar machten die Wurfleinen klar und schwangen probeweise die Enden, an denen die Ledersäckchen voller Sand baumelten. Edwin Carberry und Big Old Shane steckten dickere Leinen an die Wurfleinen.
Mittlerweile waren die beiden Boote im schlechten Licht des frühen Abends deutlich zu erkennen. Zwischen ihnen war ein Tau gespannt, das sich träge aus dem Wasser hob, spannte, Wassertropfen abschleuderte und dann wieder in der See versank.
„Es sind vier Mann, Sir“, dröhnte die Stimme Carberrys übers Deck. „Wir kriegen sie, wenn der Pete keinen Mist baut.“
„Baut ihr keinen Mist!“ schrie Pete Ballie zurück. „Laßt es euch sagen, wie wir’s hinfummeln!“
„Fock und Besan fliegen lassen und später wieder dichtholen. Willst du das vorschlagen?“ fragte der Seewolf.
„Genau. Dazu brauchen wir gute Männer.“
Roger Brighton und Gary Andrews überlegten nicht lange. Sie bewegten sich geschmeidig über die Planken, schlugen eine Schot los, führten sie durch einen Block und belegten sie auf der Winsch. Das Tau hatte genügend Lose. Sie warteten auf das nächste Kommando und knoteten Sorgleinen in die hart gespannte zweite Großschot.
Die Schebecke versuchte, in Luv der beiden Boote zu bleiben. Die Seewölfe schrien den Fischern etwas zu, aber es war fraglich, ob die verzweifelten Männer etwas hören konnten. Eine lange Reihe einzelner Beobachtungen, fast immer vom Wellenberg aus oder dann, wenn sich das Schiff wie ein Hengst aufbäumte, zeigten weitere Einzelheiten.
Es waren tatsächlich vier Fischer, die bis zu den Oberschenkeln in ihren vollgeschlagenen Booten knieten und Osten wie die Wahnsinnigen. Was sie außenbords beförderten, warf die nächste Welle wieder ins Boot. Die Duchten waren zerschlagen, die Segel waren zu Streifen zerrissen. Sonst war in den Booten nichts mehr zu sehen, nur Wasser und undeutliche, treibende Teile.
Das Tau, das das Heck des einen mit dem Bug des hinteren Bootes verband, war knapp eine Kabellänge lang. Wieder wurde es aus dem Wasser gerissen und beschrieb wellenförmige Bewegungen in der Luft. Einer der Fischer drehte sich herum und sah die Schebecke. Er winkte aufgeregt.
Sie stampfte in Luv heran. Der Seewolf gab sein Kommando.
Die Schoten wurden losgeworfen. Mit einem Knall, der an eine abgefeuerte Drehbasse erinnerte und ebenso laut war, verloren Fock und Besan ihre Form, flatterten aus und wurden nach voraus straff und aus dem Wind gezogen. Ein Ruck ging durch das Schiff, als der Winddruck aufhörte, wirksam zu sein, und Pete Ballie das Ruder bewegte.
Mit einer seltsamen Bewegung schob sich die Schebecke fast seitlich auf die Fischer zu. Der Bug war in der Höhe des hinteren Bootes. Mit aller Kraft warfen die Männer die Wurfleinen. Zwei Ledersäcke klatschten in die träge schwankenden Holzboote. Die Fischer packten sie und zerrten daran, bis sie die vorgesteckten dickeren Leinen packen konnten.
Ein Wurfanker wirbelte im hohen Bogen durch die Luft und schlug ungefähr an der Stelle ins Wasser, an der das Verbindungstau verschwunden war. Ferris Tucker zog den Tampen Hand über Hand heran, nachdem er einige Atemzüge lang gewartet hatte.
Tatsächlich hatte sich das Tau in den Flunken des Ankers verfangen und kam hoch.
„Was hast du vor, Ferris?“ rief Hasard und sah zu, wie sich die Fischer im hinteren Boot die Enden um die Brust knoteten. Die Schebecke taumelte durch die Wellen auf das vordere Boot zu, und wieder flogen die Wurfleinen, vom Sturm mitgerissen, im hohen Bogen durch die Luft.
„Ich will die Boote retten. Brauchen wir keinen Treibanker?“
„Gut. Mach weiter.“
Der Seewolf fragte sich, ob dieser Versuch sinnvoll war. Mit fliegender Eile schlangen sich die Fischer die Enden um die Körper. Die Schebecke driftete näher zu den halben Wracks. Alle Männer zerrten an den Leinen und brachten die Boote mit Anstrengung näher an die Bordwand.
„Springt! Ins Wasser!“ brüllte der Seewolf in deutscher Sprache.
Die Fischer sprangen zwar nicht freiwillig in die kochende See, aber sie wurden über das Dollbord ihrer halb abgesackten Boote gezogen, klammerten sich noch mit kältestarren Fingern an, aber dann ließen sie los. Der Anker klirrte gegen die Planken, als Ferris Tucker das Tau hochgewuchtet hatte.
„Helft mir!“ schrie jemand.
Hände und Arme packten die heranpaddelnden, halb ertrunkenen Fischer, zogen sie an der Bordwand hoch und hievten sie über das niedrige Schanzkleid der Kuhl. Nacheinander schlugen die schweren Körper der Männer auf die Planken. Die Seewölfe halfen zusammen und schleiften sie, selbst mit dem schwankenden Deck kämpfend, zu den beiden Niedergängen.
Die Männer waren völlig entkräftet, und jetzt, als sie begriffen, daß sie gerettet waren, sackten sie zusammen und überließen sich der Erschöpfung.
„Wacker, Arwenacks“, brummte der Kapitän.
Die beiden Bootswracks schlugen zum erstenmal gegen die Backbordplanken. Nachdem die Seewölfe die Fischer unter Deck gebracht hatten, erschienen die Arwenacks wieder an Deck und packten die Schoten.
„Das wird nichts, Sir“, ließ sich Ferris Tucker vernehmen. „War kein guter Einfall.“
„Dann wirf endlich den Tampen außenbords. Oder kapp ihn einfach.“
Mit resignierender Geste ließ Ferris den nassen Tampen los, packte in der nächsten harten Bewegung der Schebecke wieder das Schanzkleid und hielt sich fest. Pete Ballie und Hasards Sohn stemmten sich gegen die Pinne und drückten sie hart nach Steuerbord.
„Auf das Land zu!“ rief ihnen der Seewolf zu. „Sucht nach der Einfahrt, Pete!“
„Verstanden. Kurs liegt an.“
„Welcher Kurs?“ rief Hasard und dirigierte mit dem rechten Arm seine Crew, die versuchte, die wild schlagenden Segel wieder zu belegen. Langsam drehte sich das Gangspill.
„Südost liegt an.“
„Halten, Pete, bis du etwas siehst. Ich frage die Fischer.“
Nur ein halbes Dutzend Männer der Crew waren an Deck und versuchten, sich selbst zu sichern und gleichzeitig die Schoten vom Fock und Besan wieder dichtzuholen. Sie drehten das Spill, die Leinen schleppten sich über Deck, und die Taljen kreischten, während die Segel mehr Wind einfingen. Die Schoten wurden Hand um Hand dichtgeholt, und schließlich fuhr der Sturm wieder voll in beide Segel.
„Dichter holen!“ rief der Seewolf. „Gut gemacht!“
Mit vereinten Kräften wurden die Schoten belegt. Die Rahruten knarrten und krachten, als die Schebecke wieder schneller zu werden begann und sich gegen die nächsten Wellen warf. Die langgestreckte Insel lag jetzt an Steuerbord achterlicher als dwars, und ihre Dünen, von dünnem Gras bewachsen, schienen in rasender Schnelligkeit vorbeizufliegen.
Für die Schebecke gab es weder Windschutz noch weniger bösartige Wellen. Es schien, als habe der Sturm noch aufgefrischt. An drei Seiten türmten sich Nebel und Wolken hoch, und die letzte Helligkeit schwand. Nur ein Teil der Festlandküste war noch mehr oder weniger deutlich zu sehen.
Carberry stand schwankend, an zwei Spanntauen lehnend und sich festkrallend, neben dem achterlichen Niedergang.
Der Seewolf rief ihm zu: „Dan O’Flynn soll zu mir kommen und sein Spektiv mitbringen! Schnell, Ed!“
„Ich hole ihn sofort, Sir.“
Das Schiff, die beiden Rudergänger, jeder und alles – kämpften weiter und wußten, daß sie überleben mußten.
Es schien eine kleine Ewigkeit her zu sein, seit der Sturm ausgebrochen war. Fast ohne jede Warnung hatte er sich auf die Schebecke gestürzt. Die Tatsache, daß selbst die Fischer noch hinausgefahren waren, ließ den Seewolf erkennen, daß auch diese reviererfahrenen Männer sicher gewesen waren, in ruhiger See über dem Watt noch fischen zu können.
Während er auf Dan wartete, suchte Hasard die Küstenlinie ab und versuchte, zwischen den niedrigen Deichen, den wenigen Bäumen und den winzigen Türmen von Kirchen, die weit im Landesinneren zu erkennen waren und keine Rückschlüsse auf die wirkliche Entfernung zuließen, eine Einfahrt zu erkennen.
Hier sollte ein Kanal, der möglicherweise auch eine Flußmündung bedeutete, die Deiche unterbrechen. Aber die beiden winzigen Hügel mit den Einfahrtzeichen waren nicht zu sehen.
Dan O’Flynn, neben sich einen deutschen Fischer, schwankte entlang der gespannten Tampen den Niedergang hoch und auf die Gruppe um die Pinne zu.
Dem Fischermann hatten sie offensichtlich einen mehr als kräftigen Schluck eingetrichtert und eine der wenigen Jacken angezogen, die noch einigermaßen trocken waren. Mit leichenfahlem Gesicht und triefender Hose, die hohen Stiefel voller Seewasser, schwankte er auf den Seewolf zu.
„Bist du aus Hoyer?“ rief Hasard.
Er packte, als der durchfrorene Mann auszurutschen drohte, dessen Kragen und hielt ihn mit erbarmungslosem Griff fest.
„Nein. Aber ich wohne in der – Nähe“, lautete die Antwort. Die Lippen des Mannes waren bläulich.
„Du kennst die Einfahrt zu dieser Stadt?“
„Es ist keine Stadt, Kapitän. Ein Dorf, nicht arm, aber auch nicht sehr groß.“
„Aber wir gelangen in ruhiges Wasser?“
„Wenn ihr die Pricken hinter euch habt, ist alles vorbei.“
„Ich suche sie gerade“, sagte Hasard.
Dan hatte sich in zwei Taue eingehängt und suchte ebenfalls den schwankenden, untergehenden und wieder auftauchenden Horizont mit dem Spektiv ab.
Abenddämmerung. Alle Farben wechselten langsam in ein stumpfes Blaugrau. Aber die Schaumkämme und die Gischtstreifen, vom rasenden Sturm drei Fuß über der Wasseroberfläche auf das Land zugeschleudert, waren deutlicher als sonst zu sehen. An Land gab es nicht ein einziges Licht, kein Feuer, keinen Rauch. Die Bäume, die erstes Blattwerk in hellen Farben gezeigt hatten, schwankten wie Rohstengel.
Also war der Sturm an Land ebenso heftig wie auf See. Dort galten allerdings andere Gesetze. Ritten die Seewölfe etwa tatsächlich auf den Wogen einer, Sturmflut, einer der gefürchteten Springtiden?
„Wo sind diese verdammten Pricken?“ brüllte Hasard und zwinkerte, als die Stöße das Ende des Spektivs gegen sein Auge schlugen.
Der Fischer starrte ebenso wie alle anderen an den Masten vorbei in die Richtung, in die der Bugspriet wies.
„Ihr seid genau auf Kurs“, brachte er schließlich heraus. Aus seinem Mund wehte ein leichter Dampf, der nach Branntwein roch. Auf seinen Wangen erschienen hektische rote Flecken.
„Ist jedenfalls eine tröstliche Feststellung. Aber weder mein Navigator noch ich können die Einfahrt entdecken“, sagte Hasard. „Kannst du im Dunkeln sehen?“
„Ich kenne mein Fischwasser“, sagte der Fischer laut und trotzig. „Geradeaus, Kapitän. Seht ihr den Hügel nicht?“
Dan und der Seewolf mußten warten, bis sich die Schebecke wieder aus einem riesigen, schwarzen Wellental emporgearbeitet und den Kamm inmitten riesiger Schaumflächen erklettert hatte.
„Tatsächlich!“ schrie Dan erlöst auf.
Fast gleichzeitig erschien vor der Linse Hasards ein zitterndes und schwankendes Bild. Als eine Welle über die Reste, des achterlichen Grätingsdecks fegte, die Rudergänger von den Beinen riß und mit einem Schlag wie von einem Hammer zwischen die Schulterblätter Hasards traf, sah er einen Hügel, der sich nur wenige Fuß über die Deiche erhob.
Auf dem höchsten Punkt der Erhebung konnte Hasard gerade noch eine Art Bündel aus weiß gekalkten Baumstämmen erkennen, die schätzungsweise fünfundvierzig Fuß hoch waren.
Aber rechts von diesem seltsamen Hügel gab es keine Dünen mehr. Dort schien sich die kochende See in einen schwarzen Strich verwandelt zu haben. Die Entfernung betrug um die zwei Seemeilen. Bei dem Gedanken, daß die Schebecke inzwischen ununterbrochen dicht über das Watt dahinschlurfte, wurde dem Seewolf halbwegs übel.
Sank das Schiff in ein besonders tiefes Wellental, nur ein einziges Mal, dann zog es mit dem Kiel eine tiefe Furche durch den Schlick. Gab es hier Felsen, Riffe oder Unterwasserklippen? Der Fischer würde es wissen.
„Wir haben mehr Tiefgang als eure Boote. Bleibt uns genug Wasser unterm Kiel?“ schrie der Seewolf.
„Keine Gefahr! Mindestens fünfundzwanzig deutsche Ellen über Grund“, antwortete der Fischer. „Ihr schafft es!“
„Wenigstens eine gute Antwort. Pete – habt ihr die weißen Hölzer gesehen?“