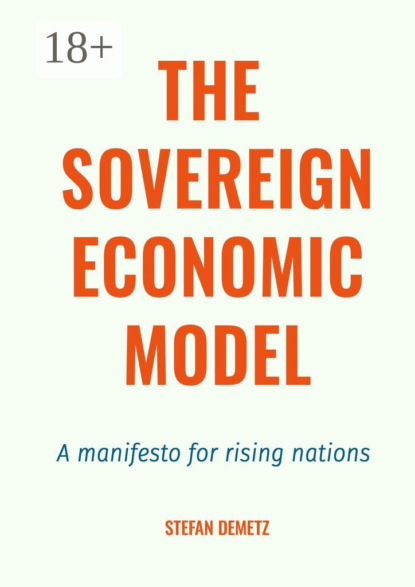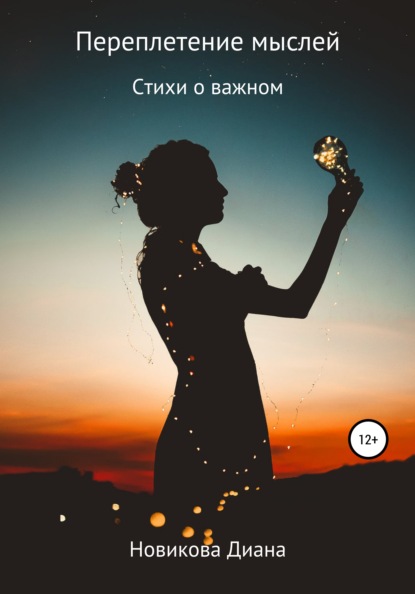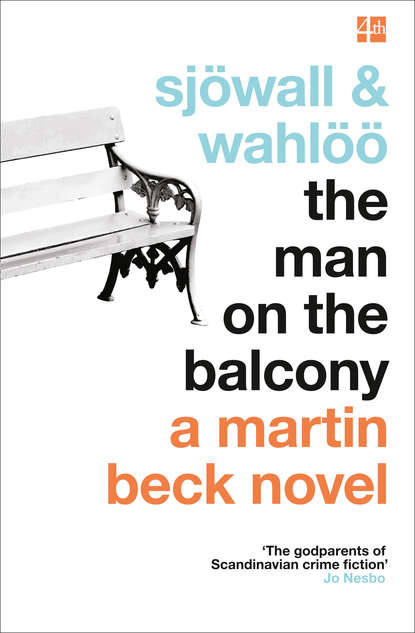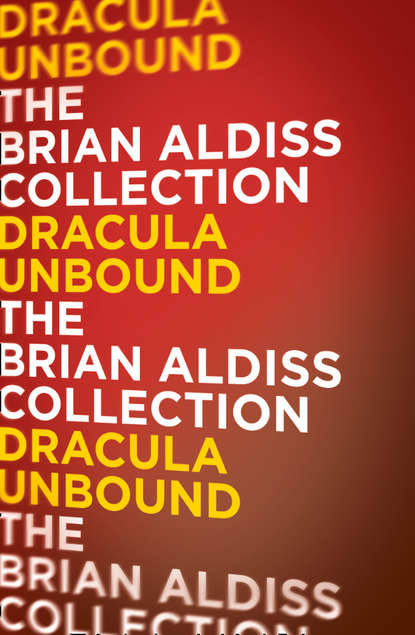Seewölfe Paket 31
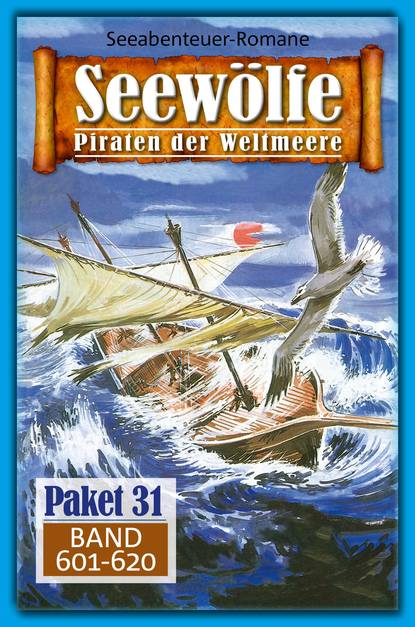
- -
- 100%
- +
„Ich verstehe gar nichts“, brummte Piet Straaten und stellte sich ans Ruder.
„Leinen los und ein!“ rief Hasard.
Alle Mann waren an Bord. Die Schoten bekamen lose, die Rahruten schwangen herum. Mit den Riemen stießen die Seewölfe die Schebecke vom Steg ab, das Schiff schwang mit dem Bug schneller herum und schob sich in den Wind. Die Achterleine, als Spring gefahren, klatschte ins Wasser und rutschte über das Fischerboot, das gegen die Poller und dann gegen den Heckspiegel stieß.
„Achtern alles klar!“ rief Piet. „Der Lotse soll zu mir!“
„Und ein Sprachkundiger!“ rief Hasard.
Sigurd Simonsen, von Sven Nyberg begleitet, enterte aufs Grätingsdeck und versuchte, zu erklären, was er gemeint hatte. Wenn die Gezeiten wechselten, entstand zwischen den beiden größten und langgestreckten Inseln ein starker Sog, der jeden Gegenstand nach Norden riß, vorbei an den schrundigen Felsen und den Seevögelkolonien.
Setzte die Flut wieder ein, kippte der Strom, und mit großer Geschwindigkeit, aber in gefährlichem Fahrwasser in jedem Fall, wurden Schiffe und Boote, Treibgut und alles andere wieder nach Südsüdost transportiert. In den nächsten Stunden galt es, die Strömung nach Norden auszunutzen. Die Schebecke segelte einen weiten Schlag nach Osten, ging durch den Wind und auf Gegenkurs und näherte sich der schlundartigen Einfahrt des Fjordes, der nördlich von Thorhavn zwischen die beiden Inseln führte.
„Achtung“, übersetzte der Däne. „Nicht in diesen Fjord, sondern Steuerbord davon. Wir müssen zwischen den Inseln hindurch.“
„Aye, Fischer“, erwiderte Piet und legte das Ruder. „Wir kriegen Gegenwind, nicht wahr?“
„Sigurd sagt, daß der Wind zwischen den Inseln jetzt nicht mehr stark gegenwehen wird“, erklärte Sven.
„Auch gut.“
„Du sollst die Schebecke genau auf gleicher Entfernung zwischen beiden Ufern halten.“
„Ich versuch’s“, versicherte Piet.
Die Seewölfe standen vollzählig an Deck und beobachteten die Brandungszonen. Inzwischen spürten sie den Sog der Ebbströmung, die eine riesige Masse Wasser zwischen den Inseln nach Norden zog. Die Höhe der Wellen nahm ab, nur eine starke Dünung hob und senkte das Schiff und brach sich an Backbord und Steuerbord an den Felswänden. Fast ausnahmslos stiegen sie so steil an, daß es undenkbar schien, an ihnen hinaufklettern zu können. Schon gar nicht für einen halb ertrunkenen Seemann.
Piet bemühte sich, als der Trichter zwischen den langen Inseln schmaler wurde, die Schebecke im sicheren Fahrwasser zu halten. Die Entfernung betrug nach beiden Seiten mehrere Kabellängen.
„Sven! Frage unseren Lotsen, ob es Riffe gibt oder anderes übles Zeug, das wir nicht sehen können.“
„Nein“, lautete die Antwort. „Du brauchst nur auf die Ufer zu achten.“
„Aye, aye.“
Bis zum Einbruch der Dunkelheit waren es mehr als drei Stunden. Über den Himmel, der sich im breiten Spalt zwischen den Felsen zeigte, zogen in bedächtiger Langsamkeit schwere Regenwolken. Achterlich kam dicker Nebel auf und versperrte die Sicht auf den Eingang des Fjordes. Das Fischerboot hing an straffer Vorleine und schaukelte auf und nieder.
„Frage ihn, ob es hier im Norden einen sicheren Ankerplatz gibt“, erkundigte sich Piet Straaten.
Dan O’Flynn schien seine Rechnungen fertig zu haben und wartete mit seiner Frage, bis Sigurd geantwortet hatte.
„Im Fjördur können wir vor Anker gehen, aber auch trockenfallen, wenn es sein muß.“
„Gut. Und jetzt frage ihn, ob ich recht habe. In einer Stunde haben wir in der Strömung elf Knoten hinter uns gebracht. Ich glaube nicht, daß ich mich irre.“
Der hünenhafte Nachkomme der Wikinger lachte, als ihm die Frage Dans übersetzt wurde.
„Die Strömungen werden bis zu zwölf Knoten schnell“, sagte Sven. „Das ist erstaunlich, aber die Wahrheit.“
In einer Geschwindigkeit, die tatsächlich verblüffend war, zogen die Felswände vorbei. Die Luft hallte wider von den unzähligen Vogelschreien. Vögel flatterten fast an jedem Abschnitt der Strecke zwischen dem Wasser und ihren Simsen, Nestern, Wohnhöhlen hin und her. Sie waren buchstäblich nicht zu zählen, es schienen Millionen zu sein.
„Zwölf Knoten“, staunte Piet Straaten. „Wenn einer der beiden in diese Strömung geraten ist, kann er bis Thorshavn getrieben worden sein.“
„Das ist richtig. Aber er würde es nicht überleben“, erklärte der Färinger.
Je weiter sie mit erheblicher Geschwindigkeit durchs Wasser jagten, desto mehr schwand das Tageslicht. Die Felswände von Österö und Strömö rückten einander näher, und der Fjord wurde zu einem dunklen Tunnel. Nichts zu sehen! Kein Zeichen von Blacky und Bill. Kein Feuer, kein Anlegesteg und nicht ein einziges Boot oder Schiff.
„Frage ihn, Sven, ob hier im Norden jemand wohnt. Ich habe Schafe gesehen“, fragte Piet Straaten nach einer weiteren halben Stunde, in der sie schweigend die bizarre Szenerie angestarrt hatten.
„Niemand lebt hier“, übersetzte Sven Nyberg. „Die Schafe werden mit Booten zu der einen oder anderen Insel gebracht. Aber auf den Nordinseln werden viele Vögel gefangen. In ein paar Tagen geht es wieder auf die Baßtölpel und ihre Eier.“
Dan fragte zurück: „Diese Vögel – ihr eßt sie? Gebraten? Oder was soll diese Vogelfängerei bringen?“
Die Seewölfe auf dem Grätingsdeck erfuhren, daß ein tüchtiger Färinger an einem Tag bis zu eintausend Vögel fing. Drei davon waren sein Essen in vierundzwanzig Stunden. Es gab Jahre, in denen vierhundertfünfzigtausend Vögel gefangen und getötet wurden. Trotzdem wurden die Kolonien der Vögel auf den Felsen nicht kleiner. Die Federn wurden gesammelt und nach Dänemark verschifft. Die Färinger nahmen sozusagen jedes zweite Ei aus den Gelegen, und damit die Schalen nicht brachen, wurden die Eier gleich auf den Klippen in Säcke aus Schaffelleder verstaut.
„Die Vögel nehmen sie aus“, übersetzte der Däne, nicht weniger verwundert als seine Zuhörer, während der Färinger völlig gleichmütig geblieben war. „Sie werden gebraten, eingesalzen, an der Luft getrocknet oder eingepökelt. Auch die Dänen essen sie gern.“
Baßtölpel und Lunde, Trottellummen oder Papageientaucher. Sogar das Fett der Vögel wurde als Brennöl für die vielen langen Nächte gebraucht. Zusammen mit den Schafen und den Fischen bedeuteten die Vögel die einzige Möglichkeit der Färinger, ihr Leben zu fristen und von den Dänen andere Waren einzutauschen. Sie wurden, und das war leicht zu erkennen, praktisch ausgebeutet.
„Und noch etwas“, erklärte der Färinger, und Sven übersetzte. „Alle Fischer suchen jetzt nach Bill und Blacky. Eine halbe Krone ist für sie viel Geld. Und sie haben untereinander verschiedene Verfahren, mit denen sie signalisieren.“
„Habe ich schon gehört“, brummte der Rudergänger.
Das Licht war schlechter geworden, und er hielt nach Backbord Ausschau. Bald sollte die Einfahrt nach Haldersvig zu sehen sein.
„Hvalvik kommt an Backbord“, sagte Dan nach kurzer Zeit. „Dort werden wir wohl anlegen.“
„Richtig. Haldersvig erreichen wir bei Tageslicht nicht mehr“, sagte Sigurd Simonsen.
Die beiden Namen bezeichneten an Backbord kleinere Buchten, also keine richtigen Fjorde, in denen vor Anker gegangen werden konnte. Bei allen Winden außer Sturzwinden oder Fallböen aus Osten würde die Schebecke ruhig liegen.
„Weiß das der alte Siltala auch, der Lotse vorn?“ erkundigte sich Piet Straaten.
„Selbstverständlich.“
Es war gut, zu wissen, daß rund einhundert Bootsbesatzungen nach Bill und Blacky suchten. Auch die Färinger an Bord waren überzeugt davon, daß die Suche im Norden stattfinden mußte. Nachdem ihnen Dan berichtet hatte, an welcher Stelle seiner Meinung nach die beiden über Bord gegangen waren, kam nur der Norden in Frage.
Bei Haldersvig auf Strömö, der größten Insel, im Norden von Österö, auf Kalsö, Kunö oder Viderö, vielleicht auch noch auf Fuglö oder Svinö – auf diesen Eilanden war die Suche sinnvoll.
Und dorthin waren auch die Fischer unterwegs. Falls Blacky und Bill überlebt hatten, konnten sie von den Klippen aus tagsüber die Boote und nachts die Lichter darauf sehen.
Paddy Rogers kümmerte sich um die Laternen am Heck, im Bug und mittschiffs. Für einen kurzen Augenblick strahlte die untergehende Sonne die Wolken über dem engen Fjord an. Die gesamte Landschaft wurde in ein dunkles, rotes Licht getaucht. Selbst der Nebel schien von innen zu glühen. Die gellenden Schreie der Raubmöwen wurden als Echos von den Felsen zurückgeworfen.
Al Conroys kleine Crew lud drei Culverinen und rammte statt eines Geschosses Sandsäcke in die Rohrmündungen. Mac Pellew versorgte die Männer an der Pinne und auf dem Grätingsdeck mit vollen Bierhumpen.
„Essen gibt es, wenn wir vor Anker gegangen sind“, versprach er. „Glaubt ihr nicht auch, daß die beiden ertrunken sind? Wir werden sie niemals mehr sehen.“
„Das glaube ich nicht“, versicherte der Seewolf, der sich einen Humpen nahm und den Niedergang aufenterte. „Wir bleiben hier, bis wir sie gefunden haben. Wie ich versprochen habe: lebendig oder tot.“
Piet Straaten nickte und konnte im nachlassenden Licht gerade noch die Einfahrt in die halbkreisförmige Bucht erkennen. Er drückte die Pinne nach Steuerbord. Die Schebecke, noch immer im Strömungssog, schwang langsam nach Backbord.
„Klar zum Ankern!“ rief Hasard zum Bug. Er wandte sich an Sven und den Färinger.
„Ist dort hinten in Hvalvik eine Siedlung?“
„Nein. Nur zwei Bauernhäuser hoch auf den Klippen. Man zieht die Boote mit Seilen und Flaschenzügen aus der Brandung.“
„Wird also eine ruhige Nacht werden“, brummte Hasard. „Klar zum Bergen der Segel!“
„Aye, aye, Sir.“
Während die Schebecke nach Backbord aus der Strömung glitt, scheinbar viel zu langsam, wurden die Schoten losgeschlagen, die Rahruten kippten langsam in die Waagerechte, und die Zwillinge mit Ferris Tucker befreiten den Anker aus seiner Verzurrung. In der Bucht herrschte ein schwacher Wirbel, der im Halbkreis entlang der Felsen drehte, hervorgerufen von der Ebbströmung im Fjord. Das Schiff steuerte die Mitte der Bucht an.
„Dort, bei dem schwarzen Spalt, Piet“, sagte Hasard und setzte das Spektiv ab. „Genügend vom Fels freihalten. Kann sein, daß sie mit toten Vögeln nach uns werfen.“
„Verstanden, Sir.“
Durch das stille, schwarze Wasser zog die Schebecke einen Viertelkreis. Mitten im Kielwasser glitt lautlos das Fischerboot. Mit einigen starken Ausschlägen des Ruders drehte Piet Straaten die Schebecke noch einmal, so daß der Bugspriet wieder ins freie Wasser hinaus wies, auf die gegenüberliegende Felswand zu.
„Fallen Anker!“
„Verstanden!“
Der Anker schlug schwer und klatschend ins Wasser. Die Trosse rauschte in das schwarze Wasser.
„Zweihundert Fuß!“ sang Hasard junior nach einer Weile aus. Und kurz darauf: „Und auf Grund.“
„Dreißig Fuß mehr lose!“ rief Ben Brighton.
Die geringe Strömung ließ die Schebecke auf die Felswand zudriften, das Ankertau straffte sich und stieg in einem flacheren Winkel tropfend aus dem Wasser. Dann ging ein kurzer, federnder Ruck durch das Schiff. Der Anker saß, das Tau wurde am Bug und mit mehreren doppelten Schlägen am Ankerspill zusätzlich belegt.
„Willst du eine Landleine ausbringen, Sir?“ erkundigte sich Dan und schaute zum Beiboot, das sich in den Lichtschein der Hecklaterne schob.
„Noch nicht nötig“, entschied der Seewolf. „In dieser Ruhe werden unsere Signale weit zu hören sein.“
Der Färinger sah Al Conroy mit glimmender Lunte hantieren und vollführte eine anerkennende Handbewegung.
Das Schiff wurde schnell und routiniert aufgeklart. Hasard gab Al Conroy das vereinbarte Signal. In Abständen von jeweils einem langen Atemzug dröhnten die drei Culverinen los. Das schwarze Wasser spiegelte die langen, rotgelben Stichflammen wider. Träge ringelte sich der graue Rauch an den Planken entlang und schräg in die Höhe.
Der Lärm war gewaltig. Die Klüfte des Fjords verstärkten ihn und trugen seine Echos bis weit in den Norden und über die Kanten der Inselwände hinauf. Ein womöglich noch lauterer Schrei aus aber Tausenden Vogelkehlen war die unmittelbare Antwort.
Hasard stemmte die Fäuste in die Seiten und nickte. Die Schebecke bildete, zusammen mit den Lichtern und dem Spiegelbild in der pechschwarzen Bucht, eine Insel des Lebens und der Bewegungen zwischen den nassen Felsmauern.
„Das war laut und deutlich genug“, sagte er. „Wenn sie hier irgendwo sind, wissen sie, daß wir suchen.“
„Stimmt“, pflichtete ihm Dan O’Flynn bei. „Morgen suchen wir hier alle Klippen ab. Und die Färinger helfen uns.“
„Beide haben uns viel erzählt.“ Piet Straaten rieb sich die klammen Finger und laschte die Pinne fest. „Habt ihr etwas gemerkt?“
„Ja“, sagte Sven Nyberg und schlug dem Färinger auf die Schulter. „Sigurd wartet auch schon seit Stunden auf den nächsten Regen.“
„Regen oder nicht. Wir liegen gut“, antwortete Hasard. „Wir gehen Wache, und ich rieche schon, was unsere Meisterköche brutzeln. Es sind hoffentlich keine Lummen oder Papageientaucher.“
„Es riecht besser!“ rief Dan und enterte zur Kuhl ab.
Piet und Sigurd holten das Fischerboot dichter heran und belegten es an Steuerbord achtern. Die Ruhe in der weiten Bucht nahm zu, weil nach Einbruch der Dunkelheit die Vögel in ihren Nistlöchern sitzenblieben. Hin und wieder sprang ein großer Fisch mit scharfem Klatschen aus dem Wasser. Leise orgelte der Wind ganz weit oben auf den Hochflächen. Die Seewölfecrew klarte das Deck auf, die Wache zog an ihre Plätze.
In der Kombüse klapperten Pfannen und Töpfe. Der Seewolf setzte sich neben Ben Brighton und Sigurd auf die Brüstung des Schanzkleides, hob den Humpen an die Lippen und genoß einen Augenblick lang mit geschlossenen Augen die Ruhe rundum.
„Ich wünschte, ich wüßte mehr“, sagte er besorgt. „Ich glaube inzwischen auch nicht mehr recht daran, daß sie noch leben.“
„Es sind knochenharte Burschen“, erwiderte der Erste ebenso besorgt. „Und sie können auch schwimmen. An Land werden sie sich zu helfen wissen.“
Hasard nickte schweigend.
Auch Ben Brighton wußte, daß der Kapitän wahrscheinlich die Wahrheit gesprochen hatte.
5.
Ein höllisches Fieber hatte Blacky gepackt. Auf dem Boden der winzigen Höhle aus Felsen und grobem Sand zitterte und zuckte sein Körper. Die Augen waren zugeschwollen, die Haut schien zu glühen. Kälteschauer und Hitzewellen rasten durch seine Arme und Beine. Gegen Nachmittag wachte Blacky auf, fühlte sich zerschlagen, hungrig und durstig. Er kroch aus der Spalte, blinzelte im viel zu grellen Licht und tastete sich zu dem Rinnsal, das über die Felsnase plätscherte.
„Ironman ist krank“, murmelte er lallend. Er erkannte seine eigene Stimme nicht wieder.
Er trank aus den hohlen, zusammengelegten Handflächen das eiskalte Wasser in sich hinein. Als er versuchte, sein heißes Gesicht zu kühlen, stöhnte er vor Schmerzen. Er versuchte, einen Vogel zu packen, aber das Tier flatterte mühelos in Sicherheit.
„Vielleicht findet Ironman etwas“, keuchte Blacky und schleppte sich, eine Hand am Fels, zum Strand hinunter. Immer wieder knickten seine Knie ein. Er hatte das halb zerstörte Messer herausziehen können und suchte nach einem Verwendungszweck.
Er wollte ein Feuer entfachen, ein Signal setzen, sich wärmen und einen dieser verdammten Vögel braten. Mehr nicht. Dreimal stolperte er vor Schwäche und zog sich schließlich am Ast eines angetriebenen Baumstammes hoch. Schwer lehnte er sich darauf. Seine entzündeten Augen suchten in dem ineinander verfilzten Wirrwarr, das sich viele Schritte breit über Sand, Geröll und Felstrümmer erstreckte, nach etwas Brauchbarem.
„Nichts. Was soll auch in dieser verdammten, gottverlassenen Gegend sein“, murmelte er und zog frierend die Schultern hoch.
Er zog einen Stock aus dem Gewirr, der noch nicht alt war und daher etwas biegsam. Vor ein paar Stunden hatte er Takelgarn aus dem Saum der Segeltuchjacke herausgezogen. Auch ein annähernd trockenes Brett fand sich. Irgend jemand hatte Blacky einmal gezeigt, wie man es anstellte, im Holz bohrend eine Flamme hervorzubringen. Er glaubte nicht, daß er es schaffte, aber er wollte nicht sterben.
Immer wieder hatte er aufs Meer hinausgestarrt, bis ihm die Augen tränten.
Die einzige Bewegung, die er sah, waren die Wellen und die Brandung und ab und zu der dicke Nebel, der kam und ebenso plötzlich wieder aufgelöst wurde.
Er war völlig allein, aber er zwang sich, nichts zu vergessen, was ihn zu retten vermochte. Solange er lebte, konnte er etwas gegen das Sterben tun. Es gab genug Berichte über Schiffbrüchige auf einer einsamen Insel. Diejenigen, die überlebt hatten, konnten viel erzählen.
Er, Blacky Ironman, wollte auch zu den Männern gehören, die viel zu berichten hatten. Daß sich an Bord der Schebecke ebenfalls Überlebende eines solchen Abenteuers befanden, hatte er im Fieber vergessen.
Blacky wurde jedesmal, wenn er sich bückte, halb ohnmächtig. Kreise und wirre Punkte wirbelten vor seinen Augen. Er fand im Schwemmgut einen halben Tontopf, den er in der Brandung mit Sand sauber putzte und scheuerte.
Ächzend und stöhnend, mit weichen Knien, trug er seine weiteren Schätze zusammen. Trockenes Holz, die losen Federn, die er aus den dürren Vogelbälgen zupfte. Er brachte es fertig, alle seine Funde bis zu seinem Felsspalt zu schleppen. Dort warf ihn ein neuer, schlimmerer Fieberanfall in den Sand.
Bill sagte sich grimmig, daß er in dieser Nacht einen Schafsbraten haben würde.
Er war fest entschlossen, ein möglichst junges Tier zu fangen. Das Salz, diese Sorge hatte er nicht, gab es reichlich im Seewasser.
Jetzt, etwa eineinhalb Stunden vor Sonnenuntergang, schob er mit einem feuchten Ast die Asche und die halb verbrannten und angesengten Holzteile zusammen. Der Aschehaufen am Felsblock war mehr als kniehoch.
Unter der Asche befand sich reichlich Glut. Das Feuer hatte sogar einen stundenlangen Regenguß ausgehalten.
„Aber keiner hat die Flammen und den Rauch gesehen“, murmelte Bill.
Eigentlich war es kein Wunder. Bill war sicher, irgendwo im Norden angetrieben zu sein. Im Süden waren die Inseln wohl bewohnt. Zumindest nicht so leer wie hier. Nicht einmal der halbzerfallene Unterstand eines Fischers befand sich auf dieser verdammten Insel. Er, Bill, wußte nicht einmal, wie sie hieß.
Das trockene Holz fing schnell Feuer. Bill schichtete dünne und dicke Äste und Stämme darauf und bemerkte, daß er dieses riesige Feuer noch tagelang unterhalten konnte. Dann allerdings würde der Strand ziemlich aufgeklart sein.
Während er, zwar mit klirrendem Magen, schnell und geschickt arbeitete, starrte er einmal zu den Schafen hinauf, die seinem Treiben bewegungslos zusahen, dann wieder richtete er seinen Blick auf die See und zu den schemenhaft sichtbaren Inseln im Süden, die wie sagenhafte Wesen aus dem Meer aufstiegen und meist in Nebel oder Regen gehüllt waren.
Das Feuer loderte hoch, und je mehr Tang und Algenreste er darauf warf, desto dicker und auffallender wurde der Rauch, der sich zunächst fast senkrecht in die Höhe ringelte. Am oberen Ende des Hanges, dort, wo der Wind über die Kanten der Hochfläche pfiff, wirbelte der Rauch nach Osten.
Bill lehnte ein Dutzend wuchtige Stammabbrüche gegen das dünnere Holz und sah zu, wie das Feuer nach ihnen griff. Das Knistern des Holzes und das summende Brausen der Flammen gefielen ihm. Hitze und Glut hatten inzwischen auch seine Kleidung samt der Stiefel leidlich getrocknet.
„Und jetzt – der Braten“, versprach er sich selbst und suchte ein paar handliche Knüppel. Die Schneide des Messers hatte er schon an einem Stein scharf gewetzt.
Ohne große Eile kletterte er den Hang hinauf. Bewußt ging er nicht auf die kleine Herde zu, sondern erreichte schließlich die Hochfläche an einer ganz anderen Stelle.
Gelang es ihm, auch nur ein Schaf über die Kante zu treiben, war es seine sichere Beute. Er bückte sich und hob einen kantigen Stein aus dem Gras.
„Wartet nur, ihr lieben Wolltiere“, sagte er.
Knapp eine Stunde blieb ihm noch. Er ging in einem weiten Bogen, sorgfältig den Felsbrocken, Einschnitten und Gräben ausweichend, von hinten auf die neun Schafe zu und mußte grinsen, weil sich die Tiere so drehten und drängelten, daß sie ihn stets im Auge behielten.
Bill hatte es auf ein jüngeres Tier abgesehen, das in seiner Wolle gut genährt aussah und irgendwie sauber gewaschen wirkte. Als er glaubte, richtig zu stehen, lief er schreiend auf die Schafe zu und blieb stehen, als sie in drei Richtungen davonsprangen. Das Tier, das er ausgespäht hatte, lief nach rechts.
„Genau dorthin, wo ich dich haben will!“ brüllte er und zielte, bevor er den Stein schleuderte. Das Glück war wieder einmal auf seiner Seite.
Der Stein traf das Schaf am Kopf und warf es zu Boden. Das Tier überschlug sich und war taumelnd wieder auf den Beinen, als Bill darauf zurannte, über einen Graben sprang und den Knüppel schwang. Noch ehe das Schaf in die andere Richtung stolpern konnte, traf er es mit dem Holz, schlug, so hart er konnte, ein zweites Mal zu und ließ den Knüppel fallen. Das Tier kippte um, keilte mit den Läufen, und mit einem schnellen Schnitt durch die Kehle tötete Bill das Schaf.
Er packte es nach einer Weile an den Hinterbeinen, warf es sich über die Schulter und stieg zu dem Feuer ab, das den größten Teil des Hanges in flackerndes rotes Licht tauchte und sich in den ufernahen Wellen spiegelte.
„Na also, das Essen ist gesichert. Habe schon gedacht“, sagte er zufrieden, „ich müßte die Vögel rupfen und braten.“
Bill schleppte seine Beute bis an eine Stelle, an der er bequem hantieren konnte. Er versuchte, nur mit dem Messer, dem toten Schaf das Fell abzuziehen, hackte die Läufe ab und weidete, so gut er es verstand, das Tier aus. Schließlich war er mit seiner Arbeit einigermaßen zufrieden und spießte die Stücke aus Knochen und Fleisch auf zugespitzte Holzstücke. Er rammte sie in den Boden und steckte sie zwischen Steine, so nahe der Glut wie möglich.
Mit spitzen Fingern packte er die Eingeweide, legte sie auf das blutige Fell und schleppte es zum Wasser hinunter. Er warf das Bündel im hohen Bogen in die Brandung, schöpfte Wasser in den zerbeulten Kessel – die Löcher hatte er mit Holzsplittern abgedichtet – und setzte sich schließlich ruhig in die Nähe des Feuers.
Das Fett tropfte in die Glut und verbrannte zischend und rauchend. Je länger Bill zusah, wie sich das Fleisch bräunte, desto lauter knurrte sein Magen. Er spritzte ständig Seewasser über das Fleisch und sah, wie es verdampfte und an einigen Stellen feine Salzkristalle zurückließ. Ab und zu drehte er die Stücke, und als er einmal zum Hang hinaufschaute, entdeckte er die Augenpaare der Schafe. Sie leuchteten durch die Dunkelheit wie die Augen von hungrigen Raubtieren.
Mit untergeschlagenen Beinen saß er im Sand und fühlte sich nicht nur krank, sondern halbtot. Aber als er die Stelle anschaute, wo sich das Ende des Stockes im Brett drehte, konnte er auch einen winzigen Glutfleck und dünnen Rauch sehen.
„Geht also doch – und jetzt?“
Er schwankte vor und zurück, bis sein Kopf gegen den Fels schlug. Blacky bewegte seinen Arm, ohne recht zu wissen, was er tat. Die Glut wurde stärker und größer, Moos und Federn begannen stinkend zu glimmen und zu flackern.
Blacky murmelte etwas. In seinem Schädel dröhnten Glocken. Er kippte nach vorn und schob sein Feuerbesteck zur Seite. Ein Holzhaufen fiel um. Während „Eisenmann“ Blackys Körper vom Fieberanfall geschüttelt wurde, brannten zuerst die dünnen Hölzer, dann der Ärmel der Segeltuchjacke und schließlich ein paar dicke Holzstücke.
Nach einigen Atemzügen – oder waren es ein paar Stunden – kam Blacky wieder zu sich. Er glaubte zu träumen, als er zwei Fuß vor seinen Augen die spitzen Flammen sah und auf der Haut wieder die Hitze spürte. Ein Hustenanfall hatte ihn aufgeweckt. Er kroch von der Flamme weg und atmete noch immer den bitteren Rauch ein, der seine Augen tränen ließ.
„Feuer“, stöhnte er und begriff. „Endlich!“
Er lag neben seiner Höhle, und ein Teil des Holzvorrates brannte wirklich. Blacky stützte sich auf Ellbogen und Knie und versuchte, aufzustehen. Er verstand, daß er halbtot war. Seinen halbzerbrochenen Krug hatte er umgeworfen.