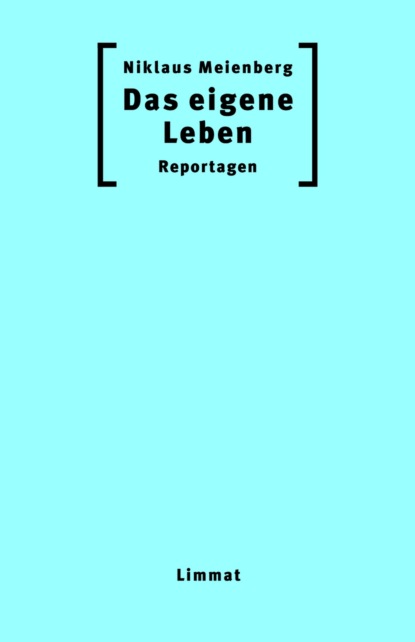- -
- 100%
- +
Die nächste Anstalt in St. Gallen, in die ich gesteckt wurde, war die Kaserne auf der Kreuzbleiche. Es war noch nicht die Zeit der Dienstverweigerer und auch nicht die Zeit der Aufrührer, die gerne in der Rekrutenschule ausharren, weil man dort schiessen lernt. Die Kaserne war überhaupt nicht mehr barock, sondern im klassizistischen Stil gehalten, wie das Schlachthaus und die Kantonsschule. Der Klassizismus entspricht dem aufblühenden Bundesstaat, so wie der Barock dem absterbenden Ancien régime der sanktgallischen Äbte entspricht. Das Schweizerkreuz auf den Militärwolldecken musste sich immer genau im Zentrum der eisernen Betten befinden. Das sanktgallische Liktorenbündel, die sogenannten fasces, war hier nirgends zu erblicken. Neue Manieren wurden eingeführt, eine Steigerung der Sekundarschulmanieren fand statt. Man musste den Vorgesetzten, welche an ihrem feinen Tuch erkennbar waren, seinen Namen über fünfzig Meter weit lauthals entgegenschreien. Sie nannten es grüssen oder melden. Ärschlings musste man sich eine grosse Verkniffenheit und Straffung angewöhnen. Sie nannten es strammstehen. Der Feldweibel prüfte die Strammheit der Arschmuskeln. Sollte ich einst liegenbleiben in der blutüberfüllten Schlacht, sollt ihr mir ein Kreuzlein schneiden auf den dunklen tiefen Schacht. Die Armee dient sowohl der Abwehr von Angriffen von aussen als auch der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung nach innen. Die Ordnung des Lehrers Tagwerker wurde in letzter Instanz auf der Kreuzbleiche garantiert, ebenso die Ordnung am Rosenberg. In der dritten Woche war Bajonettexerzieren. Parade vor, Parade rückwärts, Leiche abstreifen hiess der Befehl, dazu wird eine Bewegung mit dem aufgepflanzten Bajonett ausgeführt, indem man zuerst horizontal in den Feindkörper hineinsticht, der vorläufig noch imaginär war, und sodann den Leichnam mit dem linken Fuss abstreift, dabei mit dem rechten Fuss Posten fassend. Nachdenklich geworden, weil uns in der Kath. Sekundarschule die Liebe zum Feind eingeflösst worden war, auch das Hinhalten der linken Wange, wenn der Rektor auf die rechte geschlagen hatte, und weil wir die Feindesliebe so weit getrieben hatten, sogar den Rektor und Präfekten zu lieben, liess ich mich bei Leutnant R. für die Sprechstunde vormerken, die immer nach dem Hauptverlesen stattfand. Kommt nur zu mir, wenn ihr ein Problem habt, hatte er gesagt. Leutnant R. hörte sich mein Problem an: Warum sollten wir einen abstrakten Feind abstechen, wenn wir bisher unsere konkreten Peiniger in der Schule hatten lieben müssen?
Er lächelte kurz und sagte: Sie sind doch Katholik, oder? Also dann. Die schweizerischen Bischöfe haben erklärt, dass die Ableistung des Militärdienstes mit dem christlichen Gewissen vereinbar ist. Ich hoffe, damit auf Ihre Frage geantwortet zu haben.
Seit diesem Gespräch hatte es mir in der Rekrutenschule, obwohl man dort viel Nützliches über den Umgang mit Sprengkörpern lernt, nicht mehr richtig gefallen wollen, und nach insgesamt drei Wochen Aufenthalt in dem langgestreckten klassizistischen Gebäude war der Dienst für mich zu Ende. Ich hatte ein altes Röntgenbild finden können, welches unerträgliche Schmerzen an der Wirbelsäule nachwies, einen alten Scheuermann. Mein Vater schaute bitter auf den dienstuntauglichen Sohn, als ich in Zivil nach Hause kam. Jetzt musst du Militärersatz zahlen, sagte er, und das Militär hätte dir gutgetan.
Als das Wetter aufhellte und die Gespenster im Schneetreiben untergegangen waren und das Motorrad strotzend bereitstand für die Fahrt in eine mildere Stadt, schlenderte ich mit B. noch ein wenig durch die Altstadt, Metzgergasse, Goliathgasse, Augustinergasse. Vieles hat sich geändert seit jenen Zeiten, sagte B., eine gewisse Humanisierung hat auch hier stattgefunden, wollen jetzt abschliessend eins trinken. Wir tranken Rotwein im Restaurant «Alt-St.-Gallen», an der Augustinergasse. Das ist eine freundliche Pinte mit falschem Renaissancetäfer und falschen Butzenscheiben, wodurch der Eindruck des Alten entsteht. Rentner und Arbeiter, auch ausrangierte Huren verkehren hier. Die Wirtsstube mit niedriger Decke und gemütlich, Stumpenrauch, Sangallerschöblig, Bratwörscht, Bierflecken, Stimmen. Und die Sanktgaller Freisinnigen, welche jetzt die Wiedereinführung der Todesstrafe verlangen? Nach einiger Zeit sagte er, zur Serviertochter gewandt: Fräulein, könnten Sie uns einmal den Schrank dort öffnen? Das Fräulein öffnete den Schrank für eine Gebühr von 20 Rappen. Eine Guillotine kam zum Vorschein, kein nachgebautes Modell, sondern eine richtige Guillotine aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, ein fahrbares Stück, das in Süddeutschland auf den Dörfern gedient hatte. Die Serviertochter nannte sie Güllotine. Früher sei sie offen im Restaurant gestanden, sagte das Fräulein, aber weil die Leute sie immer betätigen wollten und das Fallbeil heruntertätschen liessen, habe man die Güllotine einschliessen müssen, sie sei ausserordentlich heikel, und man könne sie nicht versichern. Wo normalerweise der Nacken liegt, ist jetzt ein Holzscheit mit einer tiefen Kerbe zu sehen.
Wach auf du schönes Vögelein
Die Krippenfiguren stammten vom Bildhauer Meier, Wilhelm Meier, draussen am Stadtrand im «Hof Tablatt» wohnte der weissbärtige, Kaiser-Wilhelm-bärtige Meier, den wir am Nachheiligtag regelmässig besuchten in seinem Atelier, das an ein altes Bauernhaus angebaut war, wo seine Frau, die etwas Inniges hatte, uns mit Guetsli bewirtete, und kamen dann jeweils immer mit mindestens einer neuen Krippenfigur zurückgetrippelt nach St.Fiden, und die Figuren wurden im Laufe der Jahre immer ein bisschen abstrakter, weil Wilhelm Meier sich in dieser Richtung entwickelte, ohne jedoch das Figurative ganz zu vernachlässigen, weil er sonst von der Stadt keine Aufträge mehr gekriegt hätte, aber waren dann immerhin Ochs & Esel, welche der Vater, im Familienkreis Vati genannt, zur Zeit des Koreakrieges erwarb, in ihrem Stil doch recht verschieden von Maria & Josef, die er früher im Aktivdienst beim damals vermutlich noch nicht schneebärtigen Meier erstanden hatte; so dass von einer homogenen Krippengesellschaft nicht die Rede sein konnte, sondern erkleckliche Unterschiede bestanden, ganz wie bei den Gschwüschterti, die sich deutlich voneinander abhoben und von denen im Laufe der Jahre ein halbes Dutzend zur Welt gekommen waren. Ursi kam nach mir; zu den andern schaute ich auf. Sie hatte blonde Zapfenlocken, und in der ersten Klasse, als ich entdeckte, dass die Väter von mindestens zwei Schulkameraden, nämlich Benteli und Hungerbühler, ihre Familien sonntags im Auto spazierenführten, manchmal bis nach Rimini hinunter, soll ich auf die Frage der Mutter, was mir denn lieber sei, ein kleines Schwesterchen oder ein Auto, für beide reiche der Verdienst des Vaters nicht, geantwortet haben:
Es Auto, Chind hämmer jo scho gnueg; und so die Mutter, welche mit der korrekten Antwort rechnete, betrübt haben.
Weihnachten wurde präpariert durch den Advent, welcher mit dem Dezember begann und sich durch die sogenannten Rorate-Messen und den Verzicht auf Naschwerk auszeichnete. Alle Zeltli, Schleckstengel, jedwedes Zuckerwerk, Schokolade und andere Naschbarkeiten, die man sonst beiläufig verzehrte, wurden im Monat Dezember strikte in einem Porzellanbehältnis aufbewahrt und dem Heiland zuliebe, der bald den Himmel aufreissen würde, bis Weihnachten akkumuliert. Da stand diese Schüssel im Buffet, im Esszimmer, frei zugänglich, und es war eine harte Askese, eine innerweltliche, nicht zu naschen vor Weihnachten, sondern eben sich zu beherrschen und zu verzichten, obwohl die Süssigkeiten sich bedrohlich vermehrten und an Weihnachten manches nicht mehr im frischesten Zustand sein würde, und es war auch nicht so, dass man, wenn die Schlecklust ausnahmsweise mit uns durchging, von der Mutter bestraft worden wäre, nur der Heiland, sagte sie, sei dann etwas traurig, und die Blicke aus ihren notorisch blauen Augen wurden ganz durchdringend; und so beruhte alles auf freiwilliger Basis. Diese Tätigkeit des freiwilligen Verzichtens nannte man: äs Öpferli bringe. Die Rorate-Messen begannen um sechs Uhr; man sang zuerst TAUET HIMMEL DEN GERECHTEN, WOLKEN REGNET IHN HERAB, es gab Schnee, und der Drogist Egli sang sehr schön, wenn auch etwas gequetscht. HARRT SEIN VOLK IN BANGEN NÄCHTEN, IN DER SÜNDE DUNKLEM GRAB. Da hörte man auch den Büchsenmacher Werner, den Doktor Romer, der uns im Frühling die Warzen mit einem böse zischenden, bläuliche Funken erzeugenden Gerät von den Fingern brannte, den Schlosser Lehner und den Bäcker Lehmann herrlich singen, aber auch den Drogisten Rutishauser aus dem Krontal, welcher ein Konkurrent des Egli war, und ihre Stimmen transzendierten eine halbe Stunde lang ihr Handwerk, und in kultureller Hinsicht war dieser Tagesbeginn mindestens so gelungen wie ein von Radio 24 berieselter, schweigend hingenommener, ingrimmig gehasster Zürcher Morgen, der mir eben jetzt wieder vor dem Fenster dämmert, 8050 Oerlikon.
Es kommt ein Schiff geladen, bis an sein höchsten Bord, trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewig Wort.
Der Vater war beim Morgenessen schweigsam, tunkte die Möcken in den Kaffee, schälte einen Gerber-Käse aus dem Silberpapier, Gerber-Schachtelkäse, der so zum Morgenessen gehörte wie die Nachrichten der Schweizerischen Depeschenagentur zum Mittagessen, welches recht pünktlich mit dem Zeitzeichen aus Beromünster begann. Es gab nicht mehr viel Metaphysik tagsüber, das Adventliche blieb auf die frühen Morgenstunden konzentriert. Im Buffet drohten die Süssigkeiten, schlummerte die stetig wachsende Versuchung, täglich wuchernde Anhäufung, das ausufernd Gut-Böse, das Anziehend-Abstossende. Ein Ausweichen war nur möglich, indem man die Grossmutter, die im obern Stock wohnte, besuchte, ihr Territorium wurde nicht so scharf vom Heiland kontrolliert, sie war eine Art Gegenmacht im Haus, und was man bei ihr lutschte, war in religiöser Hinsicht wie nicht gelutscht. Die kleine Schwester Ursi und ich haben es denn auch sehr bedauert, dass sie zusehends hinfälliger wurde und, weil etwas schwabblig auf den Beinen, ihren harten Thurgauerkopf mit zunehmender Häufigkeit gegen ein Möbel schlug und verletzte. Immer nämlich, wenn es im obern Stock rumpelte, schlichen wir uns mit angehaltenem Atem hinauf, angezogen/abgestossen, und waren gespannt, ob sie wohl ein Loch im Kopf habe, oder gar schon tot sei, oder unverletzt geblieben sei. Viel Blut floss meist nicht.
*
An Weihnachten war es dann schön. Alle glaubten daran in der Familie, und es stimmte. Es stimmte mehr als die profanen Feste, die ich seither erlebt habe, aber es stimmte nur, weil man glaubte, und als ich im Internat Camus zu lesen begann, wurde das Weihnachtsgefühl beschädigt: aber weder Camus noch Sartre, noch Foucault haben mir später ein Fest beschert, und auch keine linke Partei, oder doch nur eines im Kopf. Es stimmte damals vielleicht, weil man klein war und am 24. Punkt zwei Uhr nachmittags der Run auf die gehorteten Schleckwaren begann und eventuell die Märklin-Lokomotive unter dem Christbaum lag, aber vor den Geschenken, bitte sehr, das Weihnachts-Evangelium und die Lieder. Das Evangelium wurde in aller Regel vom ältesten Bruder vorgetragen, und die Botschaft war eigentlich nicht schlecht, auch wenn seine Stimme ein bisschen zitterte. Man hörte sich das stehend an, und es begab sich aber zu jener Zeit, dass diese Worte nicht als aufgesetzt empfunden wurden, trotz der Feiertagsgewänder, und nicht als lebensfremd, und es war nicht kitschig, auch wenn der Vater manchmal nasse Augen bekam vor Ergriffenheit und dann kurz ins Badzimmer verschwand, bevor er auf seiner Querflöte, die er nur einmal im Jahr benutzte, die Melodie von TOCHTER ZION, FREUE DICH, JU-U-U-U-UBLE LAUT, JE-RU-U-U-SALEM so laut und falsch pfiff, dass man ihm, dem stillen, in sich gekehrten Mann, den Jubel glaubte (Händel). Niemand dachte bei «Tochter Zion» an den Zionismus, und Jerusalem war eine Traumstadt. Die Querflöte wurde vom Klavier und von der Geige und der Blockflöte begleitet und von zwei- bis dreistimmigem Gesang, man konnte die Rührung verscheuchen, indem man möglichst kräftig sang, die Mutter stand im Hintergrund und summte leise mit, weil, gesanglich war sie nicht stark, und die Stube, welche der Vater in seiner soignierten Art SALON nannte, mit französischer Aussprache, obwohl sie dafür viel zu klein war, platzte vor Musik aus allen Nähten. LIEB NACHTIGALL WACH AUF war übrigens auch ein beliebtes Weihnachtslied, WACH AUF DU SCHÖNES VÖGELEIN. Über dem Klavier hingen vier alte Stiche, die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählend, aus dem 16. Jahrhundert, JOHANN SEBALD BEHAM FECIT, die hatte der kunstsinnige Vater, der wenig Geld, aber guten Geschmack besass, vom sauer Ersparten gekauft, war er doch als Revisor des Verbandes Schweizerischer Darlehenskassen weit im Lande herumgekommen und hatte immer wieder eine Möglichkeit erspäht, sein Haus mit bedeutsamem Zierat, der den Geschmack seiner sechs Kinder bilden sollte, auszustaffieren.
Die Feier tönte nicht kitschig, weil sie den Alltag verlängerte, sozusagen sein Kulminationspunkt war. Die Mutter zum Beispiel hatte die Botschaft von der Gleichheit aller Menschen – Gleichheit vor Gott, aber Gleichheit alleweil – wirklich kapiert und praktiziert, und in ihrem Gefolge hatten die sechs Kinder fast keine andere Wahl, als diese auch zu glauben, und von der Gleichheit ausgehend, wurde auch Gerechtigkeit angestrebt. Man hörte zum Beispiel, dass es wichtigere Dinge im Leben gab als Geld. Man wurde von der Mutter, welche ihr Schwiegersohn Kurt «La reine mère» nannte, dahingehend instruiert, dass alle Menschen gleich viel wert seien und oft nur das Spiel des Zufalls den einen zum Reichen, Mächtigen und den andern zum Armen, Verschupften gemacht habe, dass auch in allen so etwas Ewiges lebe, in den Reichen und Arroganten allerdings vielleicht ein bisschen weniger als in den Stillen und Kleinen; und dass man nicht der Autorität, sondern den Argumenten zu folgen habe, weil nämlich jeder, im Zeichen der Gleichheit, über den eigenen Verstand verfüge. Dadurch hat sie mindestens einen ihrer Söhne, welcher auch nach der Kindheit glaubte, es komme im Leben auf die Macht der Argumente, nicht auf die Argumente der Macht an, in permanente Schwierigkeiten gestürzt. Allerdings konnte es auch ein Zeichen von besonderer Auserwähltheit sein, wenn ein Kleiner dank eigener Tüchtigkeit und Strebsamkeit zum Millionär wurde, wie ihr Bruder, der tüchtig akkumulierende, und dieses, obwohl der Vater nur einen kleinen Gemüsehandel betrieben hatte, und auf diesen self made man, der im Alter von dreissig Jahren die Matura (Institut Juventus) gemacht und später sich noch den Doktortitel geholt hatte, war sie stolz, und natürlich hätte sie auch gerne studiert und einen Titel geholt, das machten dann zwei ihrer Söhne für sie, der eine davon mit knapper Not. So einen Treibsatz bekam man eingebaut in der Familie, einen Stolz nach aussen, natürlich gepaart mit christlicher Demut nach innen – vor der Mutter. Sie war keine künstliche Mutter. Zum Beispiel hatten wir gelernt, dass man sich nicht ducken soll, wenn möglich, dass Lehrer und Pfärrer nicht immer recht haben, weil sie Lehrer und Pfärrer sind, und wenn diese Autoritätsfiguren zu Hause reklamierten wegen angeblicher oder wirklicher Verfehlungen eines ihrer Kinder, so wurde die Reklamation streng auf ihren Wahrheitsgehalt hin abgeklopft und erst dann, je nach Lage der Dinge, Lehrer/Pfarrer oder Kind ermahnt. Die Autorität hat bei ihr nie automatisch recht gehabt, nur weil sie Autorität war, und wenn sie zur Überzeugung kam, dass in der Sonntagspredigt irgendein theologischer Gedankengang nicht stimmte, stellte sie den Prediger nach dem Gottesdienst mit aller gebotenen Energie zur Rede, wobei der Fehlbare mit Blicken aus ihren notorisch blauen Augen angebohrt wurde wie der heilige Sebastian von den Pfeilen.
*
Aber im Singen war sie nicht so stark, drum summte sie die Melodien nur mit und schaute mit ein bisschen Abstand auf das gelungene Konzert an Weihnachten, während der Vater, der eher an Autoritäten glaubte und an gewissen Personen hinaufschaute, auf seiner umständlich zusammengesetzten Querflöte pfiff; er hat punkto Autoritäten wenig Einfluss gehabt in der Familie, weil er angenehm still war und sich zurückhielt und eigentlich nur, wenn er für Bundesrat Etter schwärmte, mit dem einen Briefwechsel zu haben ihm eine grosse Ehre war, oder für den päpstlichen Gardekaplan Monsignore Krieg schwärmte, etwas unangenehm auffiel, aber einen Vorwurf gegen den Vater wird man daraus nicht ableiten, er hatte vielleicht keine andere Wahl, denn um der mordsmässigen Autorität der Mutter, welche auch stärkere Männer als ihn umgeworfen hätte, etwas entgegenzusetzen, musste er mindestens einen Bundesrat und einen päpstlichen Gardekaplan in die Waagschale legen. Hatte er nicht denselben Bürgerort wie Bundesrat Etter, nämlich Menzingen/zg, das früher für sein Kloster bekannt war und heute für seine Bloodhound-Raketen? Das war doch gewiss Grund genug, in einen Briefwechsel mit Bundesrat Etter einzutreten, der in seiner eckigen Schrift ihm mehrere Briefe geschrieben hat, mit vorzüglicher Hochachtung, Ihr Philipp Etter. Die lagen dann noch jahrelang neben dem Pfeifentabak in der linken oberen Schublade des Buffets.
Nach den eher fröhlichen Liedern kamen die Geschenke; das kennt man. Kerzenduft erfüllte natürlich mittlerweile die Stube. Und auf dem Esstisch bibberten die Sülze, welche der Revisor vorher in der Badewanne gekühlt hatte, in ihren schönen blechernen Formen. Dann wurde gespiesen, in den spätern Jahren, als Felix seine Braut nach St. Gallen gebracht hatte, mit französischem Einschlag. Dieser hatte nicht, wie es vermutlich den Träumen des Vaters entsprochen hätte, Susi geheiratet, des renommierten Doktor Romers Tochter, sondern Madeleine aus Paris, die von einem Elektriker abstammte, aber immerhin einem aus Paris. Crevetten sah man zum ersten Mal, Gigot war auch noch wenig bekannt. Es kamen jetzt französische Weihnachtslieder auf, il est né le divin enfant und dergleichen. Der zweitälteste Bruder verlor etwa zu dieser Zeit seinen Namen Peter und wurde auf den Namen Hildebrand umgetauft und liess sich die Haare ganz kurz schneiden, weil er ins Kloster eintrat, und eine Schwester, die schönste in der Familie, verlor ihren Namen Vreni und wurde auf Sœur Marie-de-Saint-Jean-l'Evangéliste umgetauft, weil sie den Schleier nahm, und so hatten beide ein Öpferli gebracht, der eine in Fribourg, die andere in der Normandie, das Kloster hiess La Délivrande; und ohne die beiden Musikanten, welche die Religion uns weggenommen hatte (Geige und Klavier), war die Weihnachtsmusik nur noch halb so bedeutend, der doch etwas ungeschickt pfeifende Vater fiel jetzt mit seiner mangelhaft trainierten Querflöte viel stärker auf.
Nach dem Essen dann die Christmette; das kennt man. In späteren Jahren zog es die geschrumpfte Familie in den Dom, dort wurde die schönste Musik geboten in der Stadt. Noch später, auf dem ersten Schallplattenapparat, der auch auf Weihnachten gekauft wurde, kurz nach der Ungarnkrise, hörte man ein perfektes Weihnachtsoratorium, das alles in den Schatten stellte, DEUTSCHE GRAMMOPHONGESELLSCHAFT/ARCHIVPRODUKTION. Die Musik wurde raffinierter, aber man machte sie nicht mehr selber, und der Glaube nahm ab, wenigstens meiner. Er konnte Camus nicht widerstehen, dessen heroische Melancholie dem Gymnasiasten sehr gefiel. Im Dom dirigierte Kapellmeister F. mit ausdruckstarken Händen, und von ihm war in der Familie bekannt, dass er in seiner Jugend für die Mutter eine Neigung gehabt hatte, die er jedoch nie so deutlich artikulierte, dass es der Mutter genügend aufgefallen wäre; erst nach der Heirat erfuhr sie etwas von F.s bis anhin verheimlichten Gefühlen, und so konnte sich der Gymnasiast denn während des Weihnachtsoratoriums vorstellen, wie er doch vermutlich ganz anders herausgekommen wäre mit einem Kapellmeister als Vater, wie gern er den berühmten Namen des F. getragen und so viel weniger Schwierigkeiten beim Einstudieren und Üben des WOHLTEMPERIERTEN KLAVIERS gehabt hätte. Der Vater sass neben ihm in der Kirchenbank, ahnte nichts von den Gedanken des Sohnes, pries nach der Mette die musikalischen Führungskünste von Kapellmeister F., und dann ging man nach Hause, nicht ohne die Spektabilitäten und Honoratioren der Stadt, welche sich auf dem Domplatz breitmachten, zu grüssen, wobei der Vater seinen Hut dann angelegentlichst nach allen Seiten lüftete.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.