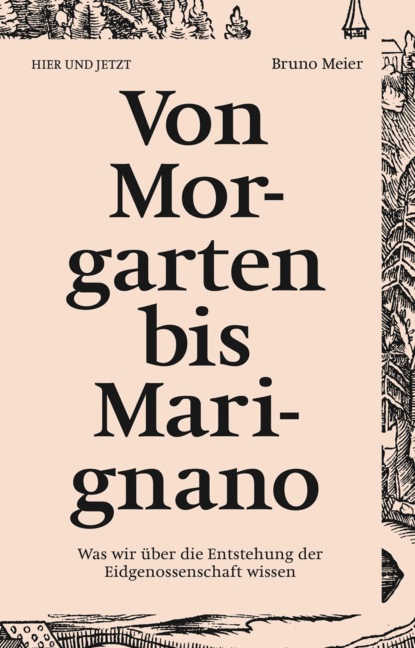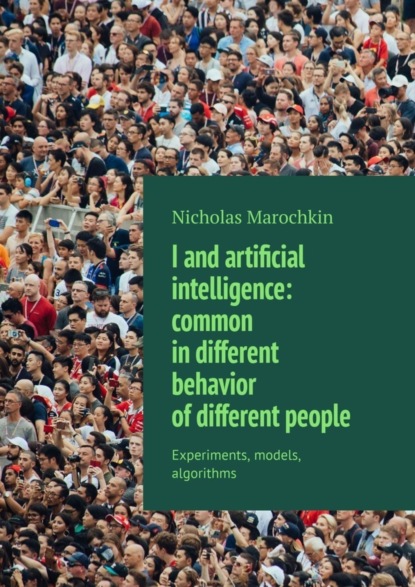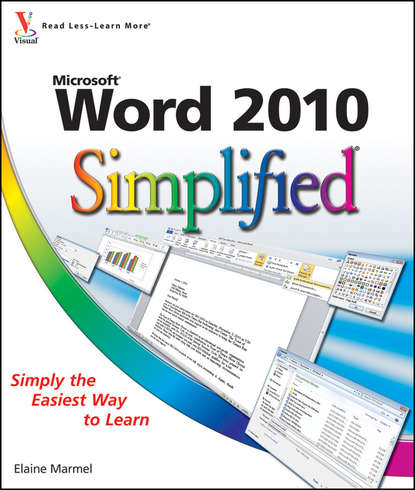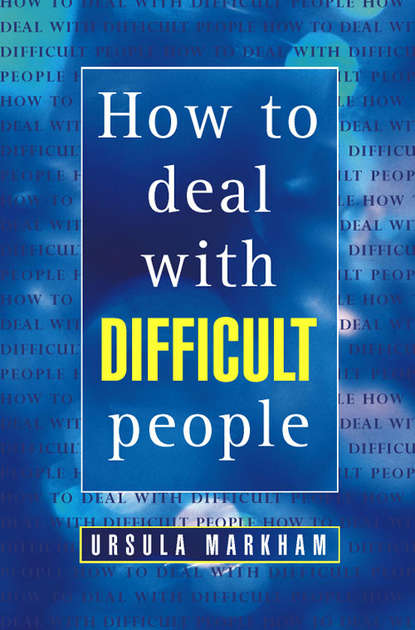- -
- 100%
- +
Die grossen und kleinen Fürsten nutzten diese Situation zum Ausbau ihrer Machtbasis. Wenn der Frieden nicht durch den König und seine Gefolgsleute garantiert werden konnte, mussten die lokalen Machthaber selbst dafür sorgen. Der erfolgreichste dieser Fürsten in den Reichslandschaften Schwaben und Burgund war Rudolf IV. von Habsburg. Er erwies sich in den Jahren nach dem Ende der Stauferwirren als oft geschickter, mal gewalttätiger, dann wieder ausgleichender Politiker. Innert 20 Jahren schwang er sich zum dominierenden Machthaber zwischen Strassburg, Freiburg im Uechtland, Luzern und Konstanz auf. In den 1250er-Jahren erweiterte er seine Machtbasis primär im Elsass und auf dem Schwarzwald. Er heiratete 1254 mit Gertrud von Hohenberg eine schwäbische Adlige, die ihm Besitz beidseits des Rheins im Breisgau und im Elsass in die Ehe brachte. Gleichzeitig schaltete er Kontrahenten wie die Herren von Tiefenstein im Schwarzwald mit Gewalt aus. Die Gründung der Stadt Waldshut und die Vogtei über das Kloster St. Blasien sicherten seine neue Machtstellung ab, die er sich offenbar beidseits des Ober- und Hochrheins aufbauen wollte. Mit der Stadt Basel lag er in Fehde.
Habsburgische Aktivitäten in der Innerschweiz sind in den 1250er- und 1260er-Jahren wenige überliefert. Es scheint sogar eher so, dass die Laufenburger Linie Ansprüche und Güter liquidierte, zum Beispiel in Sarnen, Alpnach und Kägiswil 1257 jeweils an ihre Dienstleute vor Ort.18 So wird auch ein schwerer Konflikt zwischen dem Kloster Murbach und seinem Luzerner Vogt Arnold von Rotenburg im März desselben Jahres vor einem durch den Papst delegierten Richter ohne Zutun der landgräflichen Gewalt, das heisst der Habsburger, entschieden. Bezeugt wird der Entscheid vom regionalen Adel und von Stadtbürgern.19
In die Schweizer Geschichte eingegangen und unterschiedlich interpretiert worden ist ein Auftritt Rudolfs von Habsburg 1257/58 in Uri. Im Dezember 1257 schlichtete er in Altdorf eine Fehde zwischen den Familien Izeling und Gruoba.20 Er trat als Landgraf im Elsass zusammen mit den Landleuten von Uri als Schiedsrichter auf. Im Mai des folgenden Jahres vollstreckte er die Güterliquidation der Izeling, nachdem diese die Fehde nicht beendet hatten. Der Auftritt Rudolfs in Uri wurde verschiedentlich damit in Zusammenhang gebracht, dass die Habsburger in Uri, wie auch in Schwyz und Unterwalden, weiterhin vogteiliche Rechte ausgeübt hätten. Im Wortlaut der Urkunden ist davon aber nichts zu finden. Der Habsburger scheint als neutraler Vermittler vor Ort gewesen zu sein, der im Konfliktfall auch mächtig genug war, die Vollstreckung des Urteils durchsetzen zu können. Es war in diesen Jahren schlicht kein König und auch kein Reichsvogt als Stellvertreter in der Nähe, der Recht hätte durchsetzen können. Der Friede musste mit den Kräften vor Ort gesichert werden.
Der schlichtende Rudolf befand sich kurze Zeit später wieder im Vorwärtsgang. Einerseits im Elsass, wo er in den Jahren nach 1260 seine Stellung zusammen mit der Bürgerschaft von Strassburg gegen den dortigen Bischof festigte. In dieser Fehde stand ihm sein Vetter Gottfried von Habsburg-Laufenburg zur Seite, der seine Aktivitäten mehr und mehr an den Hochrhein verlegte und in der Innerschweiz kaum mehr Präsenz zeigte. Rudolf nahm gleichzeitig Einfluss auf Hartmann V. von Kyburg, den er gegenüber dessen Onkel Hartmann IV. in Schutz nahm. Der ältere Hartmann war der Bruder der Mutter Rudolfs, Heilwig von Kyburg. Er war in kinderloser Ehe mit Margarete von Savoyen verheiratet, der Schwester von Peter II. von Savoyen, der mit den englischen Königen verschwägert war und rund um den Genfersee energisch eine neue Machtbasis aufbaute. Der 1257 gewählte König Richard von Cornwall war sein Neffe, und über ihn erlangte er verschiedene Reichslehen im Aareraum. Der Savoyer wurde so zum schärfsten Konkurrenten der Kyburger und der Habsburger.
Hartmann IV. starb 1264 als letzter männlicher Kyburger, ein Jahr zuvor war bereits sein Neffe verstorben. Dieser hinterliess neben seiner Witwe Elisabeth von Chalon eine Erbtochter, Anna von Kyburg. Zusammen mit dem verwandten Hugo von Werdenberg und seinem Vetter Gottfried konnte Rudolf die Vormundschaft der Erbtochter übernehmen. Der Habsburger wie der Savoyer konnten Ansprüche an das Kyburger Erbe stellen. Rudolf von Habsburg war schneller, nutzte die Abwesenheit Peters von Savoyen, der in Flandern engagiert war, und riss das Kyburger Erbe an sich. Peter von Savoyen versuchte nach seiner Rückkehr an den Genfersee seine Ansprüche im Aareraum mit militärischen Mitteln zurückzuholen, scheiterte aber. Die beiden Kontrahenten einigten sich im Herbst 1267. Die Witwe Margarete von Savoyen wurde abgefunden, kehrte an den Genfersee zurück und verstarb 1273. Fünf Jahre zuvor war bereits ihr Bruder Peter verstorben. Rudolf von Habsburg schwang sich damit zum unbestrittenen Machthaber zwischen Freiburg im Uechtland und Konstanz auf.21
Seinen Anspruch auf das Kyburger Erbe versicherte er in den folgenden Jahren mit dynastischen Mitteln. Nach dem Ableben der Margarete von Savoyen und nachdem Anna von Kyburg volljährig geworden war, verheiratete er diese im Frühjahr 1273 mit seinem Vetter Eberhard von Habsburg-Laufenburg. Gleichzeitig kompensierte er wohl kyburgische und laufenburgische Schulden mit der Übernahme des kyburgischen Besitzes im Aargau und Zürichgau. Dazu gehörten auch – pauschal genannt – Güter und Leute in Schwyz, Stans und den Waldstätten. Diese Urkunde geistert seither als Phantom durch die Schweizer Geschichtsforschung. Sie ist verbürgt über das Archivverzeichnis der Burg in Baden und ist wahrscheinlich im Mai 1415 nach der Eroberung des Steins von Baden und der Plünderung des habsburgischen Archivs durch die Eidgenossen vernichtet worden. Diese Überschreibung ist eines der ungelösten Rätsel der Frühgeschichte der Eidgenossenschaft, weil der genaue Beschrieb der darin verzeichneten Güter und Rechte nicht mehr vorhanden ist.22
Es gibt einige wenige Indizien, die diesen Vorgang verdeutlichen. 1278 verschreibt König Rudolf Johanna von England, der Verlobten seines Sohnes Hartmann, nebst Gütern im Aargau den 1273 verzeichneten Besitz für den Fall einer Heirat. Es war gängige Praxis, eine potenzielle Mitgift auf umstrittenen Ansprüchen zu versichern. Die Verbindung kam aber nicht zustande, weil Hartmann 1281 verstarb.23 Ein auf das Jahr 1281 datierter habsburgischer Pfandrodel wirft weiteres Licht auf die Verschreibung von 1273. Am Schluss des Rodels sind Einkünfte notiert, die dem Grafen Eberhard von Habsburg-Laufenburg, Ehemann der Anna von Kyburg, verpfändet gewesen sein sollen. Es waren dies Einkünfte wahrscheinlich aus Nidwalden (Thomas von Röschenried), von freien Leuten in Schwyz, aus dem Haslital, von den Höfen Froburg und Kyburg (im Land Schwyz gelegen), von Arth, Sempach, Willisau und dem Amt Lenzburg, zusammengezählt 270 Mark Silber. Was war verpfändet, Rechte aufgrund einer Reichsvogtei (Hasli, Schwyz), aufgrund landgräflicher Rechte (Nidwalden, Lenzburg) oder aufgrund von grundherrlichem Besitz (Höfe Froburg, Kyburg und Arth)? Es ist nicht zu unterscheiden und auch nicht zu entscheiden.24 Waren das mehr als Ansprüche? Konnte der Laufenburger diese Einkünfte überhaupt eintreiben? Das Haslital verbündete sich zum Schutz seiner Rechte im Juni 1275 mit der Stadt Bern.25 Vielleicht suchten die Talleute die Unterstützung von Bern gegen die Ansprecher der an den Laufenburger verpfändeten Rechte.
Was klar ist: Wenn inskünftig von habsburgischen Rechten in der Innerschweiz die Rede war, waren es nicht mehr laufenburgische Ansprüche, sondern solche der älteren Linie von Rudolf von Habsburg.
Der neue König ist einer von hier
Bleibt die Überschreibung der kyburgisch-laufenburgischen Rechte im Aargau und in der Innerschweiz nebulös, ist es die Wahl Rudolfs von Habsburg zum König im Herbst desselben Jahres weniger. Rudolf lag im Sommer 1273 erneut in Fehde mit der Bischofsstadt Basel, die er wohl als das natürliche Zentrum seines Herrschaftsbereichs angesehen hätte. Während dieser Belagerung erhielt er die Nachricht von seiner Wahl zum König des Heiligen Römischen Reichs. Richard von Cornwall war verstorben und die Reichsfürsten und der Papst akzeptierten den Gegenkönig Alfons von Kastilien nicht. Nach über 20 Jahren kürten sie quasi wieder einen aus den eigenen Reihen zum König. Zwar kein Reichsfürst mit einem Herzogtum im Rücken, aber einen mächtigen Potentaten aus dem Südwesten, einem der Kernländer des Reichs. Rudolf von Habsburg wird ein Kompromisskandidat gewesen sein. Einer, der selbst nicht zu mächtig war, dem aber die Wiederherstellung der Reichsidee und des Reichsfriedens zugetraut wurde. Er erwies sich denn auch als tatkräftiges und fähiges Reichsoberhaupt, das die Reichsfürsten rasch für sich einnehmen oder falls nötig in die Schranken weisen konnte. Er schaffte es innert weniger Jahre, durch eine aktive Heiratspolitik seine Nachkommen in den wichtigen Reichsfürstenfamilien zu positionieren und seine schärfsten Konkurrenten im Reich zu neutralisieren. Primär war dies der böhmische König Ottokar, der während des Interregnums die östlichen Herzogtümer Österreich, Steiermark und Kärnten aus dem babenbergischen Erbe okkupiert hatte. Rudolf zog die Herzogtümer zuhanden des Reichs ein und musste sie in einem Krieg gegen Ottokar erstreiten, was ihm 1278 gelang. Ganz im Sinn seiner Vorgänger und Nachfolger verband er Reichsmit familiärer Hausmachtpolitik, und er schaffte es, 1282 die Zustimmung der Reichsfürsten zur Verleihung der Herzogtümer Österreich und Steiermark an seine Söhne Albrecht und Rudolf zu erwirken. Das Herzogtum Kärnten ging an seine wichtigen Supporter gegen den böhmischen König, die Grafen von Görz-Tirol, und kam schliesslich 1335 an Österreich zurück. Damit hatten die Habsburger im Osten eine zu ihrem Stammbesitz am Ober- und Hochrhein ungleich grössere Machtbasis gewonnen.26
Was für eine Auswirkung hatte die Wahl Rudolfs zum König im Raum der späteren Eidgenossenschaft? Man könnte sagen, mit Rudolf war einer der ihren zum König gewählt worden. Ein Wechsel auf dem Königsthron war für die unmittelbar dem Reich verpflichtete Gefolgschaft Anlass, sich die Reichslehen oder die Reichsfreiheit bestätigen zu lassen. Nachgewiesen ist dies zum Beispiel für Abtei und Stadt Zürich am 2. November 1273 in Köln, am 8. Januar 1274 für Ammann und Gemeinde von Uri in Colmar, am 15. Januar dann für die Stadt Bern in Basel, am 25. Januar für das Kloster Engelberg und am 26. Januar für das Kloster Einsiedeln, beide Male in Zürich ausgestellt. Am 9. Januar stellte Rudolf in Colmar auch ein Privileg für die Stadt Luzern aus, allerdings nicht als Reichsoberhaupt, sondern als Stadtherr.27 Der neu gewählte König unternahm also nach seiner Krönung in Aachen Ende Oktober seine erste Reise dem Rhein entlang in sein Herkunftsgebiet.
In den ersten zwei Regierungsjahren war der neue König zwischen Bodensee und Genfersee präsent, verhandelte 1275 in Lausanne mit dem Papst über eine Kaiserkrönung, die aber nicht zustande kam. In den folgenden Jahren verlagerten sich seine Aktivitäten in den Osten. Die Auseinandersetzung mit dem böhmischen König und die Gewinnung der österreichischen Herzogtümer standen im Vordergrund. Erst ab 1281 und nach der Konsolidierung der habsburgischen Herrschaft durch seinen Sohn Albrecht in Österreich verlagerte Rudolf von Habsburg seine Aktivitäten wieder in den Westen.
Mit seiner zweiten Heirat mit Elisabeth von Burgund 1284, der Schwester des burgundischen Herzogs Robert, richtete Rudolf sein Augenmerk auf den burgundischen Raum, de jure Teil des Heiligen Römischen Reichs. Für seine Aktivitäten benötigte er Geld. Die geplante Erhebung einer Reichssteuer rief vehementen Widerstand vor allem bei den Reichsstädten hervor, führte zum Beispiel in Hagenau und Colmar im Elsass zu offenem Aufruhr. Aber auch Bern verweigerte sich der Steuer, suchte den Schutz der Grafen von Savoyen und verbündete sich in einer burgundischen Koalition gegen den König. Der König rückte gegen Bern vor, eine überraschende Einnahme der Stadt scheiterte aber. Sein gleichnamiger Sohn schloss die Stadt ein und besiegte im Frühling 1289 ein aus der Stadt ausfallendes Kontingent an der Schosshalde. Bern unterwarf sich dem König, konnte aber seinen Reichsstatus behalten und wurde nicht in den habsburgischen Machtbereich integriert. Der König nahm im Mai desselben Jahres in Baden die Huldigung des Berner Schultheissen Ulrich von Bubenberg entgegen. Anschliessend brach er erneut zu einem Kriegszug gegen Burgund auf. Gemäss der chronikalischen Überlieferung war in seinem Gefolge auch ein grösseres Kontingent aus Schwyz dabei, das vor Besançon mit einem nächtlichen Überfall eine Entscheidung gegen die Koalition des Pfalzgrafen von Burgund erzwang. Wie 1240 vor Faenza waren die Schwyzer als Söldner im Königsdienst engagiert.28
Als ihr Anführer wäre wohl am ehesten Ludwig von Homberg in Frage gekommen, der Ehemann der Elisabeth von Rapperswil und damit Haupt des Rapperswiler Erbes. Allerdings war Ludwig von Homberg im Frühling des Jahres beim Gefecht an der Schosshalde in Bern umgekommen. Das Rapperswiler Erbe, nun wieder verwaist, wird für die nächsten drei Jahrzehnte von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der Waldstätte sein. König Rudolf wird das erkannt haben, hatte er doch schon nach dem Tod des Rudolf von Rapperswil 1283 die Reichsvogtei Urseren zu seinen Handen genommen. Die Nachricht von einem in Urseren abgeschlossenen Bündnis zwischen Oberwalliser Potentaten und dem Kloster Disentis im August 1288 deutet darauf hin, dass auch in der Talschaft Urseren unterschiedliche Interessen gegeneinander standen.29 Eine Steuer in Urseren ist noch im Habsburger Urbar zu Beginn des 14. Jahrhunderts erwähnt, allerdings mit dem Hinweis, die Einkünfte aus Bussen seien so gering, dass sie jeweils dem Ammann vor Ort überlassen werden könnten.30
Zu Beginn des Jahres 1291 reiste der über 70-jährige König von seinem letzten grossen Hoftag in Erfurt zurück in den Aargau und erreichte im Februar Baden. Am 19. Februar bestätigte er in der Bäderstadt den Leuten aus Schwyz, dass sie als Leute freien Standes keine unfreien Richter zu akzeptieren hätten. Dieses Richterprivileg ergänzt wahrscheinlich ein älteres Dokument, das 1282 oder kurz davor in der königlichen Kanzlei Erwähnung fand. Darin hatte Rudolf den Schwyzern zugestanden, dass sie nicht vor auswärtige Gerichte geladen und nur vor ihm, seinen Söhnen oder dem gewählten Richter des Tales belangt werden könnten.31 Ob der König dies im Sinn einer Reichsvogtei oder im Sinne eines landgräflichen Gerichts verstanden hat, wissen wir nicht. Rudolf setzte Reichsvögte ein, die auch als Landvögte über seine Hausmacht eingesetzt waren. Ob diese Vögte aufgrund königlicher oder gräflicher Kompetenzen handelten, ist häufig nicht zu unterscheiden.
Mitte Juli 1291 starb der 73-jährige König in Speyer. Er wurde in der Gruft der salischen Könige beigesetzt. Sein Grab wurde mit einer Platte geschlossen, auf der er sich als alter König, vielleicht sogar lebensecht, hatte porträtieren lassen. Drei Monate zuvor hatte er noch zusammen mit seinem Sohn Albrecht der überschuldeten elsässischen Abtei Murbach für 2000 Mark Silber deren Besitzungen südlich des Rheins abgekauft, das heisst auch die Stadt Luzern mit den Höfen im Aargau und in Unterwalden.
Richterprivileg für Schwyz, Kauf von Murbach-Luzern, kaum identifizierbarer habsburgischer Besitz in Schwyz und Unterwalden sowie das unklare Erbe von Rapperswil: das sind die Ingredienzen, die nach dem Tod Rudolfs von Habsburg für die Entwicklung des Raums rund um den Vierwaldstättersee und am Gotthard entscheidend sein sollten.
Vil krieg in landen. Hertzog Albrecht von Österrich krieget wider sin eigne bluotzfründ und wider andre herren. Zürich und die gräfin von Raperswil verbundend sich zesamen druy jar lang. Die von Bern namend den grafen von Safoi zum Schirmherren bis ein künig erwelt wurd.
Nach künig Rudolfs tod ward ein ufruerisch wunderbar wesen in disen obern landen, dann sin sun hertzog Albrecht von Osterrich was ze kriegen gericht, hat vil herren und stett geistlich und weltlich bi sines vatters seligen des künigs ziten beleidiget. Das tett er aber, wie liecht er ein ansprach fand, im was nieman ze lieb, er verschonet siner eignen blutzfründen nit. […] Es hat ouch gemelter hertzog Albrecht vor vil jaren sin vatter den künig seligen wider die von Zürich ze ungnaden bewegt, die doch etwa des künigs liebste fründ gewesen und einandern beider sits vil diensten getan, das was alles vergessen, dann der hertzog was denen von Zürich gramm und hette si ouch gern under das joch gebracht. […] Es verbündend sich ouch die von Zürich und die gräfin Elsbeth von Raperswil, wilund graf Ludwigs seligen von Homberg verlassne witfrow, uff mitwuch vor Bartholomei dis 1291. jars, drüy jar lang zesamen einandern ze helffen und ze raten mit irn vestinen stetten landen und lüten, lib und guot ze retten. Dise gräfin hat ein sun bi graf Ludwig irm gemachel seligen, graf Wernher genant. Sie ist die letst person des stammens der grafen von Raperschwil gewesen, hat sich harnach wider verhijratet mit dem obgemelten jungen graf Rudolffen von Habspurg, herren zu Louffenberg […]. (Aegidius Tschudi, Chronicon Helveticum, nach Stettler 3, 1980, 110–112)
1291 – ein Wendepunkt?
3
Nach dem Tod des weisen Königs Rudolf von Habsburg 1291 war «ufruerisch wunderbar wesen in disen obern landen», das heisst im Raum zwischen Rhein und Alpen, schreibt Tschudi. Sein Sohn und Nachfolger Albrecht «hat vil herren und stett geistlich und weltlich bi sines vatters seligen des künigs ziten beleidiget», fährt er fort. Dabei waren zum Beispiel die Zürcher «etwa des künigs liebste fründ gewesen». Nun war Albert ihnen gram und wollte sie unter sein Joch zwingen. Aegidius Tschudi erzählt eine andere Geschichte des Jahres 1291 als diejenige, die wir gemeinhin kennen. Er weiss nichts vom Bundesbrief von Anfang August 1291, hat ihn im Archiv in Schwyz nicht gesehen oder nicht zur Kenntnis genommen. Hingegen hat er das Bündnis von Zürich mit Uri und Schwyz von Oktober 1291 gekannt (und fälschlicherweise auf 1251 datiert) und dasjenige von November 1291 zwischen der Stadt Zürich und Elisabeth von Rapperswil.32
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gilt der 1. August 1291 offiziell als Gründungsdatum der Eidgenossenschaft. Wilhelm Oechsli hat dafür im Auftrag des Bundesrats die wissenschaftliche Rechtfertigung verfasst. Nüchtern analysiert er aufgrund der urkundlichen Überlieferung die Entwicklung der Waldstätte im 13. Jahrhundert und setzt den Bundesbrief von 1291 als dramaturgischen Höhepunkt, der dann nach der Schlacht am Morgarten Ende 1315 neu beschworen wird. Auf die chronikalische Überlieferung mit traditioneller Befreiungsgeschichte von Tell, Bundesschwur und Burgenbruch geht er gar nicht ein, sie gehörte nicht zu seiner wissenschaftlichen Analyse. Erst Karl Meyer hat gut 30 Jahre später diese zwei Stränge wieder zusammengeführt.33
Bevor auf die Bedeutung und Einordnung des Bundesbriefs eingegangen werden kann, braucht es einen Blick auf die Ereignisse vor und nach dem Tod des Habsburger Königs und auf die Stellung der uns bekannten Bundesgenossen gegenüber dem Reich und den Habsburgern.34
Der Tod des guten Königs
Rudolf von Habsburg ist teilweise schon zu Lebzeiten und dann kurz nach seinem Tod ein positives Urteil zuteil geworden. Er wird als konsequent in seinen Handlungen, aber auch als weise in seinen Entscheidungen beschrieben. Zahlreiche Legenden ranken sich um seine Person als leutseliger Mensch. Damals gab es noch keine PR-Agenturen, es waren die Chronisten des Dominikanerordens in Colmar, die sein Bild in den schönsten Farben malten.35 Zahlreiche dieser Geschichten wurden weiter kolportiert. Der Kärntner Mönch Johann von Viktring schuf dazu 1340 eine gültige habsburgische Version. Man könnte dieses Bild also auch als gezielte Herrschaftspropaganda bezeichnen. Das positive Bild rührt aber vielleicht auch daher, dass Rudolf sowohl als Familienoberhaupt wie als König grösstenteils erfolgreich agierte. Achtung vor seiner Leistung wird dabei mitgeschwungen haben. Bei näherem Hinsehen zeigt sich der Habsburger als geschickter, aber auch konsequenter Machtpolitiker, dem Vieles gelang und wenig schiefging.
Tschudis positives Bild von Rudolf rührt auch daher, dass der Habsburger während seiner Zeit als Territorialherr wie als König keine schwerwiegenden Konflikte mit den Waldstätten ausfocht, dass er im Gegenteil als Schiedsrichter (Uri) und Erteiler von Privilegien (Uri und Schwyz) im hellen Licht erscheint. Dass er aber seine territorialen Ambitionen zwischen Basel und dem Gotthard gemeinsam mit seinen Söhnen konsequent vorantrieb, darf nicht ausser Acht bleiben. Rudolf von Habsburg wird sich der Bedeutung der Gebiete rund um den Vierwaldstättersee am Weg zum wichtiger werdenden Gotthard bewusst gewesen sein. Die Übernahme des kyburgischen Erbes nach 1264 und 1273, sein Umgang mit dem Rapperswiler Erbe nach 1283 und der Kauf der Murbacher Besitzrechte südlich des Rheins mit Luzern als Mittelpunkt im Frühling 1291 deuten klar auf eine solche Strategie hin.
Der nebulös bleibende Abkauf der kyburgisch-laufen-burgischen Ansprüche im Aargau und der Innerschweiz 1273 lässt auf eine territorial gedachte Abgrenzung hin schliessen: Der burgundische Raum zwischen Thun und Burgdorf für seinen in familiärer Abhängigkeit stehenden Vetter Eberhard, den zentralen Raum am Weg zwischen Basel und dem Gotthard für die eigene Dynastie.
Der Verheiratung der Rapperswiler Erbin Elisabeth mit Ludwig von Homberg nach 1283 könnten ähnliche Überlegungen zugrunde gelegen haben. «Dise gräfin […], wilund graf Ludwigs seligen von Homberg verlassne witfrow, […] ist die letst person des stammens der grafen von Raperschwil gewesen», schreibt Tschudi. Der Homberger war mit seinem Machtbereich im Jura enger Gefolgsmann des Königs. Damit band König Rudolf das Rapperswiler Erbe näher an sich. Gleichzeitig legte er als Reichsoberhaupt Hand auf die Reichsvogtei Urseren. Der Verkauf des restlichen Rapperswiler Besitzes in Uri an das Kloster Wettingen im April 1290 wird kaum ohne Zutun des Habsburgers vonstatten gegangen sein. Ulrich von Rüssegg, Reichsvogt in Zürich, und Hartmann von Homberg, Bruder von Elisabeths von Rapperswil verstorbenem Ehemann Ludwig, siegelten das Geschäft.36 Der Turm und die Güter zu Göschenen, die Teil davon waren, scheinen im Besitz der Urner Ammannsfamilie Schüpfer gewesen zu sein, die ihrerseits zu den Fraumünsterleuten zählte.37 Sie begegnen uns wieder im Kreis der «Bundesgründer» um 1300.
Im April 1288 überträgt die Äbtissin des Klosters Säckingen das Meieramt von Glarus nach dem Tod des letzten Inhabers, des Meiers von Windegg, an Albrecht und Rudolf von Habsburg, die Söhne des Königs und Vögte des Klosters.38 Und drei Jahre später kaufen die Habsburger dem überschuldeten Kloster Murbach sämtliche Güter und Rechte südlich des Rheins ab. Dabei wird Luzern im Vordergrund gestanden haben. Die Stadt war im Lauf des 13. Jahrhunderts zur zentralen Schaltstelle für den Warenverkehr nördlich des Gotthards geworden. In den gleichen Zusammenhang gehörte auch die wahrscheinlich vor 1285 durchgeführte Übernahme der Vogtei Rotenburg, Sitz des Luzerner Vogts, durch die Habsburger.39
Im Umgang mit den Landleuten von Uri und Schwyz, die in den Quellen vor 1290 auftauchen, ist ein «divide et impera», ein «teile und herrsche» zu erkennen. Rudolf scheint die Bedeutung der Talkommunen und auch der Stadtkommune Luzern für den sicheren Passverkehr erkannt zu haben. Er privilegiert sie, beziehungsweise ihre Führungsschicht. Er setzt ihnen aber auch Schranken. Er, beziehungsweise seine Gattin Anna, verbietet 1275 die Besteuerung des Zisterzienserinnenklosters in der Au bei Steinen durch die Schwyzer Landleute und nimmt das Kloster 1289 durch seinen Vogt im Zürichgau, Konrad von Tillendorf, erneut in seinen Schutz. Elisabeth von Görz-Tirol, Gattin des 1298 zum König gewählten Albrecht I. von Habsburg, bekräftigt diesen Schutz noch zu Beginn des Jahres 1299.40 Solche Urkunden entstanden nicht zuletzt dann, wenn reale Konflikte im Raum standen. Die Schwyzer Landleute hatten versucht, das Kloster in Steinen zu besteuern.
Wer waren diese Landleute aber, in welcher Beziehung standen sie zueinander, zu den Gotteshausleuten der Klöster, zum lokalen Adel? Am Beispiel von Schwyz lässt sich dies näher ausleuchten. 1275 treten Rudolf der Stauffacher und Werner von Seewen als Bevollmächtigte der Schwyzer auf. Die beiden werden 1281 in einem Verkaufsgeschäft an Konrad Hunn zusammen mit Ulrich dem Schmid und Konrad Ab Yberg als Ammänner bezeichnet. Diese von Tschudi überlieferte und nicht im Original erhaltene Urkunde führt insgesamt 50 weitere Schwyzer Landleute mit Namen an, ohne dass deren Zugehörigkeit klar wird.41 Ein ähnliches Personal tritt uns in einer Schenkung an die Zisterzienserinnen von Steinen im April 1286 entgegen.42 Im Bündnis von Uri und Schwyz mit der Stadt Zürich von Oktober 1291 treten uns dann die drei Schwyzer Bevollmächtigten Konrad Ab Yberg, Rudolf Stauffacher und Konrad Hunn, auf der Urner Seite Werner von Attinghausen, Burkard (Schüpfer), der alte Ammann, und Konrad Meier von Erstfeld entgegen.43 Sowohl Tschudi wie die Geschichtsschreiber des 19. Jahrhunderts haben in diesen Leuten die Bundesgründer in der Zeit um 1300 gesehen.