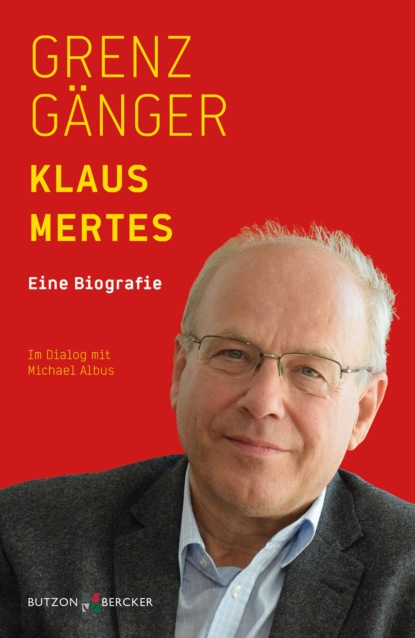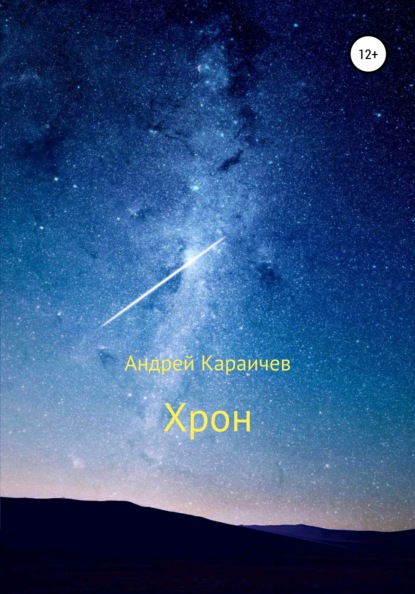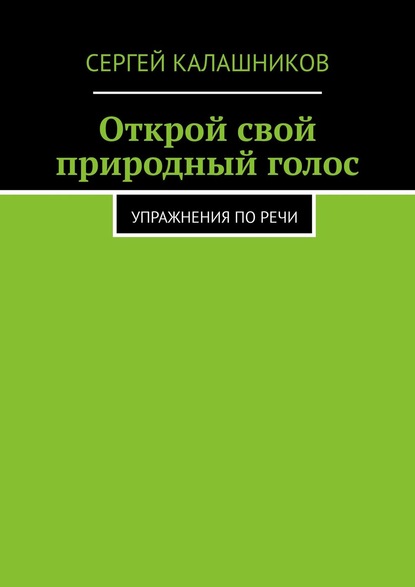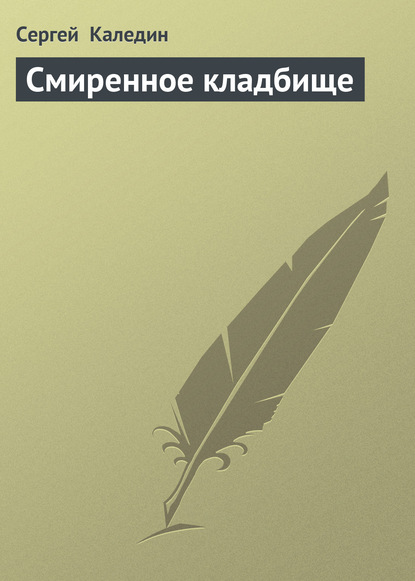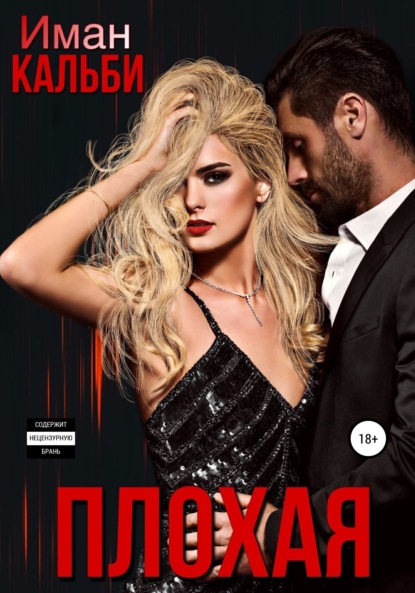- -
- 100%
- +
Wenn mein Vater einmal eine Illustrierte, eine „Quick“ oder einen „Stern“ kaufen musste, weil dort ein wichtiger politischer Artikel stand, dann hat er diesen Artikel ausgeschnitten und den Rest wegen der Bikini- und Nacktbilder gleich in den Müll geworfen. Manchmal lagen wir Geschwister abends vor dem Fernseher und guckten uns irgendeinen Film an. Dummerweise kam mein Vater immer bei den Stellen rein, wo sich Mann und Frau knutschten, und sagte: „Müsst ihr euch so etwas angucken?“ Er lebte in den Diskretions- und Schamgrenzen seiner Zeit, die immer mehr zu schwinden begannen.
1985 ist mein Vater ganz plötzlich, drei Tage nach einem Schlaganfall, gestorben. Selbstverständlich war das für uns alle ein Einschnitt. Was der Tod eines Vaters bedeutet, begreift man erst langsam, im Laufe von Jahren. Direkt danach beschäftigten uns viele Fragen. Die ganze Ernte dieses Lebens wurde für uns angesichts seines Todes auf einmal sichtbar: Die vielen Kondolenzschreiben, die Besuche, das Bemühen, das Erbe meines Vaters zu sichern. Wir haben das Requiem gemeinsam vorbereitet. Die Sprache des Glaubens der katholischen Kirche hat uns dabei die Vorlage gegeben.
Meine Mutter ist dann relativ bald aus dem großen Familienhaus in Wachtberg-Pech bei Bonn ausgezogen in eine Wohnung in Bad Godesberg. Das empfand ich immer als einen starken Ausdruck für ihre Auffassung, dass das Leben weitergeht. Sie trauerte, aber sie haderte nicht. Sie konnte mit Dankbarkeit auf alles Gute zurückblicken, das sie im gemeinsamen Leben mit meinem Vater erfahren hatte.
Die Religiosität meiner Mutter ist, wie die des es Vaters war, ganz tief. Sie ist aber zugleich angefochtener. Und darin ist sie mir dann auch wieder näher.
Die Religiosität meines Vaters hatte bei allem intellektuellen Problembewusstsein doch eine ganz tiefe Unangefochtenheit. Sie wurde aber in den Siebziger-, Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts auch bedroht. Es war für ihn, den Verteidiger der Nachrüstung, eine bittere Erfahrung, mit dieser Position auf Kirchentagen auftretend, dafür beschimpft zu werden. Das – und anderes in jener Zeit – hat ihn in tiefe, innere Krisen geführt. Kirche war für ihn nicht mehr nur Heimaterfahrung, sondern wurde nun auch ein Ort, an dem er infrage gestellt wurde. Das hat ihn emotional verunsichert.
Glück und Erfahrung der Grenze
Zusammenfassend, viele Einzelheiten auslassend, kann ich sicher sagen: Ich hatte eine glückliche Kindheit. Es gab natürlich auch die Brüche und Abbrüche. Ich bin auch an Grenzen gestoßen. Die glücklichen Erfahrungen haben auch Erwartungen an „Familie“ geweckt, die einfach zu hoch waren. Ich lernte später, dass ich eine Verantwortung für mein Leben hatte, die ich nicht der Familie aufbürden durfte.
Irgendwann musste ich dann die Kindheit mit der Wirklichkeit des Erwachsenseins abgleichen. Das war ein sehr schmerzlicher Prozess. Die relativ späte Ablösung von dieser kindlichen Identifikation mit der Familie hat mich Kraft gekostet. Ich musste lernen: Was kann ich heute als Erwachsener von der „alten“ Familie erwarten und was und wo ist da jetzt meine „neue“ Familie, der Jesuitenorden, die Menschen, die mir neu begegnen werden? Ich lernte, eigene überzogene Erwartungen zurückzunehmen.
Wachsende Interessen – Berufswünsche
Eine spannende Sache im Kindheits- und Jugendalter ist die Frage nach dem Berufswunsch. Interessanterweise war bei mir schon sehr früh das Thema „Mönch“ gegenwärtig. Auf den vielen Reisen durch Frankreich haben wir oft Benediktinerklöster besucht. Die Mönche und ihr Gesang haben mich tief berührt. Dann gab es in Frankreich damals auch neue geistliche Bewegungen. In ihnen herausragende Gestalten, die auch meine Eltern faszinierten, wie Charles de Foucauld*, wie Madeleine Delbrêl*. Große Namen – nicht nur für die Eltern, auch für mich. Denen habe ich mich angenähert. Ich fand ihr Eremitsein faszinierend.
Begeistert war ich auch von der Begegnung mit der russischen Literatur, von der russischen Frömmigkeit. Von den Starzen* zum Beispiel. Ich spürte: Religion hat auch etwas zu tun mit radikalen Lebensentwürfen.
In der nachträglichen Reflexion spielt auch etwas anderes eine große Rolle: In den Ostertagen war es in unserer Familie üblich, dass auf dem Grundig-Plattenspieler die Vertonung der Ostergeschichten von Heinrich Schütz* erklang. Da wurde Jesus mit einer Doppelstimme gesungen, Bariton und Falsett-Tenor. Ich dachte immer, der Falsett-Tenor sei eine Frauenstimme, bis mir meine Mutter sagte, das sei eine Männerstimme. Wir Geschwister haben uns gekugelt vor Lachen über diese lustige Männerstimme. Irgendwann, im Alter von 12 oder 13 Jahren, fand ich diese Musik schön. Auf dem halbstündigen Weg mit dem Fahrrad zur Schule habe ich diese Melodien gesungen. Dabei kam auch ein Gefühl von Neid auf: Die Jünger durften den Auferstandenen direkt erleben, und ich muss das denen jetzt, zweitausend Jahre später, glauben. Das fand ich ungerecht. Ich wollte diese Erfahrung selber machen.
Da erwachte das Interesse an Figuren wie Charles de Foucauld und Madeleine Delbrêl und an den Mönchen. Mir wurde klar: Wenn man solche Erfahrungen selber machen will, dann muss man auch bereit sein, etwas einzusetzen. Das bekommt man nicht ohne Preis. So ist die Sehnsucht entstanden nach einem Beruf, der sich mit dem explizit Religiösen verbindet.
Den Eros in der Musik ausgelebt
Was den Eros betrifft, so hatte ich ziemlich rigide Ansichten. Zum Beispiel: Ich küsse ein Mädchen erst dann, wenn ich mich auch entschieden habe, es zu heiraten.
Ich musste also zuerst klären, ob ich ein zölibatäres Leben wirklich will. Vorher kam das Thema „Mädchen“ erst gar nicht dran. Mehrere Jahre habe ich mich allerdings in Constanze verliebt. Das ist die weibliche Hauptrolle in Mozarts Oper „Die Entführung aus dem Serail“. Ich hörte sie 1966, als 12-jähriger Junge, auf einer Platte, gesungen von Maria Stader*. Da habe ich zum ersten Mal, jedenfalls für mich erinnerlich, den Eros gespürt. So etwas Herrliches! Ich brauche mir heute die Entführung aus dem Serail gar nicht mehr auf CD oder in der Oper anhören. Ich muss mich nur hinsetzen, dann höre ich sie schon. So etwas Schönes! Ich habe mich verliebt in Maria Stader. Wenn ich Opern gehört habe, habe ich alle Liebesarien mitgesungen. Da habe ich den Eros singend ausgelebt.
Auch wenn ich selber musiziert habe. Dann habe ich mich in manche Musikerinnen, mit denen ich musiziert habe, verliebt. Auch beim Chorsingen war das so. Ich hatte dann auch Zweifel, ob es nicht zu früh sei, mich für ein explizit religiös-zölibatäres Leben zu entscheiden. Ich müsste doch erst das Leben ganz kennenlernen! Das war dann die Zeit, in der ich dachte, ob ich nicht doch Musiker werden sollte. Mein Chorleiter hat mir vorgeschlagen, meine Stimme ausbilden zu lassen, weil ich angeblich einen Heldentenor hatte. Den gibt es nämlich selten. „Tristan“ war da natürlich eine irre Rolle. „Liebestod“ kann ich ganz und gar verstehen.
Eine andere Frage war, ob ich nicht in die Politik gehen soll. Politik hat mich auch sehr fasziniert.
Ich bin dann zunächst zur Bundeswehr gegangen. Das war damals ein Bekenntnis gegen den politischen Mainstream in meiner Generation. Ich kam zum Stabsmusikkorps. Da ging es relativ harmlos und ziemlich unmilitärisch zu. Ich konnte den längeren Teil meiner Dienstzeit als Bratschist mit dem „Streichquartett der Bundeswehr“ durch die Lande fahren und konzertieren.
Dann habe ich auch noch zwei Jahre Latein, Griechisch und Russisch in Bonn studiert. Das war ein Kompromiss: Einerseits nahe an meinen Interessen studieren, aber nicht Philosophie und Theologie.
Aber dann habe ich gesagt: Ich muss es jetzt einfach wagen, mit meiner Sehnsucht einen Schritt zu machen, und sehen, ob das klappt oder nicht.
Scherzhaft sage ich heute gelegentlich: Ich hatte zwei Berufswünsche. Ich wollte Musiker werden und ich wollte Politiker werden. Beides kann ich in meinem heutigen Beruf gut miteinander verbinden: Ich kann öffentlich singen und öffentlich reden.
Letztlich war mein Weg bis zur Berufsentscheidung dann doch ein gerader Weg. Ich konnte die Entscheidung nicht mehr aufschieben. Das Drängen war da, die Sehnsucht war da. Dass es dann der Jesuitenorden war, in den ich eingetreten bin, hing damit zusammen, dass ich als Schüler einer Jesuitenschule, dem Aloisiuskolleg in Bonn/Bad Godesberg, Jesuiten begegnet war. Im Blick auf die mögliche Variante „Benediktiner“ gab es die Faszination des gemeinsamen Singens. Das habe ich längere Zeit überlegt. Aber da war dann, durch die lange Schulzeit bei den Jesuiten bedingt, die Faszination des Intellektuellen (das ich den Benediktinern natürlich nicht absprechen will), die Möglichkeit, wirklich kritisch denken zu dürfen, stärker. Meine Lehrer auf der Jesuitenschule waren oft religionskritischer als die Religionskritiker. Wir haben Marx, Freud und Feuerbach richtig durchgearbeitet. Als ich an der Universität war, konnte ich mich mit den Linken an der Uni fundiert auseinandersetzen. Das kam alles noch hinzu.
Aber im Kern war es das Nicht-mehr-aushalten-Können, die zunehmende Unzufriedenheit damit, die eigene Entscheidung weiter hinauszuschieben und auf irgendeine Sicherheit zu warten, die es nicht gab und nicht gibt. Das Studium von Latein, Griechisch und Russisch an der Universität in Bonn war natürlich schön. Aber es hat mich nicht erfüllt.
Musik? Da hat mir die Eitelkeit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe vorausgesehen: Am Ende werde ich dann doch ein Leben lang kein Solist werden. Ein halbes Jahr, im Sommer 1975, war ich in Südafrika, in Durban, im Symphonieorchester angestellt. Zwischen Bundeswehr und Studium hatte ich da blind ein Stellenangebot angenommen. Nach fünf Monaten begann ich mich in den Proben eher zu langweilen. Kein gutes Zeichen. Ich habe bemerkt: Wenn schon, dann würde ich gerne ein Itzhak Perlmann* werden, dann ja. Aber das war eine Illusion! Und für ein professionelles Streichquartett war ich wohl auch nicht gut genug. Ich habe auch gespürt: Ich bin vermutlich nicht so sehr Musiker, dass die Musik mein ganzes Leben erfüllen wird.
Die Entscheidung war gefallen – Eintritt in den Jesuitenorden
Ich habe das Studium mit dem Vordiplom abgebrochen und bin 1977 im Alter von dreiundzwanzig Jahren in den Jesuitenorden eingetreten.
Meine Eltern haben mich nach Münster ins Noviziat gefahren. Meine Mutter war sehr gefasst. Ich sah die Tränen der Rührung bei meinem Vater. Er konnte manchmal Tränen nicht zurückhalten. Dem Novizenmeister sagte er: „Pater Werner, ich übergebe ihnen meinen Sohn!“ Da ist insgeheim vielleicht ein eigenes Lebensthema bei ihm angeklungen. Der ältere Bruder meines Vaters, Johannes, mein Patenonkel, war Priester der Diözese Trier gewesen. Und ich bin ganz sicher, dass mein Vater lange mit sich gerungen hat, Priester zu werden. Warum er es nicht geworden ist? Sicher auch, weil er meine Mutter kennengelernt hat. Aber vor allem wohl, weil er schon vorher für sich zu dem Schluss gekommen war, dass Ehelosigkeit nicht sein Weg war. Aber er hatte ebenso wie meine Mutter eine tiefe Achtung vor dem Priesterberuf. Immer waren Priester zu Gast in unserer Familie. Johannes starb plötzlich und sehr früh, mit nur 53 Jahren. Die Mertes-Männer, scheint es, sterben früh. Das war bei meinem Vater auch der Fall. Er wurde nur 63. Nachträglich könnte ich sagen: Mein Drängen zum Priesterberuf war, familiensystemisch gesehen, etwas, das im Familiensystem meines Vaters grundgelegt war.
Aber auch im Familiensystem meiner Mutter. Ein Großonkel von ihr, den ich allerdings nie persönlich kennengelernt habe, war auch Jesuit gewesen. Meine Mutter stand ebenfalls positiv zu meiner Entscheidung und hat sie von Anfang an gestützt und begleitet. Sie ist dann auch – zumal mein Vater immer weiter weg in der Politik war – zur wichtigeren Gesprächspartnerin für mich geworden. Sie war auch als Telefonseelsorgerin in den pastoralen und kirchlichen Fragen stärker „drin“. Ich konnte mich auch mit kritischen Fragen an sie wenden.
Mein Vater schätzte die jesuitische Theologie. Er bewunderte Pater de Lubac*. Aus der Nachkriegszeit in der deutsch-französischen Studentenbewegung war Pater de Rivau* eine wichtige, beinahe väterliche Persönlichkeit für ihn. Auf der anderen Seite waren die Entwicklungen im Jesuitenorden in den Siebziger- und Achtzigerjahren so, dass sie nicht im Mainstream der damaligen CDU-Politik lagen. Ich erinnere mich, als ich an Weihnachten 1977 für drei Tage aus dem Noviziat nach Hause kam, an ein Gespräch, bei dem ein Professor und Freund meines Vaters dabei war. Dieser Freund war allerdings besonders konservativ, sodass es auch meinem Vater oft zu weit ging. Wie auch immer: Wir saßen am Tisch, und der Freund fing an, über die Jesuiten zu schimpfen, und sagte: „Die Jesuiten von heute sind alle Marxisten!“ Ich erinnere mich auch, dass mein Vater nicht besonders erbaut war, dass Jesuiten zum Beispiel vor Mutlangen gegen Pershing-Raketen* protestierten. Oder dass lateinamerikanische Mitbrüder, die in der Befreiungstheologie* aktiv waren, in einer Weise mit marxistischem Vokabular umgingen, die seinen ideologiekritischen Maßstäben widersprach. Er hatte zudem noch 1968/69 ein Sabbatical in Harvard absolviert und dort im Seminar bei Henry Kissinger* geforscht und gelehrt. Dass die lateinamerikanische Theologie und die dortige Kirche die USA für die Lage in Lateinamerika verantwortlich machten und Kissinger umgekehrt die Jesuiten für gefährlich hielt, brachte ihn in Loyalitätskonflikte – so meinte ich es jedenfalls manchmal zu spüren.
Mein Vater rief mich gelegentlich an, und wir sprachen dann auch über solche Spannungen. Ich hatte dabei das Gefühl, dass er mir sein theologisches Vermächtnis übergeben wollte. Das bestand im Kern darin, mir die Relativität von Politik und die Relativität dessen, was Politik leisten kann, vor Augen zu führen. Ein wichtiger Gedanke, den er letztlich von Augustinus und Luther geerbt hatte, war, dass es gar keine Möglichkeit gibt, als Politiker „ohne Sünde“ zu entscheiden, weil die Dilemmata der Politik so sind, dass man am Ende nur noch die Hände falten und auf die Barmherzigkeit Gottes hoffen kann – aber trotzdem entscheiden muss. Das war ein „Schlüssel“, den er mir immer wieder in die Hand gegeben hat und den ich bis heute mit mir trage. Das stimmt ja auch.
Ich habe von meinem Vater auch das Wissen geerbt, dass es wirklich schwierige ethische Dilemmata gibt, ausweglose Situationen, insbesondere dann, wenn man selbst in verantwortlichen Positionen steckt. Und dass alle, die meinen, man kann sie auf eine einfache Formel bringen, danebenliegen.
Aber in der radikalisierten Sprache der Achtzigerjahre war eine Eindeutigkeit drin, die ihm Sorgen machte.
Die Entscheidung für die Jesuiten war intuitiv
Zurück zum Eintritt in den Orden. Ich bin eingetreten, ich war da, und meine Entscheidung war gefallen. Punkt! Das ging sogar so weit – das Noviziat ist ja dazu da, dass man sich zwei Jahre prüft, ob man die Gelübde ablegen will oder nicht –, dass ich gar keinen Anlass sah, mich zu prüfen, ob meine Entscheidung richtig war oder nicht. Sie war für mich klar.
In den Großen Exerzitien des Ignatius von Loyola*, des Gründers des Jesuitenordens, werden drei Wahlzeiten, das heißt: drei Weisen der Entscheidung genannt: Die erste ist intuitiv. Bauchgefühl. Die zweite besteht in der bewussten Abwägung von Emotionen: Wo empfinde ich mehr Freude, wo empfinde ich mehr Traurigkeit? In der dritten Wahlzeit werden Pro und Contra rational gewichtet. Bei mir war es wohl die erste Wahlzeit: Bauchgefühl. Ich bin dann zwar ganz schnell in massive Verunsicherungen hineingeraten. Sie stellten aber überhaupt nicht für mich infrage, dass meine Entscheidung richtig war.
Der Eintritt in den Jesuitenorden war für mich alles andere als ein Abschluss. Er war der Beginn eines neuen Weges, der mich in mich völlig überraschende, neue Welten hineingeführt hat.
Ein total bunter Haufen – Befremdliche Erfahrungen
Ich bin aus traditionsbejahenden Gründen Jesuit geworden. Und trat dann in einen Jesuitenorden ein, der gerade dabei war, die Traditionen, eine nach der anderen, abzuräumen. Mir sind im Noviziat Typen begegnet, denen ich bisher noch nie begegnet war oder die für mich der Inbegriff des Schreckens waren. Zum Beispiel langhaarige, gitarrespielende Wilhelm-Wilms-Lieder singende Freaks. Seufz! Ich war ja eher hochkirchlich geprägt, auch von der Orthodoxie her. Für mich war schon, wie auch für meinen Vater, die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils auch mit Abschiedsschmerzen verbunden gewesen. Mir war das conferenciérartige Auftreten von Priestern, die „da vorne“ Traditionen abschafften, ein Gräuel. Da fielen Traditionen, die meine Eltern und mich geprägt hatten, einfach weg. Auch musikalisch. Ich war ja eher noch bei Mozart und Heinrich Schütz. Die Melodien der neuen geistlichen Lieder und oft mehr noch die Texte waren mir sehr fremd, vor allem im Kontext von Gottesdienst. Befremdend war für mich auch das Erlebnis von charismatischen Gottesdiensten, waren Mitbrüder, die in der Charismatischen Bewegung* engagiert waren und mit großer Überzeugung behaupteten, dass sie den Heiligen Geist erfahren hätten. Für meine intellektuell geprägte Frömmigkeit war es irritierend, wenn Gottesdienstteilnehmer plötzlich anfingen, in Zungen zu reden. Mit anderen Mitbrüdern, die das ähnlich empfanden, bin ich abends zusammengesessen, und wir haben darüber abgelästert, um überhaupt mit dieser Fremdheit zurechtzukommen. Inzwischen habe ich oft für dieses hochmütige Lästern nachträglich um Verzeihung gebeten.
Der Orden war zu jener Zeit ein total bunter Haufen. Der Noviziats-Jahrgang, der vor mir eingetreten war, war bis auf zwei Mitbrüder komplett ausgetreten. Die traten dann auch noch eine Woche vor der Ablegung der Gelübde aus, sodass vor uns plötzlich alles leer, niemand mehr da war. Ich spürte: Da ist eine tiefe, tiefe Verunsicherung.
Ich hatte mich eher auf einen monastisch gegliederten Tagesablauf gefreut. Das Gegenteil war der Fall! Es gab natürlich eine Ordnung: Tägliche Messe, Instruktionen und so. Aber ansonsten war das eine bunte Truppe. Das große Thema, das unser Novizenmeister immer wieder aufbrachte, hieß „Eigenverantwortung“, oder Freiheit, Sich-nicht-Unterwerfen unter eine sakralisierte Lebensordnung. Er gehörte der Generation der Reformer nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil an und ließ alle Debatten zu. Ganz schnell bekam ich ein Autoritätsproblem. Ich forderte ihn auf: „Jetzt sag’ doch mal, wie wir’s machen sollen, und dann machen wir es so!“ „Nee“, sagte er. Wir mussten uns täglich zusammenraufen, mussten über Fragestellungen sprechen, die ich einfach ärgerlich fand. Stundenlang haben wir beim Abendessen zum Beispiel darüber diskutiert, ob in der Fastenzeit Bier getrunken werden darf oder nicht. – Es war im Grunde eine WG-Situation, in der man das Rad des Zusammenlebens mehr oder weniger neu erfinden musste. Heute bin ich meinem Novizenmeister für seinen Widerstand gegen mein Drängen nach autoritären Klärungen sehr dankbar.
Sehr schön war im Noviziat, dass direkt nebenan das Altersheim war. Da schlurften die ganz alten Mitbrüder rosenkranzbetend durch den Park. Die kamen dann manchmal zu uns Jungen und sagten, dass sie sich Sorgen machten über den liberalen Kurs, den der Orden nun eingeschlagen hatte. Ich konnte denen innerlich schon Zuneigung und Zustimmung entgegenbringen.
Den Rosenkranz hatte ich als Kind und Jugendlicher auch gebetet. Wenn wir in Gerolstein waren und es ein Gewitter gab, dann haben wir die Rollläden zugemacht, eine Kerze angezündet und den Rosenkranz gebetet. Das war eben unsere Welt. Viele von meinen Mitbrüdern fanden es hingegen unverständlich, Rosenkranz zu beten. Es wurden Dinge abgeschafft, die ich gern hatte, die ich geliebt habe. Die waren einfach plötzlich weg. Da habe ich mich dann innerlich auch manchmal zu den älteren Mitbrüdern geflüchtet. Ich habe das Väterliche gesucht. Aber ich wusste auch: Das ist ja nicht die Zukunft! Das waren ja alte Männer, zum Teil auch pflegebedürftig, jedenfalls nicht meine künftigen Gefährten.
Im Noviziat wurde für mich einfach alles infrage gestellt. Unter den Novizen waren auch welche, die schon Theologie studiert hatten. Die redeten in einer Sprache, die ich überhaupt nicht verstand. Ich fühlte mich intellektuell nicht anschlussfähig. Dann schleppte mich plötzlich mal einer von ihnen mit zu einer Vorlesung von Johann Baptist Metz* in Münster. 1977 kam auch gerade sein Buch Zeit der Orden? heraus, in dem er die prophetische Funktion der Orden hervorhob. Propheten, das waren für mich bisher die großen Propheten der Bibel gewesen. Dass es heute Propheten gibt und dass wir es sogar sein sollten, das lag mir völlig fern.
Das Noviziat war für mich eine große Konfrontation mit einer mir bisher völlig fremden Welt. Aber ich verlor dennoch nie die Gewissheit, dass ich mit meiner Grundentscheidung richtig lag. Die Entscheidung war gefallen. Bis heute. Letztlich nie mehr grundlegend angefochten. Es hat Krisen gegeben. Ich war immer auf der Suche nach Beziehungen im Orden, nach Freundschaften, nach Nähe. Ich konnte ja nicht nur in Konflikten leben! Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte habe ich auch ganz viel geschenkt bekommen. Es sind Freundschaften auch im Orden und auch mit anderen Ordensleuten entstanden, auch mit Nichtordensleuten, mit Mitstudierenden, mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern. Heute bin ich sehr dankbar für die vielen Menschen, die zu mir gehören und zu denen ich gehören darf.
Der Jesuitenorden hat auch meinen Blick auf die Religiosität, aus der ich stamme, verändert. Ich lebe nicht mehr einfach nur aus den Quellen meiner Kindheit. Ich bin jetzt 39 Jahre im Orden.
Der Orden sieht heute anders aus als in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts. Es wurden auch in den Achtziger- und Neunzigerjahren neue Formen gefunden, neue Verlässlichkeiten, auch neue Standards. Der Orden ist in seinem Selbstverständnis komplett erneuert worden. Vor allem in der Zeit des Generals Pedro Arrupe*. In seinem Verhältnis zur kirchlichen Hierarchie versteht sich der Orden heute anders als im 19. oder 20. Jahrhundert. Die langen Jahre unter den Päpsten Johannes Paul II. und Benedikt XVI., die ja dem Orden misstraut und das auch öffentlich gesagt haben, haben den Orden auch geprägt und die Erneuerung vertieft.
Der Orden ist heute, vor allem in der jungen Generation in Deutschland, in einem Rückzugsprozess. Während in anderen Ländern, insbesondere in Südostasien, inzwischen auch in Afrika, eine ganz andere Dynamik zu spüren ist. Wir haben Teil an der Verschiebung der kirchlichen Gewichte von Norden nach Süden.
Wortwechsel
Unversehens waren wir durch die Nennung des Namens von Pedro Arrupe mitten in die bewegten Siebziger- und Achtzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts gekommen. Sie waren auch eine Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils und weltweiter gesellschaftlicher und politischer Umbrüche und Entwicklungen, die nicht ohne Folgen für den Jesuitenorden geblieben waren.
Der damalige Ordensgeneral Pedro Arrupe war eine Schlüsselfigur in diesen Jahren.
Da ich ihn persönlich mehrmals getroffen und kennengelernt hatte, ergab sich aus dem Bericht von Klaus Mertes heraus ein vertiefender Dialog.
Albus
Eben ist der Name Pedro Arrupe gefallen. An ihn erinnere ich mich lebhaft. Er hat mich beeindruckt bei den Kontakten, die ich als Journalist mit ihm hatte. Ein Beispiel: Als ich in Mexiko während der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz, 1979, die Berichterstattung für die Sendungen heute und heute-journal zu machen hatte, traf ich ihn eines Morgens im Haus der Jesuiten in Puebla, um mit ihm ein geplantes Interview zu besprechen.
Ich sagte zu ihm: „Padre Arrupe, auf dem Tisch vor Ihnen liegt DER SPIEGEL!“ – „Ja und?“, erwiderte er, „das ist meine geistliche Lektüre.“ Das hat mich beeindruckt. Ich war anderes aus meiner kirchlichen Herkunft und Gegenwart gewöhnt.
Wie hat Padre Arrupe auf Sie gewirkt? Wer war er für Sie?