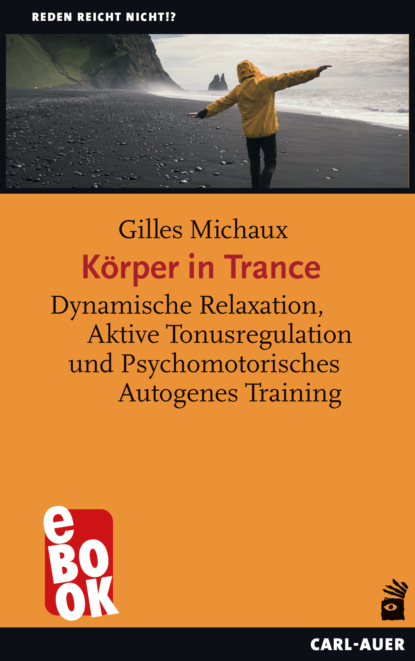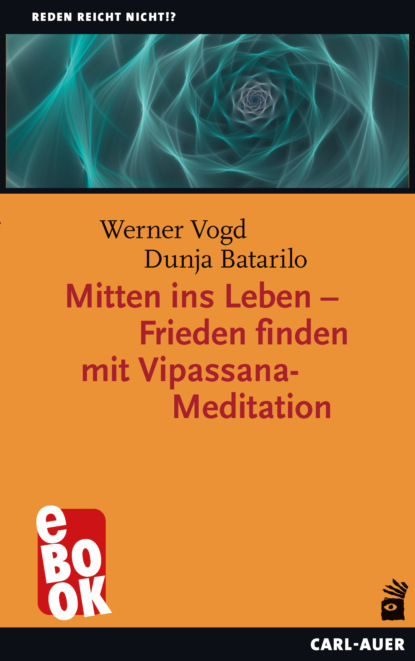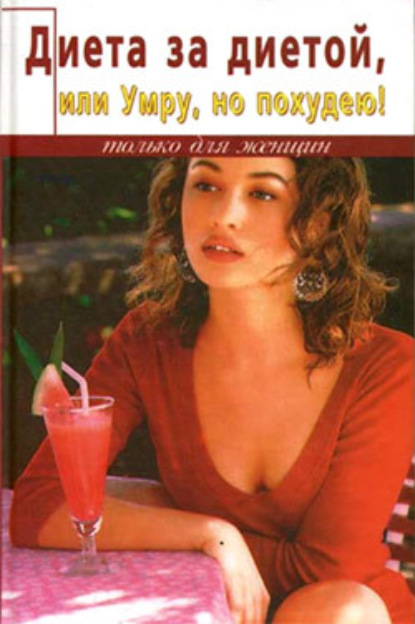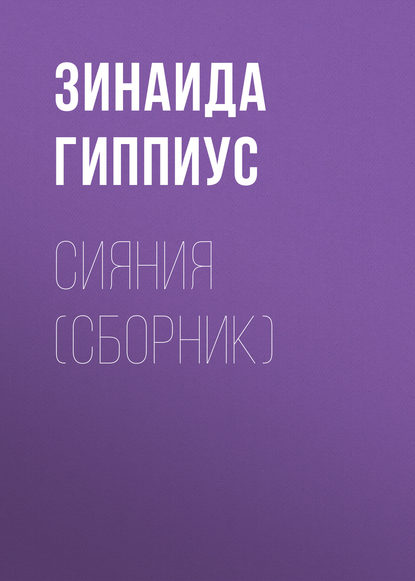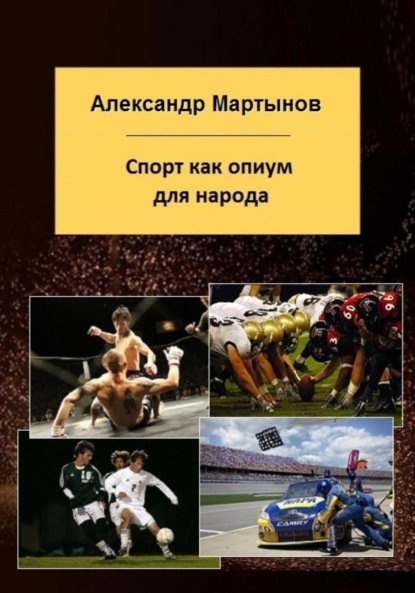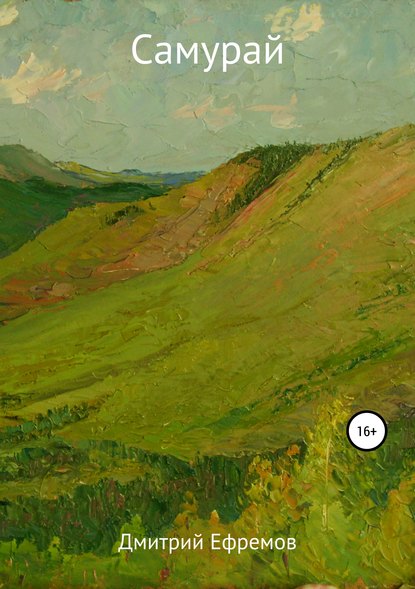Hypnodrama in der Praxis
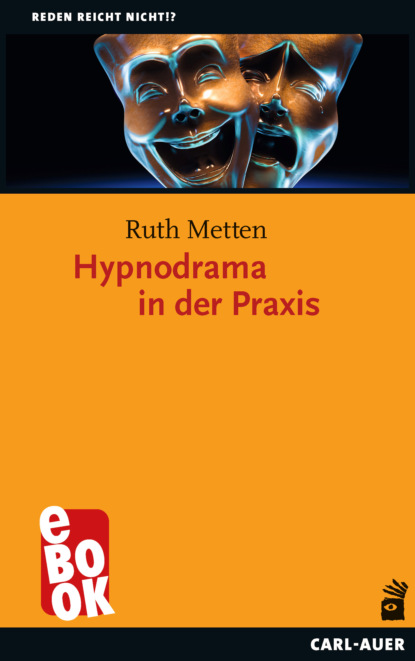
- -
- 100%
- +
Die Aufmerksamkeit wird auf die hypnotische Wirklichkeit ausgerichtet und alles andere ausgeblendet. Das funktioniert nicht nur, wenn wir, wie bei der traditionellen Hypnose, mit geschlossenen Augen beinahe regungslos verharren. So belegen wissenschaftliche Studien, dass die Aufmerksamkeit auch bei der Aktiv-Wach-Hypnose hochfokussiert ist, während es zugleich an Realitätsprüfung mangelt, das Erlebte also unkritisch als real gewertet wird (vgl. Bányai, Zseni a. Túry 1993, pp. 272, 286, 288; vgl. Bányai, Mészáros a. Greguss 1981; vgl. Mészáros, Bányai a. Greguss 1981). Ob unbewegt oder motorisch rührig – in beiden Fällen können wir in Hypnose sein.
Allein, was nützt es im Psychodrama, nur körperlich aktive Teilnehmer zu haben, wenn diese zugleich in ihre hypnotische Innenwelt versunken bleiben und alles andere ausblenden? So könnten vielleicht noch Aktionen, hingegen gewiss keine Interaktionen stattfinden. Dem Handeln der Teilnehmer fehlte schlicht der aufeinander ausgerichtete Bezug. Aber wie uns der amerikanische Psychologe und Ericksonschüler Jeffrey K. Zeig erklärt, kann in Hypnose beides geschehen: Menschen können dabei entweder in eine innere oder in eine äußere Wahrnehmung vertieft sein (vgl. Zeig 2014).22 Ihre Aufmerksamkeit müsse nicht unbedingt nach innen gerichtet sein, wie es traditionelle Hypnose ansätze vertreten. Tatsächlich bestehe die Möglichkeit, dass Menschen in Hypnose sogar hyperalert und extrem stark außenorientiert seien (vgl. Zeig 2014).23
Genau das brauchen wir, wenn Psychodrama in Hypnose stattfinden soll. Es reicht nicht, wenn die Teilnehmer dabei wach und aktiv sind, aber auf eine hypnotische Innenwelt bezogen bleiben. Sie müssen sich außenorientiert verhalten, in eine gemeinsame hypnotische Außenwelt eintauchen können. Hypnodrama bedeutet, dass die Teilnehmer ganz in die Wirklichkeit ihres gemeinsamen Spiels versunken agieren und nicht mehr realisieren, dass es sich »nur« um die Geschehnisse auf einer therapeutischen Bühne handelt, weil sie alles andere ausblenden. Klingt das noch merkwürdig für uns? Fällt es mit diesem Verständnis von Hypnodrama noch schwer zu akzeptieren, dass es so etwas gibt? Vielleicht wird jetzt der eine oder andere sogar denken: »Wenn das Hypnodrama ist, dann habe ich es schon häufig erlebt.« Stimmt. Denn als Kinder waren wir Weltmeister darin.
Also, es geht. Hypnodrama ist kein Hirngespinst, sondern ereignet sich tatsächlich, sogar viel öfter, als wir vermutlich dachten. Doch wozu das Ganze? Warum nicht einfach nur das Psychodrama anwenden? Wieso es in Hypnose stattfinden lassen? Was soll das bringen?
1.3.2Was bringt die Hypnose dem Psychodrama?
Erinnern wir uns kurz daran, wie Moreno das Hypnodrama entdeckte (siehe Abschnitt 1.3). Rein zufällig soll es geschehen sein, und zwar in einem Moment, als er mit den psychodramatischen Technik en zunächst nicht weiterkam. Seine Hauptspieler in litt damals unter sexuellen Wahnvorstellungen und Albträum en. Jede Nacht wurde sie vom Teufel heimgesucht, der mit ihr schlief. Eine quälende und peinliche Angelegenheit, nicht wahr? Wer wollte sich damit schon freiwillig konfrontieren? Noch dazu auf der Bühne, vor anderen? Niemand dürfte es wundern, dass Moreno zunächst vergeblich versuchte, sie dazu zu bringen, ihre Erinnerungen in Szene zu setzen. Doch dann wurde er sehr befehlend. Dem konnte sie sich offenbar nicht widersetzen. Sie fühlte sich gezwungen, ihm zu entsprechen, was ihr nur gelang, indem sie ihr Monitoring ausblendete, »vergaß«, dass sie vor anderen agierte und mit wem sie es wieder zu tun bekam. Wollte sie Moreno Folge leisten, blieb ihr kein anderer Weg, als sich ganz auf ihre Albtraumwelt zu fokussieren – d. h. in Hypnose zu gehen. Auch die traumatisierten Soldaten, die Enneis im Zweiten Weltkrieg behandelte, konnten ihre Abwehr gegen eine neuerliche Bewusstwerdung ihrer furchtbaren Erlebnisse aufgeben, indem sie in Hypnose gi ngen. In beiden Fällen wirkte die Hypnose – um es mit Morenos Worten auszudrücken – wie ein psychologischer Starter (vgl. Moreno 1950, p. 6; vgl. Enneis 1950, p. 12).
Enneis präzisiert diesen Effekt, indem er erklärt, dass die Hypnose den Patienten im Hypnodrama von vielen hinderlichen Barrieren und störenden Einmischungen des eigenen Ichs befreie. Sein Bestreben, zwei Rollen aufrechtzuerhalten – sich also während des eigenen Spiels auch von außen als kritischer Beobachter zu erleben –, werde geschwächt und es sei seinerseits nur noch ein Minimum an Ausweichen und Abwehr spürbar (vgl. Enneis 1950, pp. 12, 52; vgl. Sanders 1977, p. 373). Wie diese Aufrechterhaltung von zwei Rollen durch Hypnose umgangen werden kann, zeigt das folgende Fallbeispiel.
Ein 24-jähriger Klient – nennen wir ihn Emil – wird von einer Gruppenteilnehmerin ausgewählt, die Rolle ihres Vaters zu übernehmen. Darin soll er ihr zu Unrecht Vorwürfe machen und sie lautstark als egoistisch und verantwortungslos beschimpfen. Das fällt dem Klienten sichtlich schwer. Er spricht zwar die ihm vorgegebenen Worte aus, wirkt dabei jedoch zurückhaltend, zögerlich, unsicher. Der Leiter nimmt ihn daraufhin zur Seite und thematisiert die beobachteten Schwierigkeiten. Das stimme, bestätigt der Klient. Er nehme sich zurück, um nicht anzuecken, nichts Dummes oder Verletzendes zu sagen. Ob er sich denn erinnere, irgendwann in seinem Leben schon mal so richtig wütend gewesen zu sein, fragt ihn der Leiter. Ja, als Kind habe er sich einmal furchtbar über seinen kleinen Bruder aufgeregt, weil der ständig mit seiner Trompete rumgetutet habe – trotz der von ihm wiederholt ausgesprochenen Bitte, es nicht zu tun. Schließlich sei er wutentbrannt zu seinem Vater gelaufen und habe ihn aufgefordert: »Mach, dass er aufhört!« Der Leiter bittet den Klienten daraufhin, seine Augen zu schließen und noch einmal der Emil von damals zu sein …, zu fühlen, wie dieser furchtbar wütend auf seinen Bruder sei, … und jetzt zu seinem Vater zu laufen und von ihm zu verlangen, dass er etwas unternehme, damit sein Bruder aufhöre. Es sei hilfreich, wenn Emil dieses »Mach, dass er aufhört!« auch tatsächlich ausrufe. Genau das tut Emil – sogar wiederholt. Daraufhin bittet ihn der Leiter, nun mit dieser Wut die Rolle des Vaters zu spielen, was ihm diesmal – wie von der Teilnehmerin gewünscht – gelingt. Nach Spielende erklärt der Klient der Gruppe, sich anfänglich in seiner Rolle immer gefragt zu haben, »Ist das okay so?«, »Wirke ich komisch?«, »Rede ich zu laut?«. Er habe den Vater gespielt und sich gleichzeitig dabei beobachtet, in der Erwartung, etwas falsch zu machen, sich zu blamieren. Mit dem wütenden Emil sei es ihm möglich gewesen, den Kritiker außen vor zu lassen, hundert Prozent bei der Sache zu sein.
Darin besteht ein Vorteil, den das Hypnodrama gegenüber dem Psychodrama hat. Blockaden und Hemmungen lassen sich hier leichter umgehen (vgl. Supple 1977, S. 224 f.; vgl. Greenberg 1977a, S. 237; vgl. Sanders 1977, S. 374). Denn in Hypnose entfällt das Monitoring, das Gewahrwerden dessen, was geschieht, aus der Perspektive eines distanzierten Beobachters (siehe Abschnitt 1.3.1). Damit erübrigen sich meist Hemmungen, weil nicht mehr realisiert wird, dass das Spiel vor anderen stattfindet. Der Klient kann ganz in seiner Rolle aufgehen (vgl. Supple 1977, p. 224). Auch werden in Hypnose »konkurrierende« Welt en ausgeblendet. Problemtrancen (vgl. Schmidt 2015, S. 45), die die spielerische Darstellung blockieren könnten, treten währenddessen nicht in Erscheinung. Denn wie für Highlander, so gilt auch in Hypnose: Es kann nur einen – respektive eine – geben.24 Wir können uns nicht zugleich bewusst auf zwei oder mehr hypnotische Welt en fokussieren. In einer »drin« zu sein, bedeutet, die anderen verlassen zu haben. Wie hilfreich sich das im Psychodrama auswirken kann, mag das folgende Fallbeispiel verdeutlichen.
Eine 52-jährige Klientin – nennen wir sie Henriette – wird von einem Gruppenmitglied ausgewählt, in der Aktionsphase der Psychodrama-Sitzung die Rolle ihrer Mutter zu übernehmen. Sie stimmt dem zu. In der nachfolgend gespielten Szene geht es darum, dass die etwa 8-jährige Tochter eine Stunde verspätet von der Schule nach Hause kommt, weil sie draußen noch Freundinnen getroffen und darüber die Zeit vergessen hat. An der Tür wird sie von ihrer Mutter mit harschen, vorwurfsvollen Worten in Empfang genommen und ohne weiteren Kommentar zum Hausarrest für den Rest des Tages auf ihr Zimmer geschickt. Von Henriette, die in der Gruppe bisher sehr durchsetzungsstark in Erscheinung trat, ist bekannt, dass sie selbst in ihrer Kindheit unter einer von ihr als herrisch erlebten Mutter gelitten und beständig gegen diese rebelliert hat. Mühelos übernimmt sie im Spiel die Rolle der Mutter der Mitpatientin. Hingegen tut sie sich in einer anschießenden zweiten Szene sehr schwer, eine verständnisvolle Mutter zu verkörpern, die nachvollziehen kann, dass man zusammen mit seinen Freundinnen schon mal die Zeit vergisst, die ihrer Tochter aber auch zeigt, wie viel Sorgen sie sich gemacht hat, und gemeinsam mit ihr überlegt, wie künftig zu verhindern ist, dass so etwas noch einmal passiert, dass die Tochter ihr beispielsweise kurz Bescheid sagt, wenn sie sich verspäten wird. Immer wieder weicht sie davor aus, gegenüber ihrer Tochter Gefühle der Sorge und Angst zum Ausdruck zu bringen, indem sie ihrem eigenen Spiel eine komische Note gibt, über die alle herzhaft lachen müssen. Wie alle Teilnehmer der Gruppe, so ist auch die Klientin bereits in Selbsthypnose geübt. Die Sitzung wird kurz unterbrochen, um ihr – begleitet durch den Leiter – die Gelegenheit zu geben, in Hypnose ganz in die Rolle der besorgten Mutter zu gehen. In ihrem nachfolgenden Spiel erscheint sie wie verwandelt. Sie lehnt nicht mehr lässig am Türrahmen, sondern öffnet ihrer Tochter, sichtlich erleichtert darüber, sie zu sehen, mit den Worten die Tür: »Kind, wo warst du, ich habe mir solche Sorgen gemacht!« Sie äußert Verständnis für die Verspätung der Tochter, macht ihr aber auch deutlich, in welcher Not sie sich befunden hat. Die Tochter erklärt, nicht gewollt zu haben, dass sie sich sorge, und verspricht, künftig Bescheid zu sagen, wenn es bei ihr später werde.
Erst in Hypnose gelang es der Klientin, ihre Abwehr zu umgehen und die zuvor humorvoll umschiffte Rolle zu verkörpern. Auch bei ihr wirkte sie also wie ein Starter. Doch das war nicht ihr einziger Effekt. Im abschließenden Erfahrungsaustausch berichtete Henriette, dass ihr in der Rolle der verständnisvollen Mutter etwas klar geworden sei. Bislang habe sie ihre Gefühle immer weggedrückt, um einen klaren Kopf zu bewahren, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Doch sie könne sie auch zulassen, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren. Das habe sie gerade erlebt. Gefühle zu zeigen, sei sogar wichtig, um Probleme gemeinsam zu lösen.
Was lehrt uns dieses Beispiel? Die Hypnose ist im Hypnodrama definitiv mehr als ein Starter. Sie unterstützt den therapeutischen Effekt des Psychodrama s. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Schon Enneis sprach davon, dass es infolge der Hypnose zu einer stärkeren Katharsis komme (vgl. Enneis 1950, pp. 12–14). Denn dem Klienten falle es dabei leichter, seine Gefühle auszudrücken (vgl. Enneis 1950, p. 13). Auch zeige er auf diese Weise eine größere Spontaneität und Kreativität (vgl. Enneis 1950, p. 13). Beides befähige ihn dazu, Rollen zu spielen, die er ansonsten verweigert hätte (vgl. Enneis 1950, p. 14), und angemessener zu interagieren (vgl. Enneis 1950, pp. 13, 53). Ja, der Klient könne überdies im Hypnodrama Einsicht en gewinnen, auch wenn es ihm nicht gelänge, sie in Worte zu fassen (vgl. Enneis 1950, pp. 13, 53). Henriette aus dem Fallbeispiel vermochte selbst das.
Hypnose wirkt also auch effektverstärkend auf das Psychodrama. Das ist verständlich. So absorbiert, wie wir dabei sind, schirmt sie uns weitestgehend von allen inneren und äußeren Störreizen ab, die dazwischenfunken und damit den therapeutischen Effekt untergraben könnten. Deshalb fällt es uns in Hypnose auch leichter zu lernen (vgl. Halsband 2004, S. 21, 26; 2006, pp. 474, 477; 2009, S. 14; Halsband u. Herfort 2007, S. 18; Halsband et al. 2009, pp. 196 f., 205).25 Ein Phänomen, das Enneis ebenfalls bemerkte (vgl. Enneis 1950, p. 53).
Nun gut. Die Hypnose ist bereichernd für das Psychodrama. Doch wie kommt sie hinein?
1.3.3Wie kommt die Hypnose ins Psychodrama?
Kehren wir noch einmal zu der jungen Frau zurück, die unter sexuellen Wahnvorstellungen und Albträumen litt. Moreno wurde sehr befehlend, um sie dazu zu bringen, ihre intimen Begegnungen mit dem Leibhaftigen zu inszenieren. Alles in ihr hatte sich zunächst dagegen gesträubt. Doch dann richtete Moreno gebieterisch sein Wort an die junge Frau. Untertänig schob sie daraufhin ihr kritisches Denken beiseite und leistete ihm Folge. Klare Anweisungen zu geben, reicht allerdings meist nicht aus, damit andere sich dazu entschließen, solche Direktiven verbindlich für sich anzuerkennen. Sie sollten von einer Autorität ausgesprochen werden. Und die strahlte Moreno zweifellos aus – so intensiv, dass der Hypnotherapeut und Psychodramatiker Ira A. Greenberg gar vermutet, sie allein könne die Menschen schon dazu gebracht haben, in Hypnose zu gehen (vgl. Greenberg 1977a, p. 232). Aber wer ist schon Moreno? Gut zu wissen, dass seine Art kein »Must-have« für Hypnodramatiker ist, sonst könnten wir jetzt wahrscheinlich einpacken. Moreno praktizierte die Technik der direkten Hypnose induktion. Dafür ist entscheidend, dass dem Hypnotherapeut en abgekauft wird, kompetent genug zu sein, um sich ihm anvertrauen zu können. Das dürfte bei entsprechender Ausbildung leistbar sein.
Die Hypnoseinduktion führte Moreno auf der Bühne durch (vgl. Enneis 1950, p. 14). Dort forderte er den Klienten auf, sich in sein Schlafzimmer oder in eine andere Situation zu begeben, die er mit Schlaf assoziierte, und auch die Körperhaltung eines Schläfers anzunehmen (vgl. Moreno 1950, p. 7; vgl. Enneis 1950, p. 14). Als Requisit für sein Bett fungierte eine Matratze oder ein Klubsessel nebst Stuhl, auf den er seine Beine legen konnte. Was dann geschah, beschreibt der amerikanische Psychiater Rolf Krojanker beispielhaft so: Norma – einer Seminarteilnehmerin, die bereit gewesen wäre, an sich die Wirkweise des Hypnodramas vorführen zu lassen – wäre von Moreno suggeriert worden, zu Bett zu gehen. Diese hätte sich daraufhin auf die Matratze gelegt und ihre Augen geschlossen. Moreno hätte ihr gesagt, dass sie nun wieder bei sich zu Hause wäre und schliefe. Dabei hätte er sich über sie gebeugt und sanft und beruhigend ihr Haar gestreichelt. Sein Tun wäre von den Worten begleitet worden: »Atme tief, tiefer, tiefer …, so ist es gut« (vgl. Krojanker 1977a, p. 215). Auch Enneis – Morenos Schüler – führte die Hypnoseinduktion auf diese Weise durch. In dem gemeinsam mit ihm veröffentlichten kleinen Band Hypnodrama and Psychodrama beschreibt er, wie der 24-jährige Johnny, ein junger Mann mit autistischen Zügen und Verfolgungsideen, von ihm in Hypnose versetzt wird. Johnny sollte sich dazu in den bereitstehenden Klubsessel setzen und seine Füße auf dem Stuhl davor ablegen. Dabei wäre er von Enneis aufgefordert worden, sich vorzustellen, wie er auf dem Bett seines Zimmers ruhe. Er hätte ihm gesagt, dass er nun schliefe …, tiefer und tiefer schliefe (vgl. Enneis 1950, p. 17).
Beide – Moreno und Enneis – verwendeten also die Technik der direkten Hypnose induktion. Sie wiesen ihre Patienten an, die Augen zu schließen und tief zu schlafen. Moreno tat überdies noch etwas mehr. Er berührte Norma auch körperlich. Heute lässt sich nicht mehr klären, ob dies absichtlich geschah, um die Hypnoseinduktion zu unterstützen. Jedenfalls handelt es sich hierbei, wie der Arzt und Hypnotherapeut Günter Hole in seinem Buchbeitrag Direkte Induktionen erklärt, um eine Methode mit einer langen kultur- und religionspsychologischen Vorgeschichte (vgl. Hole 2015, S. 188). Nichtsdestotrotz hatte Moreno auf dem Gebiet der Hypnose niemals eine besondere Qualifikation erworben. Deshalb nutzte er zuweilen die Gelegenheit, dass ein ausgebildeter Hypnotherapeut die Hypnoseinduktion durchführte, während er hernach den Part des Psychodramas mit dem Hypnotisierten übernahm (vgl. Supple 1977, p. 225). Dies hätte, so der Hypnotherapeut Leonard K. Supple, den Moreno zu diesem Zweck wiederholt einsetzte, erstaunlich reibungslos geklappt. Für den Hypnotisierten wäre beim Transfer vom einen auf den anderen kein Bruch entstanden (vgl. Supple 1977, pp. 225 –227). Gut zu wissen. Wer als Psychodramatiker nicht darin geübt sein sollte, Hypnosen zu induzieren und zu begleiten, kann sich also Hilfe holen, ohne dass die Qualität des Hypnodramas leidet.
Werden die Klienten allerdings wie oben beschrieben in Hypnose gebracht, tut sich spätestens jetzt ein Problem auf. Dieses besteht weniger darin, dass sie auf diese Weise in der falschen Vorstellung bestärkt werden, Hypnose bedeute zu schlafen. Tatsächlich handelt es sich hierbei um einen Trugschluss. Der liegt zwar nahe, weil sich das Wort Hypnose von Ὕπνος (Hypnos), dem griechischen Wort für Schlaf, ableitet. Tatsächlich ist das aber nicht der Fall (vgl. Halsband 2015, S. 796). Leider sind viele immer noch davon überzeugt.
Doch das ist nicht das Hauptproblem, sondern: Wie sollte jemand, der auf einer Matratze oder einem Klubsessel liegt und dabei die Augen geschlossen hält, aktiv an einem Hypnodrama im Bühnenraum teilnehmen können? Aussichtslos. Das hatten auch Moreno und Enneis erkannt. Deshalb suggerierten sie dem Hypnotisierten, nachdem sie ihn »schlafen gelegt« hatten, dass er nun aufstehen, seine Augen öffnen und sich frei bewegen könnte. Johnny hörte beispielsweise von Enneis zunächst, dass er schliefe …, tiefer und tiefer schliefe. Dann sagte ihm dieser, dass er seine Füße auf den Boden stellen, aufstehen, sich umdrehen und die Augen öffnen sollte. Johnny wäre diesen Aufforderungen gefolgt (Enneis 1950, p. 17). Auch der oben erwähnte Leonard K. Supple suggerierte einer jungen Frau in Vorbereitung auf ihr anschließendes Hypnodrama mit Moreno, dass sie jetzt ihre Augen öffnen, sich frei bewegen, herumgehen, mit anderen reden, Fragen stellen und Antworten geben könnte. Sie wäre in der Lage, alles zu tun, was sie wollte, während sie in einem Zustand sehr, sehr tiefer Hypnose bliebe (vgl. Supple 1977, p. 225). Nach diesen Suggestionen handelt der Klient im Hypnodrama völlig frei (vgl. Enneis 1950, p. 11; vgl. Moreno 1950, p. 7). Auch könne mit ihm, so Moreno, umgegangen werden wie während gewöhnlicher, psychodramatischer Sitzungen (vgl. Moreno 1950, p. 7; vgl. Krojanker 1977a, p. 221). In Hypnose zu sein, erweist sich weder für den Klienten noch den Hypnodramatiker als hinderlich. Im Gegenteil. Sie bringt deutliche Vorteile (siehe Abschnitt 1.3.2).
Direkte Induktion stellt folglich eine Methode dar, das Psychodrama in Hypnose stattfinden zu lassen. Sie ist keineswegs die einzige. Der amerikanische Psychiater und Begründer der modernen Hypnotherapie, Milton H. Erickson, hätte wahrscheinlich eine andere Herangehensweise gewählt, um das Gleiche zu erreichen. Er wandte indirekte Technik en der Hypnoseinduktion an. Eine davon ist sogar ganz hervorragend dafür geeignet, die Teilnehmer des Psychodramas in Hypnose zu bringen – und zwar die Konversationstrance. Denn gerade in größeren Systemen (z. B. Familien, Paaren, Teams, ganzen Organisationen etc.) könne es, wie der Arzt, Psychotherapeut und Entwickler der hypnosystemischen Konzeption Gunther Schmidt erläutert, geradezu hinderlich sein, eine offizielle, den traditionellen Vorstellungen entsprechende Hypnose induktion durchzuführen. Stattdessen ließe sich hier mit Konversationstrance prozessen viel flexibler und wirksamer arbeiten (vgl. Schmidt 2014, S. 20). Deshalb scheint es günstig, auch im Psychodrama auf sie zurückzugreifen, was übrigens sehr gut möglich ist. Bei der Konversationstrance versuche man nämlich, so Schmidt weiter, jemand aus dem Gespräch heraus zur Fokussierung seiner Aufmerksamkeit einzuladen, sodass sich bei ihm die Hypnose ganz wie von selbst einstelle (vgl. Schmidt 2014, S. 20).
Und wie genau macht der Hypnodramatiker das? Indem er bei dem Klienten, der ein Thema aufgebracht hat, interessiert und gezielt nachfragt, ihn in ein intensives Gespräch darüber verwickelt, die Geschehnisse nochmals mit eigenen Worten wiedergibt, sodass nicht nur der Betreffende, sondern möglichst alle Teilnehmer des Psychodramas emotional mitschwingen, sich intensiv einfühlen, die geschilderte Szene derart plastisch erfahren, mit allen Sinnen wahrnehmen, dass sie sich in sie hineinversetzen, sie erleben, als wären sie selbst daran beteiligt – und zwar gerade jetzt (siehe Abschnitt 3.3.2).
Diese Vorgehensweise ist effektiv und fügt sich organisch in den Ablauf des Hypnodramas ein. Deshalb kann hier auf eine offizielle, den traditionellen Vorstellungen entsprechende Hypnoseinduktion verzichtet werden. Nebenbei bemerkt, hat es Erickson, wie wir von Schmidt erfahren, oft genauso gemacht. Nur für maximal 25 % seiner Arbeit seien von ihm in über 50 Jahren Berufspraxis »offiziell« so definierte Hypnoseinduktion en genutzt worden (vgl. Schmidt 2014, S. 92).
Konversationstrancen reichen vollkommen aus, um die Hypnose ins Psychodrama zu bringen. Zudem stellt sie sich hier nicht nur beim Klienten, der das Problem aufbringt, sondern meist bei allen Beteiligten ein. Auch auf jene wirkt die Hypnose wie ein Starter und Effektverstärker und vermag so – gleich einem Brennglas – sämtliche im Psychodrama verfügbaren Kräfte zu bündeln und zu intensivieren.
Die Teilnehmer können übrigens auch lernen, ohne fremde Hilfe in Hypnose zu gehen. Es bietet sich sogar an, ihnen dies beizubringen, bevor die »eigentlichen« Hypnodrama -Sitzungen beginnen (vgl. Greenberg 1977a, p. 252; vgl. Krojanker 1977b, p. 275). Denn Hypnose erfordert hochfokussierte Aufmerksamkeit, und die lässt sich trainieren. Geübt in Selbsthypnose fällt es den Teilnehmern dann später leichter, sich ganz vom Bühnengeschehen absorbieren zu lassen.
Doch weder Konversationstrance noch gezielte Selbsthypnose sind unbedingt nötig, damit aus dem Psychodrama ein Hypnodrama wird. Oft werden die daran Beteiligten nämlich allein schon durch die Intensität der Erlebnisse in einen hypnotischen Zustand versetzt. Eine Erfahrung, die, so die Sozialpädagogin und Hypnotherapeut in Katharina Hilger, beim Psychodrama tatsächlich häufig zu machen sei (vgl. Hilger 1990, S. 151). Hier träten hypnotische Zustände nicht selten als eine Begleiterscheinung auf, die nur durch die Intensität der Erlebnisse, ohne ausdrückliche Induktion, hervorgerufen würden (vgl. Hilger 1990, S. 148). Das Gleiche hatte vor ihr bereits der Psychiater und Psychodramatiker Edward M. Scott berichtet (vgl. Scott 1977, pp. 303 f., 306; vgl. Krojanker 1977b, p. 275). Das Psychodrama vermittelt den Teilnehmern intensive Erlebnisse und wirkt dadurch hypnoseinduzierend. Vielleicht lässt es sich auf diese Formel bringen:
Jedes emotional tief bewegende Psychodrama ist ein Hypnodrama.
Oft muss der Therapeut im Hypnodrama also gar keine gesonderte tranceinduzierende Methode anwenden. Dann reicht schon aus, dass ein Problem durch Schilderungen eines Beteiligten oder Interaktionen innerhalb der Gruppe in Erscheinung tritt. Gelingt es allein dadurch noch nicht, die Teilnehmer emotional tief genug zu bewegen, kann der Therapeut ihr Erleben in der beschriebenen Weise aus dem Gespräch heraus – im Sinne einer Konversationstrance – intensivieren, um sie dabei zu unterstützen, in Hypnose zu gehen. Mehr braucht es in der Regel nicht, um aus dem Psychodrama ein Hypnodrama zu machen.
Und hier gelingt es nun weit besser, jene Wirkung en zu erzielen, die oben für das Psychodrama beschrieben wurden (siehe die Abschnitte 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2). Denn die Hypnose verstärkt den Effekt des Psychodramas, wie bereits erwähnt (siehe Abschnitt 1.3.2). Mit ihr fällt es den Klienten leichter, sich von Affekt en zu entlasten. Durch sie ist ihnen ein umfangreicheres schöpferisches Potenzial verfügbar. Zudem schirmt Hypnose von äußeren wie inneren Störreizen ab, sodass einem Zugewinn an Handlungseinsicht weit weniger im Weg steht. Und schließlich behalten Klienten Erfahrungen, die sie unter Hypnose machen, besser im Gedächtnis. Die Wirkung en des Psychodramas sind also tatsächlich noch zu toppen. Sein Credo gilt zwar nach wie vor: Handeln ist heilsamer als Reden. Aber Handeln in Hypnose ist noch heilsamer.
Gilt dies nur für den Handelnden selbst? Was ist mit den anderen, die ihm zusehen? Lassen seine Erfahrungen sie völlig kalt? Keineswegs. Auch diese erleben eine Katharsis. Moreno nannte sie Zuschauerkatharsis. Mit diesem Begriff bezog er sich auf die Poetik des Aristoteles (vgl. Moreno 1946a, p. 179; 1979, S. 28; vgl. Moreno et al. 2000, p. xvi). Dort hatte der antike Philosoph das griechische Wort κάθαρσις (katharsis )gewählt, um jene Wirkung zu beschreiben, die das Ansehen von Dramen auf die Zuschauer hat. Welche diese sei, dazu machte er in seiner Poetik – zumindest für die Tragödie – genauere Angaben. Moreno, der sich zur Zeit seines Philosophiestudiums in Wien auch mit dieser Schrift beschäftigt hatte (vgl. Moreno et al. 2000, p. xvi), verstand Aristoteles so, dass er davon ausgegangen wäre, die Tragödie sollte die Zuschauer von Affekt en – und zwar denen des Mitleids und der Furcht – befreien (More no 1946a, pp. 14, 29, 179; 1979, S. 28; vgl. Moreno et al. 2000, p. 50). Eine Katharsis im Sinne einer Befreiung von Affekten bewirkt tatsächlich auch das Psychodrama (siehe Abschnitt 1.1.1). Der Fall Barbara hatte es Moreno gelehrt. Durch ihr Spiel auf der Bühne konnte sie sich von Affekt en entlasten (vgl. Moreno 1988, S. 15). Breuer und Freud prägten für dieses Phänomen der Abreaktion den Begriff der Katharsis. Moreno fand ihn in der Poetik des Aristoteles wieder. Wen wundert es da noch, wenn er einige Jahre später schreibt: