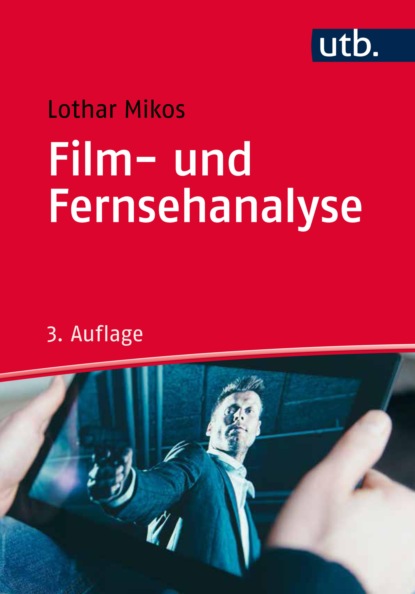- -
- 100%
- +
Mit der Digitalisierung sind neue Möglichkeiten der Verbreitung von Filmen und Fernsehsendungen entstanden (vgl. Aigrain 2012; Allen-Robertson 2013; Cunningham/Silver 2013). So findet man auf dem Videoportal YouTube vor allem Ausschnitte aus Fernsehshows, aber auch ganze Sendungen und einzelne Folgen von Fernsehserien. Einige historische Filme können ebenfalls dort angesehen werden. Die neuen Verbreitungswege ändern auch die Produktionsweisen und die Ästhetik. Wenn die Video-on-Demand-Plattform Netflix eigenproduzierte Fernsehserien nicht mehr Folge für Folge, sondern alle Episoden auf einmal onlinestellt, dann müssen einerseits alle Folgen auch bereits fertig produziert sein, und andererseits bedarf es keiner Cliffhanger mehr, um die Spannung zur nächsten Episode aufzubauen, ebenso wie die sogenannten Recaps – eine kurze Zusammenstellung der wichtigsten Ereignisse aus den vorherigen Folgen – entfallen. Die in den USA übliche Praxis, spätere Episoden der Staffel einer Fernsehserie noch zu produzieren, während die ersten Episoden schon gesendet werden, ist dann nicht mehr möglich. Außerdem macht die veränderte Ästhetik die Fernsehserien für das klassische Fernsehen in gewisser Weise unbrauchbar, da sie sich nicht mehr an dessen Gesetzen und Gewohnheiten der Zuschauerbindung orientiert.
Im Kontext der Medienkonvergenz werden Filme und Fernsehformate als medienübergreifende Marken etabliert. Die Geschichte im Kopf der Zuschauer entsteht dann nicht mehr allein über einen Film oder eine Fernsehsendung, sondern die verschiedenen Angebote, die sich um einen Film- oder Fernsehtext gruppieren, tragen ihren Teil dazu bei. Trailer in Kino, Fernsehen, Internet und mobilen Endgeräten, Fanseiten, Merchandising-Artikel, Comics, Computerspiele, Bücher, Film- und Fernsehkritiken, Presseberichterstattung usw. formen die aktuelle Rezeption vor. In diesem Sinn kann bei all diesen Ausprägungen auf verschiedenen Plattformen in Bezug auf einen einzelnen Film oder ein spezifisches Fernsehformat von »präfigurativem Material« gesprochen werden (vgl. Biltereyst u.a. 2008). In der Film- und Fernsehanalyse müssen daher zunehmend die Kontexte der Filme und Fernsehsendungen ebenso Berücksichtigung finden wie deren Ausweitungen auf anderen medialen Plattformen.
Auch wenn das Fernsehen und Video-on-Demand-Plattformen zu Beginn des 21. Jahrhunderts der überwiegende Konsumort für Filme sind, müssen Film und Fernsehen als zwei Medien betrachtet werden, die unterschiedlich strukturiert sind. Gemeinsam haben sie, dass sie mit bewegten Bildern arbeiten. Aber bereits die bildliche Auflösung einer Szene ist bei einem Kinofilm anders als bei einem Fernsehfilm – und bei einem für ein Portal wie YouTube hergestellten Film konzentriert sie sich vorwiegend auf Nahaufnahmen. Ganz allgemein kann man sagen, dass die Kamera umso näher am Objekt bzw. der Person der Darstellung sein muss, je kleiner der Bildschirm ist, auf dem der Film angeschaut wird. Daher werden Film und Fernsehen im vorliegenden Buch auch nicht gleich behandelt, sondern dort, wo es Konsequenzen für die Analyse hat, werden die Unterschiede hervorgehoben.
Ausgangspunkt für die hier vorgestellten Grundlagen der Film- und Fernsehanalyse ist die Auffassung, dass Filme und Fernsehsendungen als Kommunikationsmedien zu begreifen sind: Sie kommunizieren mit dem Publikum, wobei ihre Gestaltungsmittel und Techniken die kognitiven und emotionalen Aktivitäten der Zuschauer vorstrukturieren. Um diesem gedanklichen Ausgangspunkt gerecht zu werden, wird nicht von einer einzigen theoretischen Perspektive aus auf die Filme und Fernsehsendungen geschaut, sondern in einer inter- und transdisziplinären Zugangsweise werden theoretische Ansätze aus unterschiedlichen Disziplinen berücksichtigt (Interdisziplinarität) und im Hinblick auf die Analyse zusammengeführt (Transdisziplinarität).
Letztlich bedeutet das für die Analyse von Film- und Fernsehtexten, dass ihre textuellen Strategien verstärkt daraufhin zu untersuchen sind, wie mit den unterschiedlichen Wissensbeständen und Gefühlsstrukturen sowie dem an konkrete lebensweltliche Kontexte gebundenen praktischen Sinn und der sozial-kommunikativen Aneignung verschiedener Publika unterschiedliche Lesarten gebildet werden können. Wenn Filme und Fernsehsendungen sinntragende Diskurse sind, dann muss die Analyse ihr Sinnpotenzial entfalten und es in die Kontexte der Film- und Fernsehkommunikation einbinden, auch und gerade wegen der zunehmenden Bedeutung konvergierender Medienumgebungen. Film- und Fernsehtexte stellen nach wie vor symbolisches Material bereit, mit dem die Zuschauer in soziokulturellen Kontexten den sinnhaften Aufbau ihrer Lebenswelt betreiben. Sie sind aber zunehmend als transmediale Erzählungen in ein Netz verschiedener Medien eingebunden. Gegenstand der Analyse müssen die strukturellen Bedingungen der Texte und der Kontexte sein, welche die Geschichten in den Köpfen der Zuschauer entstehen lassen. Die Film- und Fernsehanalyse trägt dazu bei, an einzelnen Werken die Strukturen offenzulegen, die in der gesellschaftlichen Zirkulation von Bedeutung eine Rolle spielen.
Zum Aufbau des Buches: In Teil I werden die theoretischen und methodischen Grundlagen gelegt, wobei in Kapitel I-1 das Verstehen und Erleben von Filmen und Fernsehsendungen als Zielhorizont der Analyse begründet wird. Kapitel I-2 behandelt die Frage, wie ein Erkenntnisinteresse der Untersuchung gewonnen werden kann. Dabei wird auf fünf Ebenen eingegangen, die eine Analyse leiten können: Inhalt und Repräsentation, Narration und Dramaturgie, Figuren und Akteure, Ästhetik und Gestaltung sowie Kontexte. In Kapitel I-3 werden die Arbeitsschritte der Analyse von der Operationalisierung des Erkenntnisinteresses in konkrete Analysewege über die Datensammlung und Auswertung bis hin zur Präsentation der Ergebnisse beschrieben und die möglichen Hilfsmittel vorgestellt. In Teil II steht die eigentliche Film- und Fernsehanalyse im Mittelpunkt, d.h. die Techniken und Gestaltungsmittel in ihrer Struktur und ihrem funktionalen Bezug sowohl zum Film bzw. zur Fernsehsendung als Ganzes als auch zu den Zuschauern. Es gliedert sich nach den in Kapitel I-2 beschriebenen Ebenen, die das Erkenntnisinteresse der Analyse leiten. Das hat den Vorteil, dass Leser, die sich grundlegend in alle Aspekte der Film- und Fernsehanalyse einarbeiten möchten, den gesamten Teil II lesen können; wer lediglich Hinweise sucht für die dramaturgische Analyse eines Films, braucht sich nur mit Kapitel II-2 zu beschäftigen. Die Kontexte, in die Filme und Fernsehsendungen und ihre Zuschauer eingebunden sind, bilden den Schwerpunkt in Kapitel II-5. Denn im Gegensatz zu Hans J. Wulff (1999, S. 18), der »eine klare Gegenposition gegen einen Kontextualismus« einnimmt, weil er auf dem Sinn einer Mitteilung und auf der Autorität des Textes besteht, wird hier davon ausgegangen, dass der Sinn eines Films erst im Zusammenspiel von Text, Zuschauer und den Kontexten, in die beide eingebunden sind, entsteht. Dazu gehören sicher ein als sinnhaftes Ganzes konzipierter Film (oder eine Fernsehsendung) und ein Zuschauer, der als ein sinnhaft Handelnder zu begreifen ist. Daneben spielen die Produktionsbedingungen, die institutionellen Strukturen der Film- bzw. Fernsehindustrie ebenso eine Rolle wie die Biografie, soziale Situation und psychische Befindlichkeit sowohl der Regisseurin oder des Drehbuchautors bzw. im Fall von Fernsehserien des Showrunners als auch des Zuschauers oder der Zuschauerin sowie der kulturelle Kontext, in dem Film und Zuschauer stehen. In Teil III werden Beispielanalysen von Filmen und Fernsehsendungen vorgestellt, die einem spezifischen Erkenntnisinteresse folgen. Leider können sie aus Platzgründen nur kursorischen Charakter haben.
Thematisch geordnete Hinweise zur zitierten und weiterführenden Literatur sowie Register mit wichtigen Sachbegriffen und den erwähnten Filmen und Fernsehsendungen dienen zur Erleichterung der Arbeit mit diesem Buch.
Abschließend sei noch auf einige formale Dinge hingewiesen. Wenn hier von Filmen und Fernsehsendungen die Rede ist, sind in der Regel einzelne Filme oder Fernsehsendungen gemeint (zu Letzteren zählen auch Fernsehserien). Auch wenn sich die zu analysierenden Texte als diskrete, d.h. von anderen unterscheidbare Werke im Hinblick auf die Lektüren des Publikums immer schwerer bestimmen lassen, da oft von Filmen nicht nur eine, sondern mehrere Versionen auf DVD zugänglich sind, muss weiterhin in der Analyse von einzelnen Werken ausgegangen werden (vgl. Mikos u.a. 2007, S. 79 ff.; Mikos 2008). Denn es geht hier darum, eine Anleitung für die konkrete Film- und Fernsehanalyse zu bieten, indem deren Grundlagen systematisch dargestellt werden. Im Wesentlichen wird bei den Beispielen, die in den einzelnen Kapiteln genannt werden, sowie bei den Beispielanalysen auf populäre Filme und Fernsehsendungen eingegangen, die leicht zugänglich sind, sei es über die Verfügbarkeit auf DVD, auf Video-on-Demand-Plattformen oder im Fernsehen. Wenn im Folgenden manchmal von Filmen und Fernsehsendungen als Texten die Rede ist, so ist damit nicht gemeint, dass ihre Struktur mit der von geschriebenen Texten identisch ist. Stattdessen wird davon ausgegangen, dass in der Folge der poststrukturalistischen Debatte in den Geisteswissenschaften Kulturprodukte und -objekte generell als »Texte« bezeichnet werden, die produziert und rezipiert werden und für die Produktion von Bedeutung wichtig sind (vgl. McKee 2003, S. 4). Dem Lehrbuchcharakter des Buches wird dadurch Rechnung getragen, dass die Sprache zwar wissenschaftlich, aber möglichst leicht verständlich ist. Außerdem finden sich am Ende jedes Kapitels Fragen, die einerseits auf das Verständnis des jeweiligen Kapitels zielen und die andererseits die Analyse der im jeweiligen Kapitel behandelten Aspekte leiten können. Darüber hinaus wird am Ende jedes Kapitels die zitierte Literatur aufgeführt. Die Nummerierung der zitierten Literatur von einzelnen Autoren aus dem gleichen Erscheinungsjahr (z.B. Meier 1988a; Meier 1988b) in den Kapiteln bezieht sich lediglich auf das Verzeichnis der zitierten Literatur am Ende des jeweiligen Kapitels, nicht aber auf das thematisch geordnete weiterführende Literaturverzeichnis im Anhang.
Zitierte Literatur
Aigrain, Philippe (2012): Sharing. Culture and the Economy in the Internet Age. Amsterdam
Allen, Robert/Hill, Annette (Hrsg.) (2004): The Television Studies Reader. London/New York
Allen-Robertson, James (2013): Digital Culture Industry. A History of Digital Distribution. Basingstoke
Barg, Werner/Niesyto, Horst/Schmolling, Jan (Hrsg.) (2006): Jugend:Film:Kultur. Grundlagen und Praxishilfen für die Filmbildung. München
Barker, Martin (2000): From Antz to Titanic. Reinventing Film Analysis. London/Sterling
Beil, Benjamin/Kühnel, Jürgen/Neuhaus, Christian (2012): Studienhandbuch Filmanalyse. Ästhetik und Dramaturgie des Spielfilms. München
Bellour, Raymond (1995): L’analyse du film. Paris (Erstausgabe 1979)
Berger, Arthur Asa (2013): Media Analysis Techniques. Fifth Edition. Thousand Oaks u.a. (Erstausgabe 1982)
Bienk, Alice (2006): Filmsprache. Einführung in die interaktive Filmanalyse. Marburg
Bignell, Jonathan (2012): An Introduction to Television Studies. Third Edition. London/ New York (Erstausgabe 2004)
Biltereyst, Daniel/Mathijs, Ernest/Meers, Phillippe (2008): An Avalanche of Attention: The Prefiguration and Reception of »The Lord of the Rings«. In: Barker, Martin/Mathijs, Ernest (Hrsg.): Watching »The Lord of the Rings«. Tolkien’s World Audiences. New York u.a., S. 37–57
Boeckmann, Klaus (1996): Naive Medienexperten. Ergebnisse einer qualitativen Studie. In: Medien Praktisch, 20/3, S. 36–40
Bordwell, David/Thompson, Kristin (2013): Film Art. An Introduction. Fourth Edition. New York u.a. (10. Auflage; Erstausgabe 1979)
Branigan, Edward (2006): Projecting a Camera. Language-Games in Film Theory. New York/London
Burton, Graeme (2000): Talking Television. An Introduction to the Study of Television. London/New York
Caldwell, Thomas (2010): Film Analysis Handbook: Essential Guide to Understanding, Analyzing and Writing on Film. Victoria (Erstausgabe 2005)
Cardullo, Bert (2015): Film Analysis: A Casebook. New York
Carroll, Noël (1998): Interpreting the Moving Image. Cambridge u.a.
Casetti, Francesco/di Chio, Federico (1994): Analisi del film. Milano (6. Auflage, Erstausgabe 1990)
Casetti, Francesco/di Chio, Federico (2000): Analisi della televisione. Strumenti, metodi e pratiche di ricerca. Milano (3. Auflage, Erstausgabe 1997)
Collins, Jim/Radner, Hilary/Collins, Ava Preacher (1993) (Hrsg.): Film Theory Goes to the Movies. New York/London
Creeber, Glen (Hrsg.) (2006): Tele-Visions. An Introduction to Studying Television. London
Cunningham, Stuart/Silver, Jon (2013): Screen Distribution and the New King Kongs of the Online World. Basingstoke
Duden (2010): Das Fremdwörterbuch. Mannheim (10. Auflage)
Elsaesser, Thomas/Buckland, Warren (2002): Studying Contemporary American Film. London u.a.
Faulstich, Werner (1988): Die Filminterpretation. Göttingen
Faulstich, Werner (2008): Grundkurs Fernsehanalyse. München
Faulstich, Werner (2013): Grundkurs Filmanalyse. München (3. Auflage, Erstausgabe 2002)
rederking, Volker (Hrsg.) (2006): Filmdidaktik und Filmästhetik. Jahrbuch Medien im Deutschunterricht 2005. München
Geiger, Jeffrey/Rutsky, R. L. (Hrsg.) (2005): Film Analysis. A Norton Reader. New York/ London
Geraghty, Christine/Lusted, David (1998) (Hrsg.): The Television Studies Book. London/ New York
Gibbs, John/Pye, Douglas (Hrsg.) (2005): Style and Meaning. Studies in the Detailed Analysis of Film. Manchester/New York
Gillespie, Marie/Toynbee, Jason (Hrsg.) (2006): Analysing Media Texts. Maidenhead Gledhill, Christine/Williams, Linda (2000) (Hrsg.): Reinventing Film Studies. London/ New York
Goliot Lété, Anne/Vanoye, Francis (2012): Précis d’Analyse Filmique. Paris (3. Auflage, Erstausgabe 1992)
Göttlich, Udo (2006): Die Kreativität des Handelns in der Medienaneignung. Konstanz
Gräf, Dennis/Großmann, Stephanie/Klimczak, Peter/Krah, Hans/Wagner, Marietheres (2011): Filmsemiotik. Eine Einführung in die Analyse audiovisueller Formate. Marburg
Groebel, Jo (2014): Das neue Fernsehen. Mediennutzung – Typologie – Verhalten. Wiesbaden
Hasebrink, Uwe (2001): Fernsehen in neuen Medienumgebungen. Befunde und Prognosen zur Zukunft der Fernsehnutzung. Berlin
Hasebrink, Uwe/Mikos, Lothar/Prommer, Elizabeth (2004): Mediennutzung in konvergierenden Medienumgebungen: Eine Einführung. In: dies. (Hrsg.): Mediennutzung in konvergierenden Medienumgebungen. München, S. 9–17
Henzler, Bettina/Pauleit, Winfried (Hrsg.) (2009): Filme sehen, Kino verstehen. Methoden der Filmvermittlung. Marburg
Hickethier, Knut (1994) (Hrsg.): Aspekte der Fernsehanalyse. Methoden und Modelle. Münster/Hamburg
Hickethier, Knut (2012): Film- und Fernsehanalyse. Stuttgart/Weimar (5., aktualisierte und erweiterte Auflage; Erstausgabe 1993)
Hill, John/Church Gibson, Pamela (1998): The Oxford Guide to Film Studies. Oxford u.a.
Hollows, Joanne/Jancovich, Mark (1995) (Hrsg.): Approaches to Popular Film. Manchester/ New York
Jenkins, Henry (2006): Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York/London
Johnson, Derek (2013): Media Franchising. Creative License and Collaboration in the Culture Industries. New York/London
Jost, Roland/Kammerer, Ingo (2012): Filmanalyse im Deutschunterricht: Spielfilmklassiker. München
Kamp, Werner/Braun, Michael (2011): Filmperspektiven. Filmanalyse für Schule und Studium. Haan-Gruiten
Kanzog, Klaus (2007): Grundkurs Filmsemiotik. München
Kapell, Matthew William/Lawrence, John Shelton (Hrsg.) (2006): Finding the Force of the »Star Wars« Franchise. New York u.a.
Keane, Stephen (2007): CineTech. Film, Convergence and New Media. Basingstoke/New York Keutzer, Oliver/Lauritz, Sebastian/Mehlinger, Claudia/Moormann, Peter (2014): Filmanalyse. Wiesbaden
Korte, Helmut (2010): Einführung in die Systematische Filmanalyse. Ein Arbeitsbuch. Berlin (4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage; Erstausgabe 1999)
Korte, Helmut/Faulstich, Werner (1988) (Hrsg.): Filmanalyse interdisziplinär. Göttingen
Kuchenbuch, Thomas (2005): Filmanalyse. Theorien – Modelle – Kritik. Wien u.a. (2. Auflage; Erstausgabe 1978)
Kurwinkel, Tobias/Schmerheim, Philipp (2013): Kinder- und Jugendfilmanalyse. Konstanz/ München
Lury, Karen (2005): Interpreting Television. London/New York
Marotzki, Winfried/Niesyto, Horst (Hrsg.) (2006): Bildinterpretation und Bildverstehen. Methodische Ansätze aus sozialwissenschaftlicher, kunst- und medienpädagogischer Perspektive. Wiesbaden
Marshall, Jill/Werndly, Angela (2002): The Language of Television. London/New York McKee, Alan (2003): Textual Analysis. A Beginner’s Guide. London u.a.
McQueen, David (1998): Television. A Media Student’s Guide. London u.a.
Metz, Christian (1972): Semiologie des Films. München (Originalausgabe 1968)
Mikos, Lothar (2005): Der Faszination auf der Spur. Zur Bedeutung der Film- und Fernsehanalyse in der Medienpädagogik. In: Medien Concret, 9, S. 64–67
Mikos, Lothar (2008): Understanding Text as Cultural Practice and Dynamic Process of Making Meaning. In: Barker, Martin/Mathijs, Ernest (Hrsg.): Watching the »Lord of the Rings«. Tolkien’s World Audiences. New York u.a., S. 207–212
Mikos, Lothar/Eichner, Susanne/Prommer, Elizabeth/Wedel, Michael (2007): Die »Herr der Ringe«-Trilogie. Attraktion und Faszination eines populärkulturellen Phänomens. Konstanz
Miller, Toby (2002): Television Studies. London
Mitry, Jean (2000): Semiotics and the Analysis of Film. Bloomington/Indianapolis (Originalausgabe 1987: La Sémiologie en Question. Langage et Cinéma)
Monaco, James (2009): Film verstehen. Kunst, Technik, Sprache, Geschichte und Theorie des Films und der Neuen Medien. Reinbek (3. Auflage, Erstausgabe 1980, Originalausgabe 1977)
Nelmes, Jill (Hrsg.) (1996): An Introduction to Film Studies. London/New York
Phillips, William H. (1999): Film. An Introduction. Boston/New York
Pudowkin, Wsewolod (1928): Filmregie und Filmmanuskript. Berlin
Salt, Barry (1992): Film Style and Technology: History and Analysis. London (2. Auflage; Erstausgabe 1983)
Salt, Barry (2006): Moving into Pictures. More on Film History, Style, and Analysis. London
Schnell, Ralf (2000): Medienästhetik. Zu Geschichte und Theorie audiovisueller Wahrnehmungsformen. Stuttgart/Weimar
Thompson, Kristin (2007): The Frodo Franchise. »The Lord of the Rings« and Modern Hollywood. Berkeley, CA u.a.
Truffaut, François (1972): A Kind Word for Critics. In: Harpers, 10, 1972
Wagner, Ulrike/Gebel, Christa/Eggert, Susanne (2006): Muster konvergenzbezogener Medienaneignung. In: Wagner, Ulrike/Theunert, Helga (Hrsg.): Neue Wege durch die konvergente Medienwelt. München, S. 83–124
Wasko, Janet (2008): »The Lord of the Rings« Selling the Franchise. In: Barker, Martin/ Mathijs, Ernest (Hrsg.): Watching »The Lord of the Rings«. Tolkien’s World Audiences. New York u.a., S. 21–36
Wharton, David/Grant, Jeremy (2007): Teaching Analysis of Film Language. London
Wickham, Phil (2007): Understanding Television Texts. London
Wulff, Hans J. (1999): Darstellen und Mitteilen. Elemente der Pragmasemiotik des Films. Tübingen
Teil I: Theorie und Methodik
1. Die Kommunikationsmedien Film und Fernsehen
Filme und Fernsehsendungen sind als Medien der Kommunikation in die gesellschaftlichen Kommunikations- und Interaktionsverhältnisse eingebettet. Filme und Fernsehsendungen müssen daher grundsätzlich als Kommunikationsmedien verstanden werden. Ein Film ist zwar zunächst das Ergebnis eines künstlerischen Produktionsprozesses und in diesem Sinn als Werk zu sehen, doch verfolgen selbst Filmkünstler, die sich als Autoren verstehen, die Absicht, mit einem Publikum in Kommunikation zu treten, sei es, weil sie etwas mitzuteilen haben, sei es, weil sie von der Arbeit des Filmemachens leben und ihren Lebensunterhalt nur verdienen können, wenn ein zahlendes Publikum den Film zu einem mehr oder minder kommerziellen Erfolg macht. Soll die Kommunikation mit dem Publikum gelingen, muss im Prozess des Filmemachens bereits auf mögliche Erwartungen des Publikums sowie auf kognitive und emotionale Fähigkeiten der Zuschauer Bezug genommen werden. Eine Fernsehsendung kann zwar als pure Unterhaltung genutzt werden, dennoch wird der Zuschauer die Sendung vielleicht langweilig finden und sich Gedanken über die Absicht der Produzenten machen. Die Beispiele zeigen, dass Filme und Fernsehsendungen als bedeutungsvolles symbolisches Material gesehen werden müssen, das nur im Rahmen bedeutungsvoller Diskurse Sinn ergibt. Sie dienen der indirekten Kommunikation zwischen Menschen. Von der direkten, sogenannten Face-to-Face-Kommunikation unterscheidet sich die indirekte Kommunikation dadurch, dass sie über technische Medien vermittelt ist: Medien, die sich an eine anonyme, heterogene Masse richten (Massenmedien), und Medien, die sich an einzelne Personen richten (Individualmedien). Film und Fernsehen sind den Massenmedien zuzuordnen. Einzelne Filme und Fernsehsendungen sind dann Bedeutungsträger in der indirekten Kommunikation. Sie ergeben sowohl für Produzenten als auch für Zuschauer Sinn.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass es in der Kommunikation zwischen audiovisuellen Werken und Zuschauern nicht nur um Bedeutungsbildung geht. Darauf hat auch James B. Twitchell (1992, S. 203) hingewiesen, der in Bezug auf das Fernsehen kritisch angemerkt hat, dass sich die Auseinandersetzung mit diesem Medium vor allem auf die Inhalte konzentriert hat, nicht aber auf das Fernsehen als Erlebnis. Rituelles Fernsehen als Tätigkeit eines zuschauenden Subjekts erschöpft sich im Akt des Sehens selbst und zielt nicht auf eine Bedeutungsproduktion anhand gesendeter Inhalte ab. Das Sinnhafte der Tätigkeit ist nur aus den sozialen Kontexten zu erschließen, in die sie eingebettet ist. Allerdings sind frühere Erfahrungen mit dem Fernsehen bereits im Ritual selbst kondensiert.
Die Film- und Fernsehanalyse muss davon ausgehen, dass die zu untersuchenden Gegenstände (Filme und Fernsehsendungen) eine Kommunikation mit ihren Zuschauern eingehen. Das geschieht auf zweifache Weise: Einerseits werden sie von Zuschauern betrachtet bzw. rezipiert, andererseits werden sie von Zuschauern benutzt bzw. angeeignet. Meines Erachtens ist es wichtig, diese Unterscheidung zwischen Rezeption und Aneignung zu treffen, denn dadurch wird ermöglicht, die konkrete Interaktion zwischen einem Film und seinen Zuschauern analytisch von der weiteren Aneignung des Films, z.B. im Gespräch mit Freunden und Bekannten, zu trennen. Mit Rezeption ist die konkrete Zuwendung zu einem Film oder einer Fernsehsendung gemeint. In der Rezeption verschränken sich die Strukturen des Film- oder Fernsehtextes und die Bedeutungszuweisung sowie das Erleben durch die Zuschauer. Es findet eine Interaktion zwischen den Film- und Fernsehtexten und den Zuschauern statt (vgl. Hackenberg 2004; Höijer 1992a und 1992b). Der aktive Rezipient erschafft in der Rezeption den sogenannten rezipierten Text (vgl. auch Mikos 2001a, S. 71 ff.; Mikos 2001b, S. 59 f.), der gewissermaßen die konkretisierte Bedeutung des »Originaltextes« darstellt. Der rezipierte Text ist der Film, den der Zuschauer gesehen hat, der mit seinen Bedeutungszuweisungen und seinen Erlebnisstrukturen angereicherte Film. Er ist das Ergebnis der Interaktion zwischen Film- oder Fernsehtext und Zuschauer. Mit Aneignung ist dagegen die Übernahme des rezipierten Textes in den alltags- und lebensweltlichen Diskurs und die soziokulturelle Praxis der Zuschauer gemeint. Eine Fernsehsendung kann Gegenstand weiterer Interaktionen und Handlungen sein, wenn sie z.B. dazu dient, in der Mittagspause am Arbeitsplatz ein Gespräch zu eröffnen. Menschen benutzen Filme und Fernsehsendungen sowohl zur Gestaltung ihrer eigenen Identität als auch zur Gestaltung ihre sozialen Beziehungen. Die Unterscheidung zwischen Rezeption und Aneignung ist analytischer Natur, empirisch sind sie als Handlungen der Zuschauer nicht zu trennen. Warum nun sind Rezeption und Aneignung für die Analyse von Filmen und Fernsehsendungen wichtig?