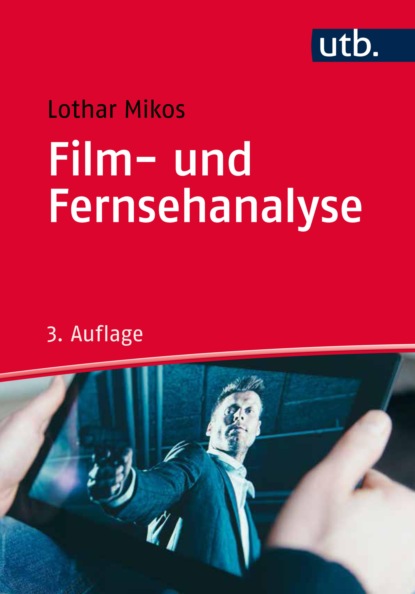- -
- 100%
- +
Man kann zwischen positiven und negativen Erwartungsaffekten unterscheiden (vgl. Bloch 1985, S. 121 ff.). Angst, Schrecken und Verzweiflung zählen nach Bloch zu den negativen, Hoffnung und Zuversicht zu den positiven Erwartungsaffekten. Sie sind in der Regel unbestimmt, denn sie verweisen auf die Zukunft. In der Film- und Fernsehrezeption werden im Rahmen von filmischen und fernsehspezifischen Konventionen, Genremustern und narrativen Strukturen Situationen aufgebaut, die den Zuschauer in die Erwartung von Angst und Schrecken versetzen. Die Situation wird mithilfe der kognitiven Wissensbestände als eine interpretiert, die im Rahmen der künftigen Handlung Bedrohliches erwarten lässt. Erst wenn dies gelingt, werden die Zuschauer affektiv vereinnahmt. Die positiven Erwartungsaffekte Hoffnung und Zuversicht gehen nach Bloch auch mit der Erwartung von sogenannten »gefüllten« Affekten einher, die an Erinnerungsvorstellungen gebunden sind (ebd., S. 122). Die aufgebaute Erwartung zielt darauf ab, einen Möglichkeitsraum zu schaffen, in dem die Zuschauer aufgrund ihrer Erinnerungsvorstellung mit der Wiederbelebung vergangener Gefühle wie Freude, Liebe, Glück, Neid, Eifersucht usw. rechnen können. Da diese Gefühle generell an Situationen sozialer Interaktion gebunden sind, können sie anhand entsprechender Situationen in den Film- und Fernsehtexten wieder belebt und aus der Erinnerung heraus erneut empfunden werden. Emotionen stellen so eine situative Erlebnisqualität dar. Deutlich wird, dass Erwartungsaffekte und Emotionen durch die in den Film- und Fernsehtexten dargestellten Handlungssituationen im Kontext von Konventionen der Darstellung, Genremustern sowie narrativen und dramaturgischen Strukturen vorstrukturiert und angeregt werden. Die textuellen Strategien zielen damit auf die emotionalen Aktivitäten der Zuschauer ab. Filme und Fernsehsendungen sind in diesem Sinn zu den Affekten und Emotionen der Zuschauer hin geöffnet. In der Analyse können diese Strukturen in ihrer Funktionalität für die Zuschauer herausgearbeitet werden.
Daneben sind Film- und Fernsehtexte aber auch zum praktischen Sinn der Rezipienten hin geöffnet. Der praktische Sinn regelt die routinisierten und rituellen Handlungen des Alltags, er ist an soziale Praktiken gebunden. Pierre Bourdieu (1976, S. 228 ff.) hat diese Praxisform durch die Analyse der kabylischen Gesellschaft entdeckt und später zu einer Kritik der theoretischen Vernunft weiterentwickelt, indem er dem praktischen Sinn eine eigene »Logik der Praxis« zuweist (vgl. Bourdieu 1987, S. 147 ff.), die völlig »in der Gegenwart und in den praktischen Funktionen« aufgeht (ebd., S. 167). Der praktische Sinn eines Objekts ist durch den Zusammenhang, den es in einer Handlung hat, bestimmt (vgl. auch Weiß 2001, S. 41 ff.). Auf diese Weise kann z.B. das Kino im Rahmen des praktischen Sinns dadurch bestimmt sein, dass man immer nur am Wochenende mit Freunden in ein Multiplex geht. Das wird zu einer routinisierten und rituellen Handlung, die vollzogen wird, ohne unbedingt ein Bewusstsein von ihr erlangen zu müssen. Genauso kann z.B. das Fernsehen als rituelles Objekt der Entspannung und Zerstreuung Bestandteil des praktischen Sinns sein. Da die Objekte aber an konkrete Praxisformen gebunden sind, können sie »in verschiedenen Praxiswelten Verschiedenes zum Komplement haben und daher je nach Art der Welt verschiedene, sogar entgegengesetzte Eigenschaften annehmen« (Bourdieu 1987, S. 158) und Bedeutungen haben. Im praktischen Sinn des alltäglichen Handelns in unterschiedlichen Situationen zeigt sich die Transformation der gesellschaftlichen Strukturen in subjektives Handeln nach den Prinzipien des Lebenssinns (vgl. Weiß 2000, S. 45). Der lebenspraktische Sinn von Film und Fernsehen ergibt sich aus den routinisierten und rituellen Handlungen der Menschen mit ihnen (vgl. Hartmann 2013; Meyen 2e in Huber/Meyen 2006; Pfaff-Rüdiger/Meyen 2007; Prommer 2012; Röser 2007; Röser u.a. 2010; zum Fernsehen im Alltag Mikos 2004, Mikos 2005; Röser/Großmann 2008 ). Der praktische Sinn des sozialen Handelns umfasst dabei »eine Art ›implizites Wissen‹ von der Relevanz, Bedeutung und Geeignetheit bestimmter Handlungsweisen, das sich im Akteur durch soziale Einübung und Erfahrung im fortlaufenden Handlungsvollzug eingelebt hat« (Hörning 2001, S. 162). Da Filme schauen und fernsehen als eingeübte Handlungen gelten können, die im Verlauf der Mediensozialisation routinisiert und ritualisiert wurden, offenbart sich der praktische Sinn gerade in den Gewohnheiten, die damit verbunden sind. Die Rezeption von Filmen und Fernsehsendungen wird zu einer gewohnheitsmäßigen performativen Praxis, die aber unterschiedliche Formen annehmen kann (vgl. Naab 2013; zu den Medienritualen von Paaren vgl. Linke 2010). Dabei spielt besonders der lebensweltliche Wissenshorizont als kulturelles Hintergrundwissen eine Rolle, allerdings nur in der Form, in der er sich in der sozialen Praxis zeigt.
»Den regelmäßigen Handlungspraktiken unterliegen damit indirekt kulturelle Schemata, die in routinisierten Interpretationen und Sinnzuschreibungen der Akteure Eingang ins Handlungsgeschehen finden und dort als implizite Unterscheidungsraster wirken, die bestimmte Gebrauchsformen nahelegen und andere als unpassend ausschließen« (ebd., S. 165).
Eine Form, in der sich der lebensweltliche Wissenshorizont in der Praxis zeigt, sind die handlungsleitenden Themen der Menschen. In ihnen zeigt sich »die spezifische soziale Prägung der Lebensphase« (Weiß 2000, S. 57; H.i.O.). Sie beziehen sich auf die gesamte Lebenssituation einer Person (vgl. Charlton/Neumann 1986, S. 31; Mikos 2001a, S. 89). Film- und Fernsehtexte sind sowohl zum praktischen Sinn der Menschen allgemein als auch zu ihren kulturell geprägten handlungsleitenden Themen hin geöffnet. Ihre textuelle Struktur bietet Raum für routinisierte und rituelle Aktivitäten in den lebensweltlichen Zusammenhängen und kulturellen Kontexten der Zuschauer. In der Analyse muss diese Struktur ebenso herausgearbeitet werden wie jene, die die kognitiven, emotionalen und sozial-kommunikativen Aktivitäten des Publikums vorstrukturieren. In der textuellen Struktur zeigt sich das implizite Publikum (Barker 2000, S. 48 ff.) oder der Zuschauer im Text, der aus der Literaturwissenschaft als impliziter Leser (Iser 1974) und aus der Kunstwissenschaft als impliziter Betrachter (Kemp 1992) bekannt ist.
Gegenstand der Film- und Fernsehanalyse ist aus rezeptionsästhetischer Sicht die textuelle Struktur von Filmen und Fernsehsendungen, weil durch sie die Rezeptions- und Aneignungsaktivitäten vorstrukturiert werden. Alle Formen der Darstellung, alle Zeichensysteme, die in diesen beiden audiovisuellen Medien benutzt werden, sind sowohl im Rahmen der Struktur der Texte als auch im Rahmen ihrer Funktion für die kognitiven, affektiven und emotionalen, sozial-kommunikativen, routinisierten und rituellen Aktivitäten des Publikums zu untersuchen. In diesem Sinn muss die Analyse immer mögliche und faktische Rezeptionen und Aneignungen im Blick haben, denn: »Mediale Produkte sind nicht unabhängig von genutzten und ungenutzten Möglichkeiten ihrer rezeptiven Aneignung zu verstehen« (Keppler 2001, S. 142). Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass auf allen Ebenen der Publikumsaktivitäten in der Rezeption und Aneignung die kulturellen und sozialen Kontexte zu berücksichtigen sind, in die sowohl die Film- und Fernsehtexte als auch die Aktivitäten der Zuschauer eingebunden sind.
»Was einen Text ausmacht, können wir erst dann ganz begreifen, wenn wir untersuchen, wie sich die Texte an ihre Leser oder Zuschauer wenden und wie die Leser, für sich oder als Gruppe betrachtet, Texte interpretieren und in ihre alltägliche Lebenspraxis integrieren, d.h.: wenn wir analysieren, wie Texte in einem bestimmten gesellschaftlichen Raum zirkulieren und Wirkung entfalten« (Casetti 2001, S. 156).
Fragen zum Verständnis
– Warum kann man Filme und Fernsehsendungen nicht nur als audiovisuelle Produkte, sondern als Kommunikationsmedien verstehen?
– Wodurch ist Film- und Fernsehverstehen gekennzeichnet?
– Was versteht man unter Film- und Fernseherleben?
– Welche Wissensformen spielen in der Rezeption und Aneignung von Filmen und Fernsehsendungen eine Rolle?
– Welche Emotionen spielen in der Rezeption und Aneignung von Filmen und Fernsehsendungen eine Rolle?
– Was ist unter dem praktischen Sinn als eine Rezeptions- und Aneignungsaktivität zu verstehen?
– Waswird unter der Textualität von Filmen und Fernsehsendungen verstanden?
– Welche Zuschaueraktivitätenwerden von den Film- und Fernsehtexten vorstrukturiert?
1.3 Zitierte Literatur
Barker, Martin (2000): From Antz to Titanic. Reinventing Film Analysis. London/Sterling, VA
Bloch, Ernst (1985): Das Prinzip Hoffnung. Band 1. Frankfurt a.M. (Erstausgabe 1959)
Blumer, Herbert (2013): Der methodologische Standort des symbolischen Interaktionismus. In: ders.: Symbolischer Interaktionismus. Aufsätze zu einer Wissenschaft der Interpretation. Frankfurt a.M. (Erstausgabe 1973; Originalausgabe 1969)
Bourdieu, Pierre (1976): Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft. Frankfurt a.M. (Originalausgabe 1972)
Bourdieu, Pierre (1987): Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt a.M. (Originalausgabe 1980)
Bruun Vaage, Margrethe (2007): Empathie. Zur episodischen Struktur der Teilhabe am Spielfilm. In: Montage/AV, 16, 1, S. 101–120
Casetti, Francesco (2001): Filmgenres, Verständigungsvorgänge und kommunikativer Vertrag. In: Montage/AV, 10/2, S. 155–173
Charlton, Michael/Neumann, Klaus (1986): Medienkonsum und Lebensbewältigung in der Familie. Methode und Ergebnisse der strukturanalytischen Rezeptionsforschung – mit fünf Falldarstellungen. München/Weinheim
Dirk, Rüdiger/Sowa, Claudius (2000): Teen Scream. Titten und Terror im neuen amerikanischen Kino. Hamburg/Wien
Faber, Marlene (2001): Medienrezeption als Aneignung. In: Holly, Werner/Püschel, Ulrich/Bergmann, Jörg (Hrsg.): Der sprechende Zuschauer. Wie wir uns Fernsehen kommunikativ aneignen. Wiesbaden, S. 25–40
Fiske, John (2011): Television Culture. London/New York (2. Auflage; Originalausgabe 1987)
Fiske, John (1993): Populärkultur. Erfahrungshorizont im 20. Jahrhundert. Ein Gespräch mit John Fiske. In: Montage/AV, 2/1, S. 5–18
Hackenberg, Achim (2004): Filmverstehen als kognitiv-emotionaler Prozess. Zum Instruktionscharakter filmischer Darstellungen und dessen Bedeutung für die Medienrezeptionsforschung. Berlin
Hall, Stuart (1980): Encoding/Decoding. In: ders./Hobson, Dorothy/Lowe, Andrew/Willis, Paul (Hrsg.): Culture, Media, Language. Working Papers in Cultural Studies, 1972–79. London u.a., S. 128–138
Hanich, Julian (2012): Auslassen, Andeuten, Auffüllen. Der Film und die Imagination des Zuschauers – eine Annäherung. In: ders./Wulff, Hans J. (Hrsg.): Auslassen, Andeuten, Auffüllen. Der Film und die Imagination des Zuschauers. München, S. 7–32
Hartmann, Maren (2013): Domestizierung. Baden-Baden
Hepp, Andreas (1998): Fernsehaneignung und Alltagsgespräche. Fernsehnutzung aus der Perspektive der Cultural Studies. Opladen/Wiesbaden
Hienzsch, Ulrich/Prommer, Elizabeth (2004): Die Dean-Netroots: Die Organisation von interpersonaler Kommunikation durch das Web. In: Hasebrink, Uwe/Mikos, Lothar/dies. (Hrsg.): Mediennutzung in konvergierenden Medienumgebungen. München, S. 147–169
Höijer, Birgitta (1992a): Reception of Television Narration as a Socio-Cognitive Process: A Schema-Theoretical Outline. In: Poetics, 21, 4, S. 283–304
Höijer, Birgitta (1992b): Socio-Cognitive Structures and Television Reception. In: Media, Cultue & Society, 14, 4, S. 583–603
Holly, Werner (2001): Der sprechende Zuschauer. In: ders./Püschel, Ulrich/Bergmann, Jörg (Hrsg.): Der sprechende Zuschauer. Wie wir uns Fernsehen kommunikativ aneignen. Wiesbaden, S. 11–24
Hörning, Karl H. (2001): Experten des Alltags. Die Wiederentdeckung des praktischen Wissens. Weilerswist
Huber, Nathalie/Meyen, Michael (Hrsg.) (2006): Medien im Alltag. Qualitative Studien zu Nutzungsmotiven und zur Bedeutung von Medienangeboten. Berlin
Iser, Wolfgang (1994): Der implizite Leser. Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett. München (3. Auflage; Erstausgabe 1972)
Iser, Wolfgang (1979): Die Appellstruktur der Texte. In: Warning, Rainer (Hrsg.): Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis. München (Erstausgabe 1975), S. 228–252
Kaczmarek, Ludger (2000): Affektuelle Steuerung der Rezeption von TV-Movies: Begriffserklärungen und theoretische Grundlagen. In: Wulff, Hans J. (Hrsg.): TV-Movies »Made in Germany«. Struktur, Gesellschaftsbild, Kinder- und Jugendschutz. Teil 1: Historische, inhaltsanalytische und theoretische Studien. Kiel, S. 257–271
Kemp, Wolfgang (1992): Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik. In: ders. (Hrsg.): Der Betrachter ist im Bild. Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik. Berlin, S. 7–27
Keppler, Angela (1994): Tischgespräche. Über Formen kommunikativer Vergemeinschaftung am Beispiel der Konversation in Familien. Frankfurt a.M.
Keppler, Angela (2001): Mediales Produkt und sozialer Gebrauch. Stichworte zu einer inklusiven Medienforschung. In: Sutter, Tilmann/Charlton, Michael (Hrsg.): Massenkommunikation, Interaktion und soziales Handeln. Wiesbaden, S. 125–145
Keppler, Angela (2006): Mediale Gegenwart. Eine Theorie des Fernsehens am Beispiel der Darstellung von Gewalt. Frankfurt a.M.
Klemm, Michael (2000): Zuschauerkommunikation. Formen und Funktionen der alltäglichen kommunikativen Fernsehaneignung. Frankfurt a.M. u.a.
Krotz, Friedrich (1993): Emotionale Aspekte der Fernsehaneignung. Konzeptionelle Überlegungen zu einem vernachlässigten Thema. In: Hügel, Hans-Otto/Müller, Eggo (Hrsg.): Fernsehshows. Form- und Rezeptionsanalyse. Hildesheim, S. 91–119
Linke, Christine (2010): Medien im Alltag von Paaren. Eine Studie zur Mediatisierung der Kommunikation in Paarbeziehungen. Wiesbaden
Meyen, Michael (2006): Wir Mediensklaven. Warum die Deutschen ihr halbes Leben auf Empfang sind. Hamburg
Mikos, Lothar (1998): Filmverstehen. Annäherung an ein Problem der Medienforschung. In: Medien Praktisch, Sonderheft Texte 1, S. 3–8
Mikos, Lothar (2001a): Fern-Sehen. Bausteine zu einer Rezeptionsästhetik des Fernsehens. Berlin
Mikos, Lothar (2001b): Rezeption und Aneignung – eine handlungstheoretische Perspektive. In: Rössler, Patrick/Hasebrink, Uwe/Jäckel, Michael (Hrsg.): Theoretische Perspektiven der Rezeptionsforschung. München, S. 59–71
Mikos, Lothar (2001c): Fernsehen, Populärkultur und aktive Konsumenten. Die Bedeutung John Fiskes für die Rezeptionstheorie in Deutschland. In: Winter, Rainer/Mikos, Lothar (Hrsg.): Die Fabrikation des Populären. Der John Fiske-Reader. Bielefeld, S. 361–371
Mikos, Lothar (2002): Monster und Zombies im Blutrausch. Ästhetik der Gewaltdarstellung im Horrorfilm. In: tv diskurs 19, 1/2002, S. 12–17
Mikos, Lothar (2004): Medienhandeln im Alltag – Alltagshandeln mit Medienbezug. In: Hasebrink, Uwe/ders./Prommer, Elizabeth (Hrsg.): Mediennutzung in konvergierenden Medienumgebungen. München, S. 21–40
Mikos, Lothar (2005): Alltag und Mediatisierung. In: ders./Wegener, Claudia (Hrsg.): Qualitative Medienforschung. Konstanz, S. 80–94
Mikos, Lothar (2011): »Wenn die Tränen fließen …« Rührung in der Film- und Fernsehrezeption. In: TelevIZIon, 24, 1, S. 4-7
Münsterberg, Hugo (1996): Das Lichtspiel. Eine psychologische Studie (1916) und andere Schriften zum Kino. Wien (Erstausgabe 1916)
Naab, Teresa K. (2013): Gewohnheiten und Rituale der Fernsehnutzung. Theoretische Konzeption und methodische Perspektiven. Baden-Baden
Neumann, Norbert/Wulff, Hans J. (1999): Filmerleben. Annäherung an ein Problem der Medienforschung. In: Medien Praktisch, Sonderheft Texte 2, S. 3–7
Neuß, Norbert (2002): Leerstellen für die Fantasie in Kinderfilmen – Fernsehen und Rezeptionsästhetik. In: TelevIZIon, 15/1, S. 17–23
Ohler, Peter (1994): Kognitive Filmpsychologie. Verarbeitung und mentale Repräsentation narrativer Filme. Münster
Pfaff-Rüdiger, Senta/Meyen, Michael (Hrsg.) (2007): Alltag, Lebenswelt und Medien. Qualitative Studien zum subjektiven Sinn von Medienangeboten. Berlin
Prommer, Elizabeth (2012): Fernsehgeschmack, Lebensstil und Comedy. Eine handlungstheoretische Analyse. Konstanz
Renner, Karl N. (2002): Handlung und Erlebnis. Zur Funktion der Handlung für das Erleben von Filmen. In: Sellmer, Jan/Wulff, Hans J. (Hrsg.): Film und Psychologie – nach der kognitiven Phase? Marburg, S. 153–173
Röser, Jutta (Hrsg.) (2007): MedienAlltag. Domestizierungsprozesse alter und neuer Medien. Wiesbaden
Röser, Jutta/Großmann, Nina (2008): Alltag mit Internet und Fernsehen: Fallstudien zum Medienhandeln junger Paare. In: Thomas, Tanja (Hrsg.): Medienkultur und soziales Handeln. Wiesbaden, S. 91–103
Röser, Jutta/Thomas, Tanja/Peil, Corinna (Hrsg.): (2010): Alltag in den Medien – Medien im Alltag. Wiesbaden
Schenk, Michael (2002): Medienwirkungsforschung. Tübingen (2., vollständig überarbeitete Auflage; Erstausgabe 1987)
Smith, Murray (1995): Engaging Characters. Fiction, Emotion, and the Cinema. Oxford u.a.
Tan, Ed S. (1996): Emotion and the Structure of Narrative Film. Film as an Emotion Machine. Mahwah, NJ
Turner, Graeme (2006): Film as Social Practice. London/New York (4. Auflage; Erstausgabe 1988)
Twitchell, James B. (1992): Carnival Culture. The Trashing of Taste in America. New York
Weiß, Ralph (2000): »Praktischer Sinn«, soziale Identität und Fern-Sehen. Ein Konzept für die Analyse der Einbettung kulturellen Handelns in die Alltagswelt. In: Medien und Kommunikationswissenschaft, 48/1, S. 42–62
Weiß, Ralph (2001): Fern-Sehen im Alltag. Zur Sozialpsychologie der Medienrezeption. Wiesbaden
Westphal, Sascha/Lukas, Christian (2000): Die Scream Trilogie. … und die Geschichte des Teen-Horrorfilms. München
Wiedemann, Dieter (1993): »Mentale Fernsehprogramme« – eine Reaktion der Zuschauer auf die neue Unübersichtlichkeit in den Programmen? In: GMK-Rundbrief, 35, S. 48–49
Wulff, Hans J. (1985): Die Erzählung der Gewalt. Untersuchungen zu den Konventionen der Darstellung gewalttätiger Interaktion. Münster
Wulff, Hans J. (1999): Darstellen und Mitteilen. Elemente der Pragmasemiotik des Films. Tübingen
Wulff, Hans J. (2002): Das empathische Feld. In: Sellmer, Jan/ders. (Hrsg.): Film und Psychologie – nach der kognitiven Phase? Marburg, S. 109–121
Wuss, Peter (1999): Filmanalyse und Psychologie. Strukturen des Films im Wahrnehmungsprozeß. Berlin (2., durchgesehene und erweiterte Auflage; Erstausgabe 1993)
Wuss, Peter (2002): »Das Leben ist schön« – aber wie lassen sich die Emotionen des Films objektivieren? In: Sellmer, Jan/Wulff, Hans J. (Hrsg.): Film und Psychologie – nach der kognitiven Phase? Marburg, S. 123–142
2. Erkenntnisinteresse
Film- und Fernsehanalyse genügt sich nicht selbst, sondern es ist immer ein Erkenntnisinteresse mit ihr verbunden. Eine Analyse kann verschiedenen Zwecken dienen: Sie kann erfolgen, um ganz pragmatisch anhand der Strukturen eines einzelnen Films seinen Erfolg bei einer bestimmten Zielgruppe erklären zu können; sie kann auch erfolgen, um theoretische Überlegungen zur Rolle und Funktion von Moderatoren im Fernsehen anhand der Adressierungsformen weiterzuentwickeln; sie kann sich in den Dienst struktureller Überlegungen zur Montagetheorie stellen; sie kann aber auch dazu dienen, theoretische Annahmen über Film und Fernsehen anhand konkreter Fallbeispiele zu bestätigen oder zu widerlegen. Diese Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, dass die Film- und Fernsehanalyse ein komplexes Unterfangen ist. Einerseits steht sie immer im Zusammenhang mit theoretischen Erkenntnissen über die beiden Medien, andererseits erfolgt sie in der Regel aus einer bestimmten Perspektive heraus. Es macht z.B. einen Unterschied, ob ein Film wie »Django Unchained« aus der Perspektive einer feministischen Filmwissenschaft analysiert wird oder ob der Film Gegenstand einer Analyse ist, die im Rahmen eines Drehbuchworkshops die narrative und dramaturgische Struktur herausarbeitet. Dieses Beispiel macht auch deutlich, dass Analysen in der Regel in einem Verwendungszusammenhang stehen, der nicht nur wissenschaftlicher Art sein muss.
Darüber hinaus muss jede Analyse, die nicht nur Einzelaspekte an Filmen und Fernsehsendungen untersucht, je nach Erkenntnisinteresse Theorien aus verschiedenen Disziplinen berücksichtigen. In diesem Sinn ist Film- und Fernsehanalyse notwendigerweise inter- und transdisziplinär: interdisziplinär, weil sie theoretische Annahmen verschiedener Disziplinen in einer Analyse zusammenführt; transdisziplinär, weil sie aus dem Wechselspiel zwischen Analyse und Theorie zu einer Transformation von Disziplingrenzen beitragen kann. Generell gilt der Satz von Hans J. Wulff (1999, S. 11): »Analyse ohne Theorie ist […] sinnlos, selbst dann, wenn sie die Eigenständigkeit des Beispiels gegen die Theorie zu verteidigen sucht.«
Den Königsweg der Analyse gibt es nicht (vgl. auch Salt 1992, S. 27). Sie bedient sich verschiedener theoretischer Annahmen aus unterschiedlichen Disziplinen und verschiedener Methoden, die sich am Erkenntnisinteresse orientieren. Eine Film- und Fernsehanalyse ist nicht unabhängig von den Kontexten, in denen sie steht:
»So ist also der analytische Zugang zum Film davon abhängig, welcher sozialen Praxis er dienen soll, welchen theoretischen Aspekt er favorisiert, im Rahmen welcher Forschungstendenzen er erfolgt, auf welche Phasen des schöpferischen, bedeutungsbildenden Prozesses er sich bezieht, welchen Ausschnitt innerhalb der medienkulturellen Beziehungen er wählt usw. Innerhalb jedes Bezugssystems findet sich jeweils ein Spektrum unterschiedlicher Möglichkeiten, so daß die analytischen Aufschlüsse bezüglich ihres Inhalts und Charakters variieren können« (Wuss 1999, S. 22).
Jede Film- und Fernsehanalyse ist deshalb eingebunden in wissenschaftliche Diskurse, »sie steht genau in deren diskursiven Rahmenbedingungen« (Wulff 1998, S. 25), und sie ist eingebunden in die diskursiven Kontexte der jeweiligen Bezugsdisziplinen, aus denen heraus der perspektivische Zugriff auf ihren Gegenstand erfolgt. Was aber genau ist eigentlich der Gegenstand der Film- und Fernsehanalyse?
Im Rahmen der vorgenommenen theoretischen Einordnung von Film und Fernsehen als Kommunikationsmedien können Gegenstand der Film- und Fernsehanalyse nur konkrete Filme und Fernsehsendungen sein, deren textuelle Struktur im Hinblick auf die Interaktion mit Zuschauern untersucht wird. Dabei kann es sich um ein Korpus von Filmen oder Fernsehsendungen handeln, das auf gemeinsame Merkmale oder differente Strukturen hin untersucht wird. Im Mittelpunkt der Analyse kann aber auch lediglich eine einzelne Szene aus einem Autorenfilm oder einer Gameshow stehen, an der exemplarisch textuelle Strukturen unter einem spezifischen Gesichtspunkt herausgearbeitet werden. Einzelne Film- oder Fernsehbilder sind – einmal abgesehen von Pausenzeichen, Senderlogos oder Wetterkarten – nicht Gegenstand der Analyse, weil es sich bei Film und Fernsehen um Medien des bewegten Bildes handelt. Das grenzt die hier vorgeschlagene Art der Analyse auch von bildwissenschaftlichen Verfahren ab (vgl. Frank/Lange 2010; Sachs-Hombach 2013 sowie die Beiträge in Sachs-Hombach 2005). Die Abfolge von Einzelbildern, die in ihrer chronologischen, linearen Reihung das Wesen von Film und Fernsehen ausmachen, steht im Zentrum der Analyse. Dabei können zwar Einzelbilder eine Rolle spielen, sie sind aber immer im Kontext der Bilder davor und der Bilder danach zu sehen. Gegenstand einer konkreten Analyse können z.B. einzelne Szenen oder Sequenzen eines Films, typische Szenen eines Samples von Genrefilmen, typische Eröffnungssequenzen von Autorenfilmen, einzelne Episoden von Gameshows, die Adaption einer britischen Realityshow für das deutsche Fernsehen, Beiträge von Magazin- oder Nachrichtensendungen, ganze Filme und Fernsehsendungen sowie eine Gruppe von Filmen und Fernsehsendungen sein. Letztere kann nach verschiedenen Kriterien gebildet werden, z.B. können alle Filme eines Regisseurs, alle Krimis öffentlich-rechtlicher Sender, alle Western zwischen 1930 und 1960, alle adaptierten Realityshows, alle HBO-Serien, die im deutschen Fernsehen zu sehen waren, oder alle Fußballsendungen einer Woche als Gruppen untersucht werden. Die Bestimmung des Gegenstands einer konkreten Analyse hängt eng mit dem Erkenntnisinteresse zusammen.