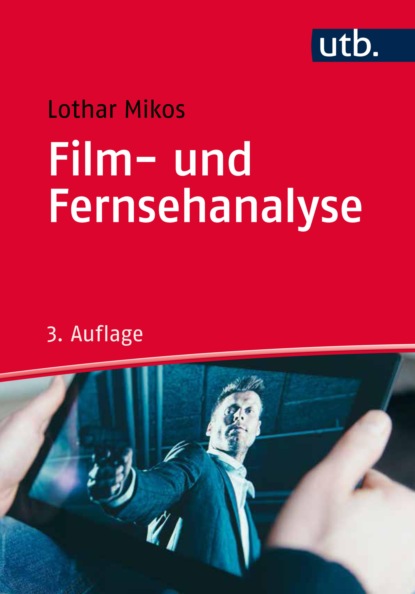- -
- 100%
- +
Die Gestaltungsweisen beruhen auf Konventionen der Darstellung. Das bedeutet, dass sie gelernt werden können und das Wissen um sie zur Routine, zum Teil des praktischen Sinns werden kann. Die Prozesse, die bei der Film- und Fernsehrezeption in Bezug auf die Darstellungsweisen ablaufen, können vorbewusst und teilweise unbewusst sein. Eine Analyse kann diese Prozesse bewusst machen, doch wird dies nicht dazu führen, dass sie auch in der konkreten Rezeptionssituation bewusst werden. Wer sich mit seinem Wissen auf einen Film oder eine Fernsehsendung einlässt, wird sich weiterhin emotional durch das Geschehen leiten lassen, im Nachhinein jedoch genauer sagen können, warum der Film eine gewisse Faszination ausgeübt hat.
Filmische Darstellungs- und Gestaltungsweisen dienen vor allem dazu, die Zuschauer in bestimmte Stimmungen zu versetzen. So spielen beispielsweise Komödien in hellen, großzügigen Räumen, während sich die Figuren in Psychothrillern in engen, dunklen Räumen bewegen müssen. Zugleich werden mit den Gestaltungsmitteln bei den Zuschauern Erwartungen hinsichtlich des weiteren Geschehens geweckt. Konventionen der Darstellung und Gestaltung beruhen auf ihrem häufigen Einsatz in Filmen und Fernsehsendungen und den damit verbundenen Lernerfahrungen der Zuschauer. Wenn z.B. Der Entscheidungswalk in der Castingshow »Germany’s Next Topmodel« stattfindet, sitzt die Jury auf einer kleinen Bühne und hat den Laufsteg im Blick. Die Kamera zeigt anschließend den Anfang des Laufstegs, und die Zuschauer erwarten nun, dass eine der Kandidatinnen dort auftaucht, um mit ihrem »Walk« zu beginnen. Oder es ist z.B. in einer Filmszene eine Frau zu sehen, die eine Straße entlangläuft, sie schaut sich manchmal um und macht einen gehetzten Eindruck, sie wird offenbar verfolgt. Die Kamera zeigt sie zunächst schräg von hinten, dann von der Seite; sie schaut zurück, und die Kamera folgt ihrem Blick. Schließlich übernimmt die Kamera ihren Blick nach vorn, und der Zuschauer sieht aus ihrer Sicht, wie sie auf eine Hausecke zuläuft. Nun erwartet er, dass hinter der Hausecke jemand erscheint, den sie dort nicht erwartet. Ist die Frau vorher als Identifikationsfigur aufgebaut worden, wird der Zuschauer in diesem Moment Angst empfinden, da er mit ihr mitfühlt oder Angst um sie hat. Mit dieser durch die Darstellungsweise erzeugten gespannten Erwartung werden die Zuschauer in psycho-physiologische Erregung versetzt, der Film zieht sie in seinen Bann. Ein »guter« Film lässt die Zuschauer kognitiv und emotional aktiv werden. Er gönnt ihnen zwar auch mal Ruhepausen, doch am Ende gibt er ihnen das Gefühl, zum Filmerlebnis ihren Teil beigetragen zu haben. Dabei kann die Gestaltungsweise des Films auch zu Überbeanspruchung und damit verbundenen Erschöpfungszuständen führen. Als Beispiele mögen hier »Batman Forever«, die »Herr der Ringe«- und die »Hobbit«-Trilogie oder »Natural Born Killers« dienen, ein Film, der mit grellen Farben, schnellen Schnitten, zahlreichen Spezialeffekten und lauter Musik arbeitet und damit an die Grenzen der gewohnten Wahrnehmungsweisen geht (vgl. Mikos 2002b).
Die Feststellung, dass Filme und Fernsehsendungen aus bewegten Bildern bestehen, ist nicht ganz richtig, denn tatsächlich setzen sie sich aus unbeweglichen Einzelbildern zusammen, die von den Zuschauern als bewegte Bilder wahrgenommen werden. Jedes einzelne Film- oder Fernsehbild bildet nicht nur etwas ab und stellt etwas dar, sondern ist in einer ganz spezifischen Art und Weise gestaltet. Das trifft nicht nur auf erfundene, fiktionale Geschichten zu, sondern auch auf abgebildete Realität. Jede Wiedergabe von Realität stellt nur einen Ausschnitt dar und ist durch die Technik und die spezifischen Darstellungsmöglichkeiten der Medien geformt. Auf diese Weise wird nicht nur »gesamtgesellschaftliche Komplexität […] auf das durch die Medien vermittelbare Maß reduziert« (Eurich 1980, S. 136), in einzelnen Film- und Fernsehbildern wird auch die Komplexität des Dargestellten auf das Darstellbare reduziert, es bleibt ein Rest – das Unsichtbare, das jedem Bild anhaftet. Dieses Unsichtbare kann aber wiederum durch spezifische Gestaltungsweisen wahrnehmbar gemacht werden. Darauf zielten bereits der Bühnenaufbau beim Theater und auch die Inszenierung von Filmen oder Fernsehsendungen ab. Seit der Erfindung des Tonfilms können den Bildern Töne, Geräusche, Sprache, Musik hinzugefügt werden. Die Kamera kann durch verschiedene Einstellungsgrößen und Bewegungen das Ihre zur Inszenierung beitragen. Für den Gesamteindruck eines Films ist wichtig, wie die einzelnen Filmbilder montiert sind, und für eine Fernsehsendung ist es nicht unerheblich, wie die Bildregie die einzelnen Kamerabilder zusammenfügt. Doch auch wenn die Medien die Komplexität der wirklichen Welt reduzieren, sind Film- und Fernsehbilder an sich ausgesprochen komplex.
Aufgrund dieser Komplexität sind die Zuschauer in der Rezeption genötigt, das Bild auf die wichtigen Informationen für ihre Aktivitäten abzutasten. Dabei geht es allerdings nicht darum, einzelne Bildinformationen gewissermaßen herauszupicken und als relevant anzusehen, sondern die Aktivität des Zuschauers liegt darin, die verschiedenen Aspekte des Bildes zueinander in Beziehung zu setzen (vgl. Ellis 1992, S. 54). Dabei kommt den einzelnen gestalterischen Mitteln besondere Bedeutung zu, denn sie lenken die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Außerdem haben sie eine narrative Funktion, indem sie den Plot unterstützen. Sie dienen als Hinweise, die zum Verständnis der Filmerzählung beitragen und Erwartungen auf den Fortgang hervorrufen können (vgl. Ohler 1994, S. 36). Daher sind die gestalterischen Mittel für die Geschichte im Kopf der Zuschauer unentbehrlich.
Für eine Analyse der formalen, stilistischen Mittel müssen diese sowohl einzeln betrachtet als auch in ihrem Zusammenwirken untersucht werden. Letzteres wird bereits dann deutlich, wenn die Einzelelemente in ihrer narrativen Funktion herausgearbeitet werden. In den Mittelpunkt der Analyse rücken dabei folgende Aspekte eines Films oder einer Fernsehsendung: die Kamera, die Ausstattung, das Licht, der Ton, die Musik, die Spezialeffekte, die Montage bzw. der Schnitt. Abgesehen vom Schnitt gehören alle Elemente zu dem, was in der Filmwissenschaft auch als »Mise-en-Scène« bezeichnet wird. Knut Hickethier (2012, S. 50 f.) spricht in diesem Zusammenhang von »Bildkomposition«. Manche Wissenschaftler rechnen die Kamera nicht dazu (vgl. dazu auch Rowe 1996, S. 93 f.). Generell umfasst Mise-en-Scène alle Elemente, die in die Szene gebracht werden. Wichtig ist dabei ihre Beziehung zueinander (vgl. Belton 1994, S. 43 f.; Bordwell/Thompson 2013, S. 112 ff.) sowie zu Inhalt und Repräsentation, Narration und Dramaturgie, Figuren und Akteuren. Das Zusammenspiel der gestalterischen Mittel regt die Aktivitäten der Zuschauer an und bindet sie in den Prozess des Verstehens und Erlebens von Film und Fernsehen ein. Welche Rolle die einzelnen Gestaltungsmittel spielen, wird in Kapitel 4 in Teil II ausführlich dargestellt.
Die konventionellen Darstellungs- und Gestaltungsmittel, auch filmische oder televisuelle Codes genannt, lenken die Aufmerksamkeit der Zuschauer und haben einen wesentlichen Anteil an der Produktion von Bedeutung. In diesem Sinn können sie als die ästhetischen Mittel von Film und Fernsehen begriffen werden, die in der sinnlichen Wahrnehmung der Film- und Fernsehtexte durch die Zuschauer konkretisiert werden. Daher kann ein Erkenntnisinteresse, das sich auf diese formalästhetischen Mittel richtet, sehr fruchtbar sein. So ist es beispielsweise möglich, in der Analyse die Rolle der Kamera beim Aufbau der emotionalen Beziehung zwischen einer Filmfigur und dem Zuschauer herauszuarbeiten oder die Bedeutung der Montage für den Aufbau dramaturgischer Spannung zu untersuchen.
2.5 Kontexte
Film- und Fernsehtexte erhalten ihre Bedeutung erst in der Interaktion mit ihren Zuschauern. Diese Interaktion steht nicht in einem gesellschaftsfreien Raum, sondern findet in Kontexten statt: in historischen, ökonomischen, juristischen, technischen, kulturellen und sozial-gesellschaftlichen. Für die Analyse von Filmen und Fernsehsendungen sind in ihrer Funktion für die Bedeutungsproduktion der Zuschauer vor allem fünf Kontexte zentral, die sich auf die textuelle, die mediale und die kulturell-gesellschaftliche Ebene von Film- und Fernsehtexten beziehen:
– Gattungen und Genres
– Intertextualität und Transmedia Storytelling
– Diskurs
– Lebenswelten
– Produktion und Markt
Historische, juristische und gesellschaftliche Kontexte werden hier nur berücksichtigt, insofern sie einen der fünf genannten Kontexte beeinflussen. Diese Kontexte sind für die Analyse in zweierlei Hinsicht bedeutsam: Einerseits spielen sie bei den bisher genannten Ebenen der Analyse (Inhalt und Repräsentation, Narration und Dramaturgie, Figuren und Akteure, Ästhetik und Gestaltung) eine wichtige Rolle, indem sie sich konkret auf die Film- und Fernsehtexte auswirken. Andererseits findet die Produktion von Bedeutung nicht unabhängig von ihnen statt.
Je nach Kontext können Zuschauer mit demselben Film oder derselben Fernsehsendung unterschiedliche Bedeutungen produzieren. Denn: »Kulturelle Texte sind immer kontextuell artikuliert, in unterschiedlichem Maße polysem strukturiert, haben widersprüchliche, instabile und bestreitbare Bedeutungen« (Winter 2001, S. 347). Je nach Genre sind Figuren und Akteure z.B. anders gestaltet, und die Narration korrespondiert auf je andere Weise mit der Ästhetik. So spielen – wie bereits erwähnt – Komödien meist in hellen Räumen, Horrorfilme dagegen sind in dunklen, unübersichtlichen Häusern lokalisiert. Polizisten spielen in Gangsterfilmen und Thrillern als Antagonisten der Gangster und Nebenfiguren eine andere Rolle als in Polizeifilmen, in denen sie die Protagonisten und Helden sind. Je nach den Diskursen, die zu einer bestimmten Zeit in einer Gesellschaft zirkulieren, fällt die Produktion von Bedeutung bei einzelnen Filmen und Fernsehsendungen unterschiedlich aus. Tony Bennett und Janet Woollacott (1987, S. 64 f.) haben den Begriff »reading formations« geprägt, mit dem sie ausdrücken, dass Texte zu unterschiedlichen Zeiten abhängig von sozialen und kulturellen Entwicklungen auch unterschiedlich gelesen werden. Filme greifen auch zeitbedingte gesellschaftliche Diskurse auf, die sie bereits in einer bestimmten Epoche verorten, in der sie sich auch für die Zuschauer ganz wesentlich in die Zirkulation von Bedeutung einfügen. Während z.B. die Science-Fiction-Filme der 1950er und 1960er Jahre sich in den Diskurs des Kalten Krieges einfügten, ist die »Star Trek«-Serie in Film und Fernsehen eher in einem Diskurs des technologischen Aufbruchs und der multikulturellen Gesellschaft verortet. Auch James Bond hatte zu Zeiten des Kalten Krieges andere Aufgaben als in den 1980er Jahren (vgl. Bennett/Woollacott 1987). Im Folgenden werden die fünf für die Analyse relevanten Kontexte kurz in ihrer Bedeutung für die Film- und Fernsehtexte und deren Zuschauer geschildert, bevor dann in Kapitel 5 in Teil II des Buches ausführlicher auf die damit verbundenen theoretischen Ansätze eingegangen wird.
Da narratives Wissen und das Wissen um die filmischen Darstellungsformen eine wichtige Rolle im Prozess des Filmverstehens und der Entwicklung der individuellen Geschichte im Kopf spielen, ist es wichtig, in der Analyse das Genre des zu analysierenden Films zu bestimmen und die Konventionen der Erzählung und der Darstellung herauszuarbeiten. Denn die Zugehörigkeit eines Films oder einer Fernsehsendung zu einem bestimmten Genre strukturiert bereits die Erwartungen des Publikums vor. Ein Genre ist in diesem Sinn gewissermaßen ein Gebrauchswertversprechen. Jeder wird von einer Gameshow die Darbietung von Spielen erwarten und nicht den Bericht über soziale Missstände in Großstädten. Niemand wird von einer Nachrichtensendung erwarten, dass dort ein Fantasy-Rollenspiel oder eine Hundedressur stattfinden, aber jeder wird von einem Western erwarten, dass dort galoppierende Pferde und schießende Männer zu sehen sind. Die Inszenierung von Figuren, Beziehungen, Handlungsräumen oder Interaktionsmustern hängt u.a. vom Genre ab. So wird z.B. Gewalt je nach Genre unterschiedlich inszeniert (vgl. Mikos 2001b). Unter dem Begriff »Genre« werden hier Muster und Konventionen der Erzählung bezeichnet, die als »Systeme von Orientierungen, Erwartungen und Konventionen, die zwischen Industrie, Text und Subjekt zirkulieren« (Neale 1981, S. 6), verstanden werden.
Ohne die Genrezuordnung und die Kenntnis der Genrekonventionen können Probleme beim Verständnis des Films oder der Fernsehsendung auftauchen. Die Geschichte im Kopf lässt sich nicht mehr so recht zusammenfügen. Wenn z.B. in einem Film zeitweise Gegenstände durch die Luft schwirren, weil die Gesetze der Schwerkraft nicht gelten, werden die Zuschauer eine andere Geschichte im Kopf bilden, wenn sie wissen, dass es sich um einen Science-Fiction-Film handelt, als wenn sie von einem Melodram ausgehen und die entsprechenden Szenen als symbolischen Ausdruck der Innenwelt der Protagonistin ansehen. Nur wer die Genrekonventionen des Western kennt, wird die komischen und zum Teil ironischen Elemente in einem Film wie »Erbarmungslos« verstehen können und an dem Spiel mit den Genrekonventionen und der damit verbundenen Thematisierung des Western-Mythos seine Freude haben (vgl. Monsees 1996, S. 61 ff.). Die Kenntnis des Genres und seiner Konventionen schafft eine Art kommunikatives Vertrauen, die Zuschauer können sich ihrer Erwartungen sicher sein. Zugleich kann der Text darauf vertrauen, dass die Zuschauer ihr Wissen aktivieren und so ihren Teil zur Geschichte beitragen. Das gilt auch für die Hollywood-Blockbuster zu Beginn des 21. Jahrhunderts, die verschiedene Genreelemente mischen, um ein möglichst großes Publikum zu erreichen (vgl. Mikos u.a. 2007, S. 19 ff.; Schweinitz 2006, S. 90 ff.; Thompson 2003). Wer nicht um die Genrekonventionen eines Films weiß, wird keine entsprechenden Erwartungen an den Film haben und demzufolge eine andere Geschichte im Kopf entwickeln als ein Zuschauer mit Genrekenntnissen.
Intertextualität spielt als Kontext eine wichtige Rolle. Zunächst einmal muss festgehalten werden, dass mit Intertextualität die Beziehung eines Film- oder Fernsehtextes zu anderen Texten gemeint ist (vgl. Mikos 1999; Pearson 2014). Das können andere Film- und Fernsehtexte sein, aber auch andere mediale Texte wie ein Roman oder ein Gemälde. Intertextualität ist für die Film- und Fernsehanalyse vor allem dann wichtig, wenn die Bedeutung eines Film- oder Fernsehtextes über und durch die Referenzen zu anderen Texten produziert wird.
Jeder neue Film und jede neue Fernsehsendung tritt in ein bereits vorhandenes Universum von Texten ein, das alle bisher produzierten Filme und Fernsehsendungen umfasst. Das ist die produktionsästhetische Perspektive der Intertextualität. Jeder neue Film von Quentin Tarantino steht nicht nur im Kontext aller früheren Filme dieses Regisseurs, sondern auch im Kontext aller anderen amerikanischen Filme, aller europäischen Filme, aller Western usw. Jede neue Quizshow im Fernsehen steht im Kontext aller anderen Quizshows, aber auch im Kontext aller anderen Shows mit dem jeweiligen Moderator. Jeder Film- und Fernsehtext steht also in einer Vielzahl von kontextuellen Bezügen zu anderen Texten. Andererseits wird kein Text unabhängig von den Erfahrungen und Erlebnissen mit anderen Texten rezipiert (vgl. Eco 1987, S. 101), d.h., dass Filme und Fernsehsendungen immer in dem Kontext der Rezeption anderer Filme, Fernsehsendungen und weiterer Medien der Populärkultur gesehen werden. Das ist die rezeptionsästhetische Seite der Intertextualität. Jede neue Episode einer Krimireihe wie »Navy CIS«, »Criminal Minds« oder »Mord mit Aussicht« wird vor dem Hintergrund aller anderen Folgen dieser Reihe sowie vor dem Hintergrund aller anderen Kriminalserien betrachtet, die der jeweilige Zuschauer in seinem bisherigen Leben rezipiert hat. Jede romantische Komödie mit Sandra Bullock in der Hauptrolle wird vor dem Hintergrund aller Filme mit dieser Schauspielerin, aller romantischen Komödien, aber z.B. auch aller Melodramen, die der jeweilige Zuschauer bisher gesehen hat, angeschaut.
Die im Verlauf der sogenannten Mediensozialisation gesammelten Erfahrungen und Erlebnisse mit Medientexten gehen in die intertextuelle Enzyklopädie ein, die den kontextuellen Rahmen für die Produktion von Bedeutungen bildet. Intertextualität ist kein statischer Zustand, sondern ein dynamischer Prozess, der sich erst in der Interaktion der Zuschauer mit Film- und Fernsehtexten realisiert. Jede neue Rezeptionserfahrung erweitert die Enzyklopädie. Jeder neue Film und jede neue Fernsehsendung erweitert das Universum der Texte. Dadurch ist auch die Position eines einzelnen Films oder einer einzelnen Fernsehsendung nicht statisch, sondern verschiebt sich im Verlauf der Produktions- und Rezeptionsgeschichte. Jeder neue Thriller bedeutet z.B. eine Verschiebung der Bedeutung von »alten« Thrillern des Regisseurs Alfred Hitchcock, jede neue Show mit dem Moderator Jörg Pilawa lässt seine alten Shows in einem neuen Licht erscheinen, ebenso wie die alten Hitchcock-Filme und die alten Pilawa-Shows die Bedeutungsproduktion des neuen Thrillers und der neuen Show beeinflussen.
Da das Universum der Texte, in dem sich alle Film- und Fernsehtexte verorten, nicht nur aus Filmen und Fernsehsendungen besteht, spielt Intermedialität als ein Typus von Intertextualität (vgl. Hess-Lüttich 1997, S. 131) eine nicht unwichtige Rolle. Intermedialität bezeichnet »Mediengrenzen überschreitende Phänomene, die mindestens zwei konventionell als distinkt wahrgenommene Medien involvieren« (Rajewsky 2002, S. 13). Darunter kann die Reproduktion eines Textes aus einem Medium in einem anderen Medium verstanden werden. So kann z.B. jede Literaturverfilmung unter dem Gesichtspunkt der Intermedialität analysiert werden, indem untersucht wird, wie sich die spezifischen ästhetischen Codes des jeweiligen Mediums auf die Narration oder die Repräsentation auswirken und wie dadurch unterschiedliche Lesarten möglich werden.
In den konvergierenden Medienumgebungen des 21. Jahrhunderts spielen crossmediale Vermarktungen und Transmedia Storytelling eine wichtige Rolle. In der Medienwissenschaft gibt es einige Konfusion bezüglich der Begriffe, die oft synonym für die Beschreibung der gleichen Phänomene verwendet werden. Grundsätzlich geht es bei einer crossmedialen Vermarktung darum, eine Geschichte oder ein Produkt über verschiedene Medien zu bewerben. Transmedia Storytelling geht dagegen davon aus, dass eine Geschichte gezielt über verschiedene Medien erzählt wird, sodass jederTeil auf jedem Medium zu einem tieferen Verständnis der Geschichte führt (vgl. Evans 2011, S. 19 ff.; Ryan 2013; Weaver 2013, S. 8 ff.). Die Nutzer haben dabei die Freiheit zu entscheiden, wie tief sie in eine Geschichte einsteigen wollen. Karin Fast (2012) spricht in dem Zusammenhang von transmedialer Unterhaltung, indem narrative Markenwelten geschaffen werden – solche transmedialen Markenwelten sind Franchise-Filme wie »Der Herr der Ringe«, »Der Hobbit«, »Matrix«, »Transformers« oder »X-Men« und Fernsehserien wie »Dexter«, »Fringe«, »Heroes«, »Lost« oder »True Blood«.
Die Bedeutungen, die Zuschauer mit Film- und Fernsehtexten produzieren, sind eng mit den in einer Gesellschaft zirkulierenden Diskursen verknüpft. Daher spielt die Kategorie »Diskurs« als Kontext eine wichtige Rolle. Als Diskurs wird eine Praxis verstanden, in der Zeichensysteme benutzt werden, um eine soziale Praxis aus einem bestimmten Blickwinkel darzustellen (vgl. Fairclough 1995, S. 1 ff.). Daher ist es angebracht, von diskursiven Praktiken zu sprechen, die auf Formationen von Aussagen und Sets von textuellen Arrangements beruhen. Die enge Verbindung der diskursiven Praxis zu Repräsentationen wird an dieser Stelle bereits deutlich. Diskurse vermitteln einen bestimmten Blick auf die soziale Wirklichkeit und auf soziale Praktiken. Sie sind an Medien gebunden. Dabei ist zu bedenken, dass mediale Repräsentationen selbst Diskursereignisse sind, die Realität erst verfügbar machen (vgl. Fiske 1994, S. 4; Winter 1997, S. 56). Diskurse sind zentral, weil sie den Subjekten helfen, Sinn in die Konstruktion der sozialen Realität zu bringen (vgl. Casey u.a. 2002, S. 64), denn sie entfalten strukturierende Kraft. Zugleich sind sie von Macht und Herrschaft durchdrungen, wie Michel Foucault (2002; 2012) in seinen Analysen gezeigt hat. Die ausdifferenzierten Gesellschaften der westlichen Welt sind von einer Multidiskursivität gekennzeichnet (vgl. Fiske 1994, S. 4). Verschiedene Diskurse konkurrieren miteinander um die Vorherrschaft in der gesellschaftlichen Diskursordnung.
Film- und Fernsehtexte als diskursive Praktiken fügen sich in die in der Gesellschaft zirkulierenden Diskurse ein. Damit werden sie selbst zu einem umkämpften Feld. Romantische Komödien können im Rahmen diskursiver Praktiken gesehen werden, die romantische Liebe zum Gegenstand haben, stehen damit aber zugleich in Konkurrenz zum Diskurs, der eine Beziehung rein ökonomisch-materiell sieht. Ein Film wie »Jurassic Park« greift den Diskurs um Gentechnologie auf. Ein erfolgreicher Film wie »Titanic« greift nicht nur den Diskurs um Liebe auf, sondern auch Diskurse um Klassengesellschaft, Fortschritt durch Technik und Naturgewalten. Ein Film wie »I, Robot« greift die Diskurse über künstliche Intelligenz auf. Ein Film wie »Django Unchained« greift Diskurse über Rassentrennung und Sklaverei auf. Ein Film wie »Das erstaunliche Leben des Walter Mitty« führt den Diskurs über Tagträume und ein abenteuerliches Leben jenseits des bürgerlichen Alltags fort und verhandelt auch Geschlechterdiskurse. Fernsehshows wie »Deutschland sucht den Superstar« oder »Germany’s Next Topmodel« greifen Diskurse um die Leistungsgesellschaft, beruflichen Erfolg, um Musikstile, um die Rolle von Prominenten in der Öffentlichkeit und um die Bedeutung von Schönheitsidealen auf. In Ärzte-Dramen wie »Grey’s Anatomy« oder »In aller Freundschaft« spielen Diskurse über Liebe am Arbeitsplatz, Ausbildung, Sterbehilfe, ethisches Handeln, Karriere, Altenpflege usw. eine wichtige Rolle. In Filmen und Fernsehsendungen überlagern sich mehrere Diskurse. Sie werden damit selbst zum Feld der Auseinandersetzung um die Durchsetzung von Bedeutungen. Dadurch sind auch verschiedene Lesarten möglich.
In der Film- und Fernsehanalyse kann herausgearbeitet werden, welche Diskurse in einem Film- oder Fernsehtext eine Rolle spielen und wie die Texte sich dadurch im diskursiven Feld der Gesellschaft verorten. Damit wird u.a. möglich, verschiedene Lesarten zu bestimmen, die im Text, der selbst als diskursive Praxis gilt, angelegt sind. Die Diskurse der Texte stehen aber immer in Bezug zu den Diskursen, die in der sozialen Praxis der Zuschauer zirkulieren. Daher muss die Lebenswelt als ein weiterer Kontext in den Analysen berücksichtigt werden.
Die Lebenswelt ist als Kontext für die Film- und Fernsehtexte von Bedeutung, weil sie das Bezugssystem darstellt, auf das sich Produzenten und Rezipienten beziehen. Sie ist »die subjektiv sinnhafte Erscheinungsform des Wissens von Welt, die als Rahmen der täglichen Lebenspraxis intentional die Handlungen der Subjekte steuert« (Mikos 1992, S. 532). Dieses Wissen von Welt ist allerdings nicht nur kognitiv vermittelt, sondern auch emotional und über den praktischen Sinn. Die Menschen handeln grundsätzlich nur innerhalb ihres lebensweltlichen Horizonts, »aus ihm können sie nicht heraustreten« (Habermas 1988, S. 192). Das liegt u.a. daran, dass die Menschen in kollektiven Lebensformen, die kulturell geprägt sind, sozialisiert und in sie integriert werden. Dadurch sind sie in der Lage, sich in der Interaktion mit anderen handlungsfähig zu erweisen und über die kommunikative Aneignung den sinnhaften Aufbau der sozialen Welt zu betreiben. »Die Strukturen der Lebenswelt legen die Formen der Intersubjektivität möglicher Verständigung fest« (ebd.). Daher sind Medien wie Film und Fernsehen den lebensweltlichen Kontexten verhaftet (vgl. ebd., S. 573), nur so können sie ihr kommunikatives Potenzial entfalten. Denn Film- und Fernsehtexte sind – wie bereits in Kapitel I-1 beschrieben – zum Wissen, zu den Affekten und Emotionen, zur sozialen Kommunikation und zum praktischen Sinn der Zuschauer hin geöffnet. Mit ihrem Wissen, ihren Emotionen, ihren sozial-kommunikativen Aktivitäten und ihrem praktischen Sinn sind die Zuschauer in ihrer Lebenswelt situiert. Die Bedeutungsproduktion, die zum sinnhaften Aufbau ihrer sozialen Welt beiträgt, ist jedoch nicht statisch in den lebensweltlichen Horizonten gefangen, sondern ist ein dynamischer Prozess, der aus der individuellen Sicht der Akteure als Lerngeschichte verstanden werden kann.