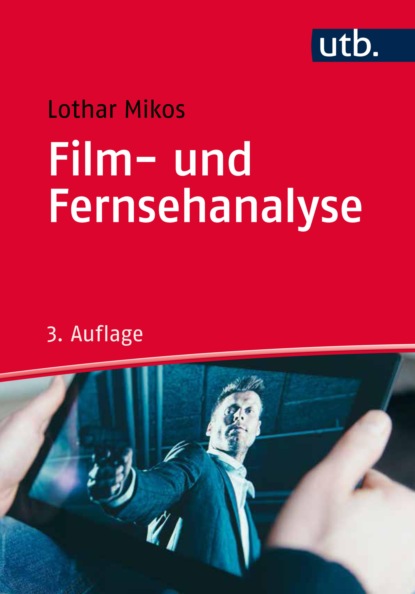- -
- 100%
- +
In den ausdifferenzierten westlichen Gesellschaften kann nicht mehr von der Lebenswelt gesprochen werden. Es muss konstatiert werden, dass es eine Vielzahl von Lebenswelten gibt. Die Lebenswelt eines Landwirtes in einem kleinen Dorf ist sicher eine andere als die eines Barkeepers in einem großstädtischen Nachtclub. In diesen ausdifferenzierten Gesellschaften übernehmen die Medien – vor allem das Fernsehen, aber auch der Film – eine Vermittlerrolle zwischen den verschiedenen Lebenswelten (vgl. Mikos 2002a). In den Medien werden verschiedene Lebensauffassungen thematisiert und sind damit der Bedeutungsproduktion zugänglich. Die Zuschauer werden jedoch entsprechend ihren lebensweltlichen Kontexten jeweils andere Bedeutungen produzieren, denn die rezipierten Film- und Fernsehtexte stellen eine lebensweltliche Manifestation des Zuschauerwissens dar. So entstehen unterschiedliche Lesarten von Filmen und Fernsehsendungen. Während ein Film wie »Trainspotting« von manchen Zuschauern als Verherrlichung des Drogenkonsums und damit als amoralischer Film gesehen wird, bietet er für andere einen authentischen Einblick in das Lebensgefühl und die Lebenswelt von Junkies (vgl. Winter 1998, S. 42 ff.). Lebenswelt ist also eine wichtige Kontextkategorie für die Film- und Fernsehanalyse, denn die Film- und Fernsehtexte stehen in Beziehung zu den lebensweltlichen Horizonten der Zuschauer. In der Analyse müssen daher die alltäglichen Erfahrungsmuster, die in die Film- und Fernsehtexte eingegangen sind, herausgearbeitet werden. Auf diese Weise kann die Positionierung von Filmen und Fernsehsendungen in der sozialen Praxis der Zuschauer bestimmt werden.
Für die Analyse von Filmen und Fernsehsendungen haben die Produktion und der internationale Film- und Fernsehmarkt als Kontexte eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Seit den 1990er Jahren hat der internationale Formathandel für das Fernsehen einen neuen Aufschwung erlebt, da aufgrund der Digitalisierung eine Ausweitung von Fernsehkanälen stattgefunden hat. Dadurch ist ein immer größerer Programmbedarf entstanden. Zugleich hat die Digitalisierung eine neue Ära der Blockbuster-Filme eingeläutet. In der Entwicklung immer neuer computergenerierter Spezialeffekte zeigt sich ebenso wie im Marketing die ökonomische Kapazität von Hollywood. Die globale Verbreitung von Fernsehformaten hat dazu geführt, dass es in vielen Ländern lokale Adaptionen von Shows wie »Wer wird Millionär?«, »America’s Next Top Model«, »X-Factor« und vielen anderen nonfiktionalen Formaten sowie Fernsehserien gibt (vgl. Moran 2009a und 2009b; Weber 2012; Zwaan/de Bruin 2012). Produktionsbedingungen schreiben sich in die Produkte, die Film- und Fernsehtexte, ein. So hat das Studiosystem in Hollywood eine eigene Erzählweise und einen eigenen Stil entwickelt (vgl. Bordwell u.a. 1988; Jewell 2007, S. 155 ff.; Stafford 2014, S. 43 ff.), der sich international durchgesetzt hat. Die Dominanz der USA auf dem globalen Unterhaltungsmarkt liegt vor allem in der Filmindustrie begründet, denn Hollywood-Filme werden in mehr als 150 Ländern der Welt gezeigt und dominieren oft den Filmmarkt in diesen Ländern (vgl. Thussu 2007b, S. 18 f.). Die Arbeitsweise von Hollywood (vgl. Wasko 2003) macht eine globale Vermarktung der Produkte notwendig (vgl. Miller u.a. 2001 und 2005). Marketing und Distribution werden in der digitalen Medienwelt immer wichtiger und beeinflussen auch die Produktion (vgl. Cunningham/Silver 2013; Davis u.a. 2015, S. 263 ff.; Ulin 2013). Auf dem deutschen Film- und Fernsehmarkt sind seit Beginn des 21. Jahrhunderts aber auch sogenannte Bollywood-Filme populär geworden. Diese aus Indien stammenden Filme haben ebenfalls eine eigene Erzählweise und einen eigenen Stil entwickelt, in dem Musik und Tanz eine wichtige Rolle spielen (vgl. Alexowitz 2003, S. 72 ff.; Kabir 2001 sowie die Beiträge in Kaur/Sinha 2005 und Marschall 2006). Im Hongkong-Kino wurde eine eigene Form des Actionfilms mit einer eigenen Ästhetik entwickelt (vgl. Bordwell 2000; Teo 1997, S. 87 ff.), die international zahlreiche Nachahmungen gefunden hat (vgl. die Beiträge in Morris u.a. 2005).
Die veränderten Marktbedingungen auf einem zunehmend konvergenten Medienmarkt, auf dem multimediale Konzerne die Entwicklungen vorantreiben, haben einen wesentlichen Einfluss auf die Filme und Fernsehsendungen. So wurden vor allem in amerikanischen Serien wie »Breaking Bad«, »Lost« oder »House of Cards« sehr dichte und komplexe Erzählstrukturen entwickelt, um die Zuschauer stärker an das Medium zu binden. Zugleich wurden sie mit Internetanwendungen, mobilen Adaptionen oder Computerspielen gekoppelt. Zahlreiche Hollywood-Filme wie »Batman«, »Sin City«, »Spiderman« oder die Filme des Marvel Cinematic Universe wie den »Avengers«- und den »Iron Man«-Filmen entstehen als Adaptionen von Comics, andere wie »Resident Evil« oder »Tomb Raider« beruhen auf Computerspielen. Erfolgreiche Filmserien wie »Blade« und »From Dusk Till Dawn« werden ebenso wie erfolgreiche Filme (z.B. »Fargo« oder »Hannibal«) als Fernsehserien adaptiert oder erfolgreiche Fernsehserien wie »Paddington« oder »Sex and the City« werden zu Filmen. Die Medienkonzerne sind bemüht, einmal erfolgreiche Erzählungen auf möglichst vielen medialen Plattformen zu vermarkten. Film- und Fernsehtexte werden so Teil einer konvergenten Medienwelt (vgl. Jenkins 2006; Keane 2007), in der sie zwar noch als diskrete Werke von den Zuschauern genutzt werden und der Analyse zugänglich sind, ihre soziale Bedeutung aber zunehmend im Kontext der konvergenten Medienumgebungen gesehen werden muss. Da Medienkonzerne auf eine internationale Vermarktung ihrer Filme und Fernsehformate zielen, muss von einem globalen Markt ausgegangen werden, auf dem es »Flüsse« und »Gegen-Flüsse« gibt (vgl. die Beiträge in Thussu 2007a). Die Globalisierung der Medien ist von durchaus widersprüchlichen Tendenzen geprägt.
In der Analyse kann herausgearbeitet werden, im Kontext welcher anderen medialen Ausprägungen eine bestimmte Erzählung als Film oder Fernsehsendung steht. Es können die typischen Muster der Narration, der Figurenzeichnung, des Einsatzes von Musik und Tanz im Rahmen der Produktionsbedingungen in einem kulturell geprägten Markt wie Bollywood, Hollywood oder Europa analysiert werden. Es ist z.B. ein Unterschied, ob das Setting einer Show wie »Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!« nur für die deutsche Produktion gebaut wurde oder ob es sich um ein Setting handelt, das von der englischen Produktionsfirma für das englische Originalformat geschaffen wurde und in dem nun die internationalen Adaptionen produziert werden.
Die Erkenntnisse, die aus einer Film- und Fernsehanalyse gewonnen werden sollen, können sich auf eine der fünf genannten Ebenen – Inhalt und Repräsentation, Narration und Dramaturgie, Figuren und Akteure, Ästhetik und Gestaltung sowie die Kontexte – richten. Alle Ebenen und Kontexte sind empirisch nicht voneinander zu trennen, in der konkreten Kommunikation von Film- und Fernsehtexten mit Zuschauern bedingen sie sich gegenseitig. In ihrem Zusammenwirken zeigt sich die Komplexität der Film- und Fernsehkommunikation. Für die Analyse ist es wichtig, die einzelnen Ebenen und die Kontexte zu trennen, um so den jeweiligen Beitrag zum Gelingen (oder Misslingen) der Kommunikation herausarbeiten zu können.
Fragen zum Verständnis
– Warum ist eine Film- und Fernsehanalyse ohne theoretische Annahmen sinnlos?
– Was macht die Spezifik von Film- und Fernsehbildern im Gegensatz zur Fotografie oder Kunst aus?
– Aufwelche fünf Ebenen kann sich das Erkenntnisinteresse der Analyse richten?
– Wie ist das Verhältnis von Inhalt und Repräsentation zu beschreiben?
– Was kennzeichnet eine Erzählung?
– Welche Aufgabe hat die Dramaturgie?
– Welche Rolle spielen Narration und Dramaturgie für die Aktivitäten der Zuschauer?
– Worin unterscheiden sich Figuren und Charaktere auf der einen Seite und Akteure auf der anderen Seite?
– Wiewerden Personenwahrgenommen?
– Welche Rolle spielen Ästhetik und Gestaltung bei der Film- und Fernsehkommunikation?
– Welche Gestaltungsmittel kann man bei Film und Fernsehen unterscheiden?
– Wiewirken sich die Kontexte Gattungen und Genres, Intertextualität, Diskurs, Lebenswelten sowie Produktion und Markt auf die Film- und Fernsehtexte als Kommunikationsmedien aus?
– Was unterscheidet Transmedia Storytelling von Intermedialität?
– Warum sind die Produktionsbedingungen als Kontextewichtig?
2.6 Zitierte Literatur
Alexowitz, Myriam (2003): Traumfabrik Bollywood. Indisches Mainstream-Kino. Bad Honnef
Bachmair, Ben (1996): Fernsehkultur. Subjektivität in einer Welt bewegter Bilder. Opladen
Belton, John (1994): American Cinema/American Culture. New York u.a.
Bennett, Tony/Woollacott, Janet (1987): Bond and Beyond. The Political Career of a Popular Hero. London
Berger, Arthur Asa (1997): Narratives in Popular Culture, Media, and Everyday Life. Thousand Oaks u.a.
Berger, Peter L./Luckmann, Thomas (2010): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt a.M. (23. Auflage; Originalausgabe 1966)
Bordwell, David (1990): Narration in the Fiction Film. London (Erstausgabe 1985)
Bordwell, David (1992): Kognition und Verstehen. Sehen und Vergessen in »Mildred Pierce«. In: Montage/AV, 1/1, S. 5–24
Bordwell, David (2000): Planet Hong Kong. Popular Cinema and the Art of Entertainment. Cambridge, MA/London
Bordwell, David (2001): Visual Style in Cinema. Vier Kapitel Filmgeschichte. Frankfurt a.M.
Bordwell, David (2008): Poetics of Cinema. New York/London
Bordwell, David/Staiger, Janet/Thompson, Kristin (1988): The Classical Hollywood Cinema. Film Style & Mode of Production to 1960. London
Bordwell, David/Thompson, Kristin (2013: Film Art. An Introduction. New York u.a. (10. Auflage; Erstausgabe 1979)
Casetti, Francesco/di Chio, Federico (1994): Analisi del film. Milano (6. Auflage; Erstausgabe 1990)
Casey, Bernadette/Casey, Neil/Calvert, Ben/French, Liam/Lewis, Justin (2002): Television Studies. The Key Concepts. London/New York
Chatman, Seymour (1990): Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Ithaka/London
Chatman, Seymour (1993): Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaka/London (Erstausgabe 1978)
Cunningham, Stuart/Silver, Jon (2013): Screen Distribution and the New King Kongs of the Online World. Basingstoke
Davis, Glyn/Dickinson, Kay/Patti, Lisa/Villarejo, Amy (2015): Film Studies. A Global Introduction. New York/London
Eco, Umberto (1987): Lector in fabula. Die Mitarbeit der Interpretation in erzählenden Texten. München/Wien (Originalausgabe 1979)
Eder, Jens (1999): Dramaturgie des populären Films. Drehbuchpraxis und Filmtheorie. Hamburg
Eder, Jens (2008): Die Figur im Film. Grundlagen der Figurenanalyse. Marburg
Ehlich, Konrad (Hrsg.) (1980): Erzählen im Alltag. Frankfurt a.M.
Eick, Dennis (2006): Drehbuchtheorien. Eine vergleichende Analyse. Konstanz
Ellis, John (1992): Visible Fictions. Cinema, Television, Video. London/New York (Erstausgabe 1982)
Elsaesser, Thomas/Buckland, Warren (2002): Studying Contemporary American Film. A Guide to Movie Analysis. London/New York
Eurich, Claus (1980): Kommunikative Partizipation und partizipative Kommunikationsforschung. Frankfurt a.M.
Evans, Elizabeth (2011): Transmedia Television. Audiences, New Media and Daily Life. New York/London
Fairclough, Norman (1995): Media Discourse. London u.a.
Fast, Karin (2012): More than Meets the Eye. Transmedial Entertainment as a Site of Pleasure, Resistance and Exploitation. Karlstad
Fiske, John (2011): Television Culture. London/New York (2. Auflage; Originalausgabe 1987
Fiske, John (1994): Media Matters. Everyday Culture and Political Change. Minneapolis/ London
Foucault, Michel (2002): Archäologie des Wissens. Frankfurt a.M. (16. Auflage; Originalausgabe 1969)
Foucault, Michel (2012): Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt a.M. u.a. (13. Auflage; Originalausgabe 1972)
Frank, Gustav/Lange, Barbara (2010): Einführung in die Bildwissenschaft. Darmstadt
Fritzsche, Bettina (2003): Pop-Fans. Studie einer Mädchenkultur. Opladen
Gauntlett, David (2002): Media, Gender and Identity. London/New York
Gleich, Uli (1996): Sind Fernsehpersonen die »Freunde« des Zuschauers? Ein Vergleich zwischen parasozialen und realen sozialen Beziehungen. In: Vorderer, Peter (Hrsg.): Fernsehen als »Beziehungskiste«. Parasoziale Beziehungen und Interaktionen mit TV-Personen. Opladen, S. 113–144
Grossberg, Lawrence/Wartella, Ellen/Whitney, D. Charles (1998): Media Making. Mass Media in a Popular Culture. Thousand Oaks u.a.
Habermas, Jürgen (1988): Theorie des kommunikativen Handelns. Band 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Frankfurt a.M. (Erstausgabe 1981)
Hall, Stuart (2013): The Work of Representation. In: ders./Evans, Jessica/Nixon, Sean (Hrsg.): Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London u.a. (2. Auflage; Erstausgabe 1997), S. 1–59
Hartley, John (1994): Representation. In: O’Sullivan, Tim/ders./Saunders, Danny/Montgomery, Martin/Fiske, John (Hrsg.): Key Concepts in Communication and Cultural Studies. London/New York, S. 265–266
Hartmann, Britta/Wulff, Hans. J. (1997): Erzählung. In: Rother, Rainer (Hrsg.): Sachlexikon Film. Reinbek, S. 79–81
Hess-Lüttich, Ernest W. B. (1997): Text, Intertext, Hypertext – Zur Texttheorie der Hypertextualität. In: Klein, Josef/Fix, Ulla (Hrsg.): Textbeziehungen. Linguistische und literaturwissenschaftliche Beiträge zur Intertextualität. Tübingen, S. 125–148
Hickethier, Knut (2012): Film- und Fernsehanalyse. Stuttgart/Weimar (5., aktualisierte und erweiterte Auflage; Erstausgabe 1993)
Jenkins, Henry (2006): Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York/London
Jewell, Richard B. (2007): The Golden Age of Cinema. Hollywood 1929–1945. Malden, MA u.a.
Kabir, Nasreen Munni (2001): Bollywood. The Indian Cinema Story. London u.a.
Kaur, Raminder/Sinha, Ajay J. (Hrsg.) (2005): Bollywood. Popular Indian Cinema through a Transnational Lens. New Delhi u.a.
Keane, Stephen (2007): CineTech. Film, Convergence and New Media. Basingstoke/New York
Kiener, Wilma (1999): Die Kunst des Erzählens. Narrativität in dokumentarischen und ethnographischen Filmen. Konstanz
Kilborn, Richard (2010): Taking the Long View. A Study of Longitudinal Documentary. Manchester/New York
Marschall, Susanne (Hrsg.) 2006: Indien. Film-Konzepte 4. München
Mayring, Philipp (2015): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim (12. Auflage; Erstausgabe 1983)
Mayring, Philipp/Hurst, Alfred (2005): Qualitative Inhaltsanalyse. In: Mikos, Lothar/Wegener, Claudia (Hrsg.): Qualitative Medienforschung. Ein Handbuch. Konstanz, S. 436–444
Mikos, Lothar (1992): Fernsehen im Kontext von Alltag, Lebenswelt und Kultur. In: Rundfunk und Fernsehen, 40/4, S. 528–543
Mikos, Lothar (1994): Fernsehen im Erleben der Zuschauer. Vom lustvollen Umgang mit einem populären Medium. Berlin/München
Mikos, Lothar (1999): Zwischen den Bildern – Intertextualität in der Medienkultur. In: Ammann, Daniel/Moser, Heinz/Vaissière, Roger (Hrsg.): Medien lesen. Der Textbegriff in der Medienwissenschaft. Zürich, S. 61–85
Mikos, Lothar (2001a): Fern-Sehen. Bausteine zu einer Rezeptionsästhetik des Fernsehens. Berlin
Mikos, Lothar (2001b): Ästhetik der Gewaltdarstellung in Film und Fernsehen. Genrespezifik und Faszination für Zuschauer. In: tv diskurs 16, 2/2001, S. 16–21
Mikos, Lothar (2002a): Fernsehkultur: Vermittler zwischen Lebenswelten. In: Haller, Michael (Hrsg.): Die Kultur der Medien. Untersuchungen zum Rollen- und Funktionswandel des Kulturjournalismus in der Mediengesellschaft. Münster, S. 93–106
Mikos, Lothar (2002b): Action- und Experimentalfilm: Natural Born Killers und die mediale (Re-)Präsentation von Gewalt. In: Hausmanninger, Thomas/Bohrmann, Thomas (Hrsg.): Mediale Gewalt. Interdisziplinäre und ethische Perspektiven. München, S. 96–111
Mikos, Lothar/Eichner, Susanne/Prommer, Elizabeth/Wedel, Michael (2007): Die »Herr der Ringe«-Trilogie. Attraktion und Faszination eines populärkulturellen Phänomens. Konstanz
Mikos, Lothar/Hoffmann, Dagmar/Winter, Rainer (Hrsg.) (2009): Mediennutzung, Identität und Identifikationen. Die Sozialisationsrelevanz der Medien im Selbstfindungsprozess von Jugendlichen. Weinheim/München (2. Auflage)
Miller, Toby/Govil, Nitin/McMurria, John/Maxwell, Richard (2001): Global Hollywood. London
Miller, Toby/Govil, Nitin/McMurria, John/Maxwell, Richard/Wang, Ting (2005): Global Hollywood 2. London
Monsees, Michaela (1996): Broncho Billy’s Erben: Die Westernhelden der 90er Jahre. Berlin: M.A.-Arbeit an der Freien Universität Berlin
Moran, Albert (2009a): New Flows in Global TV. Bristol/Chicago
Moran, Albert (Hrsg.) (2009b): TV Formats Worldwide. Localizing Global Programs. Bristol/Chicago
Morris, Meaghan/Li, Siu Leung/Ching-kiu, Stephen Chan (Hrsg.) (2005): Hong Kong Connections. Transnational Imagination in Action Cinema. Durham u.a.
Neale, Stephen (1981): Genre and Cinema. In: Bennett, Tony/Boyd-Bowman, Susan/Mercer, Colin/Woollacott, Janet (Hrsg.): Popular Television and Film. London
Nichols, Bill (2001): Introduction to Documentary. Bloomington/Indianapolis
Ohler, Peter (1994): Kognitive Filmpsychologie. Verarbeitung und mentale Repräsentation narrativer Filme. Münster
Orgad, Shani (2012): Media Representation and the Global Imagination. Cambridge/Malden
Pearson, Roberta A. (2014): Intertextuality. In: dies./Simpson, Philip (Hrsg.): Critical Dictionary of Film and Television Theory. London/New York, S. 249–250
Rabenalt, Peter (1999): Filmdramaturgie. Berlin
Rajewsky, Irina O. (2002): Intermedialität. Tübingen/Basel
Rowe, Allan (1996): Film Form and Narrative. In: Nelmes, Jill (Hrsg.): An Introduction to Film Studies. London/New York, S. 87–120
Ryan, Marie-Laure (2013): Transmediales Storytelling und Transfiktionalität. In: Renner, Karl N./von Hoff, Dagmar/Krings, Matthias (Hrsg.): Medien, Erzählen, Gesellschaft. Transmediales Erzählen im Zeitalter der Medienkonvergenz. Berlin/Boston, S. 88–117
Sachs-Hombach, Klaus (Hrsg.) (2005): Bildwissenschaft. Disziplinen, Themen, Methoden. Frankfurt a.M.
Sachs-Hombach, Klaus (2013): Das Bild als kommunikatives Medium. Elemente einer allgemeinen Bildwissenschaft. Köln (3., überarbeitete Auflage; Erstausgabe 2003)
Salt, Barry (1992): Film Style and Technology. History and Analysis. London (2. Auflage; Erstausgabe 1983)
Schülein, Frieder/Stückrath, Jörn (1997): Erzählen. In: Brackert, Helmut/Stückrath, Jörn (Hrsg.): Literaturwissenschaft. Ein Grundkurs. Reinbek, S. 54–71 (Erstausgabe 1992) Schütz, Alfred (1991): Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. Frankfurt a.M. (Erstausgabe 1932)
Schweinitz, Jörg (2006): Film und Stereotyp. Eine Herausforderung für das Kino und die Filmtheorie. Zur Geschichte eines Mediendiskurses. Berlin
Silverstone, Roger (1988): Television Myth and Culture. In: Carey, James W. (Hrsg.): Media, Myths, and Narratives. Television and the Press. Newbury Park u.a., S. 20–47
Smith, Murray (1995): Engaging Characters. Fiction, Emotion, and the Cinema. Oxford/New York
Stafford, Roy (2014): The Global Film Book. London/New York
Taylor, Lisa/Willis, Andrew (1999): Media Studies. Texts, Institutions and Audiences. Oxford/Malden, MA
Teo, Stephen (1997): Hong Kong Cinema. The Extra Dimensions. London
Thompson, Kristin (2003): Fantasy, Franchises, and Frodo Baggins. »The Lord of the Rings« and Modern Hollywood. In: The Velvet Light Trap, 52, S. 45–63
Thussu, Daya Kishan (Hrsg.) (2007a): Media on the Move. Global Flow and Contra-flow. London/New York
Thussu, Daya Kishan (2007b): Mapping Global Media Flow and Contra-flow. In: ders. (Hrsg.): Media on the Move. Global Flow and Contra-flow. London/New York, S. 11–32
Tolson, Andrew (1996): Mediations. Text and Discourse in Media Studies. London u.a.
Ulin, Jeffrey C. (2013): The Business of Media Distribution. Monetizing Film, TV and Video Content in an Online World. New York/London
Vollbrecht, Ralf/Wegener, Claudia (Hrsg.): Handbuch Mediensozialisation. Wiesbaden
Wasko, Janet (2003): How Hollywood Works. London u.a.
Weaver, Tyler (2013): Comics for Film, Games, and Animation. Using Comics to Construct Your Transmedia Storyworld. New York/London
Weber, Tanja (2012): Kultivierung in Serie. Kulturelle Adaptionsstrategien von fiktionalen Fernsehserien. Marburg
Wegener, Claudia (2005): Inhaltsanalyse. In: Mikos, Lothar/dies. (Hrsg.): Qualitative Medienforschung. Ein Handbuch. Konstanz, S. 200–208
Wegener, Claudia (2008): Medien, Aneignung und Identität. »Stars« im Alltag jugendlicher Fans. Wiesbaden
Wierth-Heining, Mathias (2004): Filmrezeption und Mädchencliquen. Medienhandeln als sinnstiftender Prozess. München
Winter, Carsten/Thomas, Tanja/Hepp, Andreas (Hrsg.) (2003): Medienidentitäten. Identität im Kontext von Globalisierung und Medienkultur. Köln
Winter, Rainer (1997): Cultural Studies als kritische Medienanalyse. Vom »encoding/de-coding«-Modell zur Diskursanalyse. In: Hepp, Andreas/ders. (Hrsg.): Kultur, Medien, Macht. Cultural Studies und Medienanalyse. Opladen, S. 47–63
Winter, Rainer (1998): Dekonstruktion von »Trainspotting«. Filmanalyse als Kulturanalyse. In: Medien Praktisch, Sonderheft Texte 1, S. 38–49
Winter, Rainer (2001): Die Kunst des Eigensinns. Cultural Studies als Kritik der Macht. Weilerswist
Wirth, Werner/Lauf, Edmund (Hrsg.) (2001): Inhaltsanalyse. Perspektiven, Probleme, Potentiale. Köln
Wulff, Hans J. (1998): Semiotik der Filmanalyse. Ein Beitrag zur Methodologie und Kritik filmischer Werkanalyse. In: Kodikas/Code, 21/1–2, S. 19–36
Wulff, Hans J. (1999): Darstellen und Mitteilen. Elemente einer Pragmasemiotik des Films. Tübingen
Wuss, Peter (1999): Filmanalyse und Psychologie. Strukturen des Films im Wahrnehmungsprozeß. Berlin (2., durchgesehene und erweiterte Auflage; Erstausgabe 1993)
Zwaan, Koos/de Bruin, Joost (Hrsg.): Adapting Idols: Authenticity, Identity and Performance in a Global Television Format. Farnham/Barlington
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.