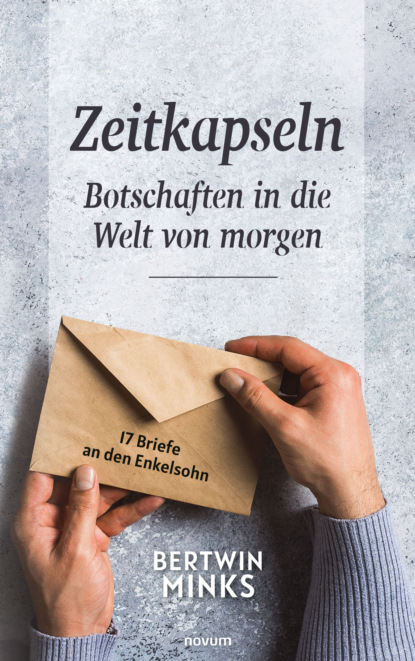- -
- 100%
- +
Doch es gibt noch mehr astrophysikalische Erfordernisse für die Entstehung und Entfaltung des Lebens. Im nahen Umfeld des Sternensystems von einigen Dutzend Lichtjahren sollten sich mehrere Milliarden Jahre lang keine lebensfeindlichen Prozesse wie Nova- und Supernova-Szenarien oder Gamma-Strahlenausbrüche ereignen. Darüber hinaus darf in dem Sonnensystem das Impakt-Geschehen nicht zu intensiv und langandauernd sein. In galaktischen Zentralgebieten mit hungrigen schwarzen Singularitäten und einer turbulenten chaotischen Himmelsmechanik werden das Leben und seine Evolution keine guten Karten haben. Angesichts der vielfältigen kosmischen Randbedingungen ist es schon erstaunlich, dass Leben im Weltall überhaupt entstehen konnte. Dass es sich auch zu höheren Formen entwickeln würde, mag wie ein Wunder erscheinen.
Vor 4,5 Milliarden Jahren schienen im System einer gelben Sonne vom Spektraltyp G 2/V am inneren Rand des Orionarms der Milchstraße die vielfältigen kosmischen Rahmenbedingungen weitgehend erfüllt gewesen zu sein. Es war der dritte Planet der noch jungen solaren Welt, der sich im Laufe der Zeit zu einem grandiosen Schauplatz für das Wirken des Schöpfertums der Evolution und die Entfaltung ihrer Wunderwerke entwickeln sollte.
Die Ausformung des Systems Erde-Mond in einer Entfernung von reichlich acht Lichtminuten vom Zentralgestirn könnte nach dem Einschlag von Theia, einem etwa Mars großen Protoplanten, im Hadaikum stattgefunden haben. Nach diesem gewaltigen Impakt-Ereignis verdichteten sich die herausgeschleuderten Magma-Massen zu einem Trabanten, der den Planeten Erde fortan begleiten würde. Durch das Ereignis beschleunigte sich die Erdrotation. Der Tag verkürzte sich auf ungefähr zehn Stunden. Der junge entstandene Mond muss damals viel größer als heute am fahlen feuerfarbenen Himmel geleuchtet haben, weil er die Erde auf einer engeren Umlaufbahn umkreiste. Am Ende des ersten Erdzeitalters, dem Hadaikum, hatte sich der Planet vermutlich so weit abgekühlt, dass die sich in der Atmosphäre angereicherten Wassermassen abregnen konnten. Infolgedessen begann sich auf der Oberfläche des Planeten ein gewaltiger Ozean auszubreiten.
Zu Beginn des Archaikums vor etwa 3,8 Milliarden Jahren fand in einer stickstoffreichen schwefeligen Atmosphäre ohne Sauerstoff zunächst eine chemische Evolution statt. Heftige Gewitter und eine intensive Gamma-Strahlung schufen unter einem fortwährenden kosmischen Bombardement von Asteroiden, Kleinplaneten und Kometen die erforderlichen Voraussetzungen für die Entstehung des Lebens. Kurze Zeit später scheint sich das Leben auf der Erde dann tatsächlich etabliert zu haben. 3,5 bis 3,7 Milliarden Jahre alte fossile Spuren lassen das zumindest vermuten.
Am Anfang der evolutionären Geschichte auf der Erde standen Einzeller wie Bakterien und Archaeen sowie die mysteriösen Viren. Bei den Viren sind sich die Biologen aufgrund des fehlenden Stoffwechsels bis heute allerdings nicht einig, ob diese überhaupt dem (normalen) Leben zuzurechnen sind.
Nach diesem Schöpfungsakt verharrte die Evolution im Urozean jedoch 1,5 Milliarden Jahre lang in einer unbegreiflichen Starre und Untätigkeit. Es ist bis heute rätselhaft, warum sie so lange gebraucht hat, um nach den ersten erfolgreichen Schritten das Alphabet der Biochemie mit DNS, RNS, Proteinen und Nukleotiden zu buchstabieren und die Dynamik genetischer Veränderungen zu begreifen. Warum nur hat die Evolution so viele Millionen Jahre innegehalten, ohne wirksam und nennenswert zu experimentieren, zu probieren und zu perfektionieren? Nun, der Grund für diesen langen evolutionären Dornröschenschlaf wird wohl für immer ihr Geheimnis bleiben!
Die evolutionäre Schöpfungspause endete zu Beginn des Proterozoikums. Vor etwa 2,5 Milliarden Jahren entstanden mit den Eukaryoten die ersten komplexen Vielzeller und Ahnen jeglichen höheren Lebens auf der Erde. Gleichzeitig ereignete sich Dramatisches! Durch die Fotosynthese der Cyano-Bakterien und später von Algen gelangte nach und nach mehr Sauerstoff in die Atmosphäre. Er vergiftete zunehmend die Lebensgrundlage der marinen Einzeller und raffte die Pioniere des Lebens dahin. Der trotz weltweiter Oxidationsprozesse ansteigende Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre und die sich bildende Ozonschicht eröffneten der Evolution neue Perspektiven. Sie entwickelte vor 1,2 Milliarden Jahren die Mehrzelligkeit der Pflanzen und reichlich 400 Millionen Jahre später jene der Tiere. Daneben erschuf sie das geheimnisvolle Reich der Pilze. Schließlich sorgte sie dafür, dass mit der sexuellen Fortpflanzung und der Zellspezialisierung der Tod des Individuums in die biologische Welt Einzug hielt. Aber auch tief unter der Erdoberfläche fanden Prozesse statt, die für das Leben bedeutsam waren.
Die Entstehung des Minerals Perowskit verstärkte vor reichlich drei Milliarden Jahren die Umwälzungsvorgänge im Erdmantel. Der daraufhin einsetzende Vulkanismus begünstigte das Anwachsen der kontinentalen Landmassen. Vor etwa einer Milliarde Jahren war der Erdkern schließlich so weit abgekühlt, dass er im Zentrum erstarrte. Dadurch wurden die Konvektionsmuster in der flüssigen äußeren Schale des Erdkerns regelmäßiger und begannen ein Magnetfeld zu erzeugen. Dieses Feld schirmte die kosmische Strahlung und den Partikel-Strom des Sonnenwindes ab und ermöglichte dem Leben künftig die Eroberung des Festlandes. Die stille und nachhaltige Veränderung des Lebens im Ozean vollzog sich unter schwierigen globalen Bedingungen. Am Anfang des Proterozoikums schlugen vermutlich die letzten großen Asteroiden auf der Erde ein. Danach herrschte lange Zeit ein kühles Klima. Die irdische Plattentektonik formte den Superkontinent Rodinia, der zeitweilig von mächtigen Gletschern bedeckt war. Der Ozean Monrovia, der den Kontinent umspülte, scheint vor 700 bis 800 Millionen Jahren selbst am Äquator bis zu zwei Kilometern tief gefroren gewesen zu sein. Doch trotz dieser unwirtlichen globalen Bedingungen reiften im letzten Abschnitt des Präkambriums, der Ediacara-Epoche, gewaltige evolutionäre Veränderungen heran, die sich im darauffolgenden Erdzeitalter beeindruckend entfalten sollten.
Im Kambrium (vor 541 bis 488 Millionen Jahren) überraschte die Architektin und Baumeisterin des Lebens die biologische Welt mit unerwarteten Innovationen und Inspirationen. Mit einem Schlag tauchten innerhalb kurzer Zeit nahezu alle heute bekannten Tierstämme auf. Die evolutionären Ideenblitze der kambrischen Radiation lösten eine explosive Entwicklung des irdischen Lebens aus. Zwar hatten nicht alle evolutionären Innovationen des Kambriums Bestand, aber die Erfindung des Außenskeletts, die zu den Gliedertieren führte, und die eines inneren Skeletts, die die Wirbeltiere hervorbringen sollte, bedeuteten faunistische Weichenstellungen. Im Kambrium entstand auch ein völlig neues biologisches Existenzschema. Fortan waren in der irdischen Fauna Räuber und Beute zu unterscheiden. Diese biologischen Antipoden sollten in den folgenden 500 Millionen Jahren in einen nicht enden wollenden evolutionären Aufrüstungswettstreit eintreten und vielfältige Angriffs- und Verteidigungswaffen entwickeln und perfektionieren.
Auch in den darauffolgenden Epochen des Paläozoikums (Erdaltertum), vom Ordovizium bis zum Perm, entwarf die Evolution intelligente Baupläne und schuf emsig, einfallsreich und unermüdlich großartige Stammbäume. Dabei hauchte sie so mancher bemerkenswerten Art Leben ein und gab ihrem Dasein eine Perspektive in einer biologischen Zukunft.
Im Ordovizium gedieh das Leben noch nahezu ausschließlich im Ozean. Es entstanden gewaltige Kopffüßer wie die Trilobiten und die ersten Fische. Im Silur begannen komplexer gebaute Gefäßpflanzen, Gliederfüßer und Weichtiere das Land für das Leben zu erobern. Der Landgang der Organismen in die noch sauerstoffarme Zone des Festlandes setzte sich im Devon fort. Gleichzeitig entfaltete sich in den Meeren, Flüssen und Seen eine ungeheure Vielfalt von Fischen. Im Karbon, dem großen Zeitalter der Amphibien, konnte sich das Leben schließlich fest an Land etablieren. Dank der Erfindung des hartschaligen Eies wurden die Reptilien von der Bürde einer an das Wasser gebundenen Fortpflanzung befreit. Erstmals bedeckten ausgedehnte Wälder aus Bärlapp-Gewächsen, Schachtelhalmen und Farnen die Kontinente. Aufgrund des hohen Sauerstoffgehaltes der Atmosphäre von über 30 % gelang es den Insekten, erstaunliche Riesenformen zu entwickeln. Im darauffolgenden Perm-Zeitalter vereinigten sich die Landmassen erneut zu einem Superkontinent. Die Bildung von Pangaea hatte globale Folgen für das Klima. An den Rändern des Kontinents war das Klima feucht und warm, sodass dort subtropische und tropische Bedingungen herrschten. Im Innern der Landmasse aber erstreckten sich lebensfeindliche Wüsten aus Felsen, Sand, Schnee und Eis.
Die Evolution verlief bereits im Erdaltertum keineswegs geradlinig, unbehelligt und ungestört. Es gab katastrophale Ereignisse mit weltweiten Auswirkungen, die zu Massensterben, Artenvernichtung und der Auslöschung ganzer Gattungen führten. Solche Vernichtungs-szenarien sind für das Ende des Ordoviziums, im unteren Devon und am Ende des Perms nachgewiesen.
Die Katastrophe am Ende des Perm-Zeitalters war die größte Apokalypse, die das irdische Leben in seiner Geschichte von etwa 3,5 Milliarden Jahren heimgesucht hat. Vor ungefähr 250 Millionen Jahren ist das höhere Leben auf dem Planeten beinahe ganz vernichtet worden. Etwa 95 % der maritimen Arten und ungefähr 75 % der landlebenden Spezies wurden in wohl nur 100.000 Jahren ausgelöscht. Als Ursachen für das Katastrophenszenario am Ende des Perms werden von der Wissenschaft verheerender Vulkanismus oder der Einschlag eines sehr großen Asteroiden diskutiert. Doch was auch immer die Vernichtungsorgie ausgelöst haben mag, das Leben und die Evolution auf der Erde erlitten durch das Perm-Ereignis einen existenziellen Niederschlag. Das Massensterben am Ende des Perms stellte die Zukunft des höher organisierten Lebens auf dem Planeten infrage. Ob sich die Evolution jemals von dieser Katastrophe würde erholen können, schien ungewiss zu sein! Nun, der weitere Fortgang der evolutionären Prozesse ist bekannt. Das Schöpfertum der Evolution wurde am Ende des Perms nicht abrupt beendet. Die Evolution ließ sich von der Zeit nicht auszählen und zur Geschichte machen! Sie zeigte hervorragende „Nehmerqualitäten“, stand auf, besann sich auf ihr Schöpfertum und rettete das höhere Leben auf der Erde vor der Vernichtung. Im Mesozoikum (Erdmittelalter) sollten ihre Inspirationen, Innovationen und kreativen Ideen eine wunderbare Blüte und Renaissance erleben.
Was nach dieser tiefen evolutionären Zäsur auf einer warmen, überwiegend eisfreien Erde entstand, waren beeindruckende Floren und Faunen, die mit Begriffen wie erstaunlich, fantastisch, dynamisch, kolossal, gigantisch nur unvollständig beschrieben werden können. Das Erdmittelalter war zu Lande, zu Wasser und in der Luft die große Zeit der Reptilien und die Wiege der Vögel. Es ist auch das Zeitalter der weltweiten Ausbreitung der Nadelbäume und des evolutionären Siegeszuges der Blütenpflanzen. Die Welt der mesozoischen Troika Trias/Jura/Kreide wurde von einer bewunderungswürdigen Schöpfungskraft, einem großartigen Erfindungsgeist und dem komplexen Gestaltungswillen der Evolution geprägt. Auch das vierte Massensterben am Ende der Trias konnte die evolutionären Prozesse nicht nachhaltig zum Stillstand bringen. In einer ausufernden Experimentierfreude und beinahe liebevoller Ausgestaltung erschuf die Evolution in der Ordnung der Reptilien Art um Art; von nur wenigen Zentimetern großen Geschöpfen bis hin zu wahren Kathedralen aus Fleisch und Blut. Die Dinosaurier gerieten dabei zu ihrem Meisterstück. Wer weiß, wie sich diese Gattung noch entwickelt hätte, wenn sie evolutionär weiterperfektioniert worden wäre?
Doch dann beendete der Einschlag eines 15 bis 20 km großen Asteroiden vor 65,8 Millionen Jahren die erdmittelalterliche Schöpfungsphase der Evolution und löste ein fünftes Massensterben aus. Das Impakt-Ereignis am Ende der Kreidezeit war für das höhere Leben auf der Erde zwar einschneidend, bedrohte es aber nicht grundsätzlich in seiner Existenz. Gleichwohl erfolgten dadurch eine evolutionäre Zäsur und Neuorientierung, die sich für die Entwicklung des Lebens als richtungsweisend erwiesen.
Irgendwie kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Evolution – wenn sie sich denn personifizieren ließe – über die Vernichtung ihres großen Arsenals an Sauropoden- und Theropoden-Bauplänen am Ende der Kreidezeit schon ein wenig betrübt gewesen sein mag! Doch was blieb der Evolution anderes übrig, als die von einem kosmischen Zufallsereignis geschaffenen Fakten zu akzeptieren und sich einem Neubeginn unter veränderten Bedingungen zu stellen! Sie hatte das nach dem vorangegangenen globalen Massensterben schließlich schon mehrfach tun müssen. Die Evolution besann sich auf ihr Schöpfertum, entwarf neue innovative Baupläne und besetzte frei gewordene Nischen des Lebens mit originellen Kreationen. Allerdings sollten die mesozoischen Dimensionen auf dem Land und in der Luft nicht mehr erreicht werden.
Die Katastrophe am Ende der Kreidezeit öffnete das evolutionäre Tor zur großen Zeit der Säugetiere, die im folgenden Paläogen und Neogen eine unerwartete Blüte erlebten. Der Aufstieg der lebend gebärenden Fellträger resultierte vermutlich aus der Tatsache, dass sie warmblütig und nachtaktiv waren sowie ein verfeinertes Hör- und Sehvermögen besaßen und einen verbesserten Geruchssinn entwickelten. Die Evolution hatte die Ordnung der Säugetiere etwa 100 Millionen Jahre lang vergleichsweise stiefmütterlich behandelt. Vom Paläozän bis zum Pliozän schien es über 60 Millionen Jahre lang, dass die Geschichte des Lebens von der Evolution mit einer großartigen Blüte der Säugetiere einfach fortgeschrieben werden sollte. Doch dann begannen sich am Ende des Pliozäns vor über drei Millionen Jahren unerhörte Dinge zu ereignen. Nach und nach stiegen bestimmte Primaten von den schützenden Bäumen und begannen Verstand, Werkzeuge und eine Kommunikation mithilfe einer Sprache zu entwickeln.
Der Aufstieg der vernunftbegabten Primaten gestaltete sich am Anfang durchaus mühselig und beschwerlich. Die ersten Homininen waren zweifellos mehr Beute denn Jäger und hatten alle Hände voll zu tun, das Überleben ihrer Arten in einer gefährlichen und rauen Umwelt zu sichern. Zunehmende globale Vereisungen gestalteten die Lebensbedingungen in den nördlichen Breiten unwirtlich und lebensfeindlich. Sie beeinflussten auch das Klima in der afrikanischen Wiege der Menschheit nachhaltig. Den Fossilien-Funden zufolge scheint Ostafrika das bevorzugte Experimentierfeld der Evolution in Richtung Menschwerdung gewesen zu sein. Immerhin brauchte die Evolution mindestens fünf Millionen Jahre und zahlreiche Ansätze, um aus den Vorfahren der Menschenaffen über Affenmenschen, Vormenschen und Nebenmenschen vor etwa 2 Millionen Jahren schließlich Frühmenschen zu erschaffen. „Homa ergaster“ soll die erste Menschenform gewesen sein, die den afrikanischen Kontinent verließ und als aufrecht gehender Hominine Europa und Asien für mehrere 100.000 Jahre besiedelte. Die Evolution gab sich damit aber nicht zufrieden. Sie perfektionierte ihre Schöpfungen weiter und es erfolgten weitere Auswanderungswellen. Vor 200.000 Jahren entstanden in Asien und Europa als evolutionäre Antwort auf die dortigen eiszeitlichen Bedingungen die Neandertaler und Denisovianer. Etwa zur gleichen Zeit erschuf die Evolution in Afrika den modernen Menschen homo sapiens sapiens. Die evolutionär gelungenste Form einer vernunftbegabten Spezies besiedelte in weniger als 60.000 Jahren Europa, Asien, Australien und beide amerikanischen Kontinente. Dabei verdrängte die Art allmählich offenbar auch die anderen Homininen. Nach dem Ende der letzten Eiszeit stieg der moderne Mensch schließlich in weniger als 12.000 Jahren zum Herrn des Planeten Erde auf.
Vielleicht hätte das evolutionäre Experiment „Vernunft“ auch in anderen Bauplänen des Lebens verwirklicht werden können. Am Ende des Mesozoikums wären dafür möglicherweise Raptoren infrage gekommen, wenn der Evolution mehr Zeit zur Verfügung gestanden hätte. Darüber hinaus gibt es auch einige vielversprechende evolutionäre Ansätze bei rezenten Arten wie beispielsweise Delfinen oder den Menschenaffen. Doch der Mensch mit seinen vielfältigen globalen und oft zerstörerischen Aktivitäten dürfte der biologischen Evolution für weitere Experimente in Sachen „Vernunft“ und „Verstand“ weder Zeit noch Raum lassen.
Im Gegenteil, dem homo sapiens wird vorgeworfen, durch seinen Aufstieg an die Spitze der irdischen Fauna ein schleichendes sechstes Massensterben ausgelöst zu haben. Diese Sichtweise mag im Kern berechtigt sein, doch kann die Situation mit den Szenarien bei früheren Katastrophen nicht gleichgesetzt werden. Die fortschreitende Zerstörung der irdischen Biosphäre und der unwiederbringliche Verlust von Biodiversität sind der vernunftbegabten Spezies bewusst. Zunehmendes ökologisches Denken führt dazu, dass die Menschheit durchaus bemüht ist, nachteilige Folgen menschlicher Aktivitäten bei der Eroberung und Ausgestaltung von Lebensräumen zu begrenzen. Ob diese Anstrengungen und Initiativen ausreichen oder wirksam genug sein werden, um das beschworene sechste Massensterben zu verhindern, ist jedoch mehr als fraglich. In Anbetracht des ungebremsten Bevölkerungswachstums scheint den Menschen nämlich die Zeit für einen effizienten Schutz der Biosphäre des Planeten und der Erhaltung ihrer Diversität mehr und mehr davonzulaufen. Die fatalen Folgen und bitteren Konsequenzen dieser bedenklichen Entwicklung werden allerdings erst künftige Generationen im vollen Umfang zu spüren bekommen. Für die Menschen der Gegenwart bleibt nur zu hoffen, dass die Nachgeborenen unsere Überheblichkeit, Fehler, Ignoranz und Untätigkeit nicht verfluchen werden!
Das gelungene evolutionäre Experiment der Erschaffung einer Spezies, die über einen Verstand verfügt und zur Vernunft befähigt ist, wirft viele Fragen auf. Erstmals in der langen evolutionären Geschichte des Lebens auf der Erde könnte ein Kind der Evolution auf den Gedanken kommen, seiner Schöpferin ins „Handwerk“ zu pfuschen und die weitere evolutionäre Entwicklung mitbestimmen zu wollen. Sollte man diesen Gedanken als eine schöpferische Posse abtun, eine evolutionäre Panne betrachten oder als einen Geniestreich in einem mehr oder minder zwangsläufigen Prozess verstehen? Wie auch immer man diese Frage beantworten mag, die Entstehung einer zur Selbsterkenntnis und zum höheren Denken befähigten Art eröffnete ein neues evolutionäres Szenario. Die Evolution hat damit Abläufe in Gang gesetzt, die nicht mehr allein ihren Regeln und Gesetzen unterliegen.
Seit etwa 100.000 Jahren wird die biologische Evolution der Homininen durch eine Entwicklung überlagert, die zunehmend an Dynamik gewinnt. Es handelt sich um die soziokulturelle Evolution der menschlichen Gesellschaft. Anfänglich war diese Dynamik gesellschaftlicher Entwicklung noch unbedeutend, doch in den letzten 10.000 Jahren hat sie sich zu der bestimmenden Komponente in der Entwicklung der Menschheit entwickelt. Die biologische Evolution der Gattung homo sapiens ist jedoch keineswegs beendet, denn sie setzt sich nach wie vor fort. Allerdings wirken ihre Mechanismen in einer Zeitskala von einigen Zehntausend bis Hunderttausend Jahren. Die soziokulturelle Evolution vollzieht sich dagegen in Jahrzehnten oder Jahrhunderten und scheint sich weiter zu beschleunigen. Damit läuft dieser evolutionäre Prozess etwa drei Größenordnungen schneller ab als biologische Anpassungen. Insofern tritt die biologische Optimierung der Art in einem überschaubaren Zeitmaßstab hinter die weitere Ausgestaltung gesellschaftlicher und zivilisatorischer Prozesse zurück. Für die evolutionäre Entwicklung der Menschheit ist es nicht wichtig, was der Art in einer Million Jahren widerfahren könnte. Für die Weiterentwicklung und das Fortbestehen der Kultur der Art homo sapiens sapiens sollten vielmehr die nächsten 5.000 bis 10.000 Jahre entscheidend sein. Wohin aber könnte die soziokulturelle Evolution die Menschheit führen? Freilich lassen sich dazu nur Spekulationen anstellen. Seriöse Prognosen sind bekanntermaßen, insbesondere, wenn sie die Zukunft betreffen, schwierig. Diese frappierende Erkenntnis eines Witzboldes wird Mark Twain oder Karl Valentin zugeschrieben. Sie sollte einen Visionär eigentlich davon abhalten, sich darin zu versuchen. Doch ohne sich in Details verlieren zu wollen, scheinen aus heutiger Sicht wohl drei grundsätzliche Szenarien denkbar zu sein. Dabei tut es nichts zur Sache, dass diese gedanklichen Ansätze einem Science-Fiction-Roman entsprungen sein könnten.
Szenario 1 (eine Endzeit-Version)
Auf der Erde findet eine weitgehend irreversible Zerstörung der Biosphäre mit katastrophalen Folgen für die globale Umwelt und die Lebensqualität der Menschen statt. Darüber hinaus haben sich die wichtigsten irdischen Ressourcen durch Raubbau total erschöpft und sind zu zivilisatorischen Streitobjekten geworden. Diese Prozesse lösen gesellschaftliche Konflikte aus, in deren Folge es zu einer verheerenden globalen Auslöschung von Leben, der Vernichtung zivilisatorischer Errungenschaften sowie einer Zerstörung der Umwelt, einschließlich der Atmosphäre, kommt.
Für eine weltweite Vernichtungsorgie von höherem Leben kommen auch kosmische Ursachen wie ein kolossales Impakt-Ereignis mit einem großen Asteroiden, eine nahe Supernova oder ein Treffer durch einen verheerenden Gamma-Blitz infrage. Schließlich ist auch eine apokalyptische Pandemie als Auslöser für einen drastischen Niedergang der menschlichen Zivilisation denkbar.
Wenn die Gattung homo sapiens diese evolutionäre Zäsur biologisch überstehen sollte, könnten sich archaisch anmutende, nachzivilisatorische Kulturen entwickeln. Sie werden über keine Hochtechnologien verfügen, keine nennenswerte wissenschaftliche Forschung betreiben und geistig-kulturell wohl überwiegend im Dunkel fatalistischer Religiosität versinken. In diesem „Endzeit-Szenario“ wird die soziokulturelle Evolution der Menschen auf einem sehr niedrigen Niveau verharren, wobei praktisch keine oder nur sehr ungewisse Perspektiven für einen erneuten soziokulturellen Aufschwung des homo sapiens bestehen. Das Risiko des Aussterbens der Art infolge von Krankheiten, Seuchen, Nahrungsmangel und abnehmender Fertilität dürfte in diesem Endzeit-Szenario beträchtlich sein. Angesichts der ausweglos erscheinenden zivilisatorischen Situation könnte die biologische Evolution über kurz oder lang wieder das Geschehen in einer sich vielleicht langsam erholenden Biosphäre des Planeten bestimmen. Wahrscheinlich wird sie dann, wie sie es auch früher schon nach anderen Massensterben auf der Erde getan hat, einen evolutionären Neustart des biologischen Lebens beginnen.
Szenario 2 (Variante „lichte Zukunft“)
Die Menschen können die soziokulturelle Evolution so steuern, dass die globalen Disproportionen in Bezug auf die Verteilung der Ressourcen (vor allem Wasser, Rohstoffe, fruchtbare Böden, Nahrungsquellen) verantwortungsbewusst und ökologisch vertretbar auf ein Maß allgemeiner Akzeptanz eingeschränkt werden. Darüber hinaus gelingt es durch einen fairen Handel sowie durch Transfer- und Ausgleichsmaßnahmen, weltweit annähernd gleiche Lebensverhältnisse herzustellen. Voraussetzung für das Gelingen einer solchen globalen Interessenübereinkunft ist jedoch die wirksame Begrenzung des ungehemmten Bevölkerungswachstums. Die demografische Fehlentwicklung ist nämlich die Hauptursache für die meisten zivilisatorisch bedingten und verursachten Übel (z. B. Raubbau, Massentierhaltung, Überfischung, Umweltverschmutzung, fehlende klimaneutrale Energieversorgung usw.). Neben der Abwendung der demografischen Katastrophe kann auch die soziale Frage (Gegensatz zwischen arm und reich) vom Grundsatz her gelöst werden.
Die technologische und wissenschaftliche Entwicklung schreitet weiter voran. Es wird zunehmend qualifizierte Raumfahrt betrieben, die auch den Abbau von Rohstoffen auf dem Mond oder nahen Asteroiden ermöglicht. Vielleicht lässt sich die ökologische Situation auf der Erde weiter wirksam entspannen, wenn durch eine Art Terraforming die Kolonisierung des Planeten Mars ermöglicht werden kann. In diesem Zukunftsszenario sollte die soziokulturelle Evolution trotz einer gewissen Bandbreite von verbleibenden gesellschaftlichen Konflikten vielleicht zu einer gesicherten Perspektive der menschlichen Zivilisation führen.
Szenario 3 (eine vermutlich realistische Version)
Es findet zwar keine dramatische, jedoch eine schleichende Zerstörung der Biosphäre des Planeten statt. Darüber hinaus gelingt es auch nicht, die soziokulturelle Evolution so zu steuern, dass die weltweiten gesellschaftlichen und zivilisatorischen Gradienten und Spannungen auf ein akzeptables Niveau abgebaut und grundlegende ökologische Probleme gelöst werden. Die Welt zerfällt in arme, reiche und aufstrebende Regionen, die sich mehr oder minder konfrontativ gegenüberstehen. Streitobjekte sind vor allem die noch verfügbaren Ressourcen (vor allem Energie, Wasser, Bodenschätze, Nahrungsquellen). Dabei kommt es vermutlich zu einer gesellschaftlichen Abschottung zwischen den unterschiedlichen Regionen, die durch historische, religiöse, kulturelle und anderweitige zivilisatorische Gründe begünstigt und beeinflusst wird. Die spannungsgeladene globale gesellschaftliche Situation könnte durch weltweiten Terrorismus, global organisierte Kriminalität und permanente unkalkulierbare Migrationsströme weiter destabilisiert werden.