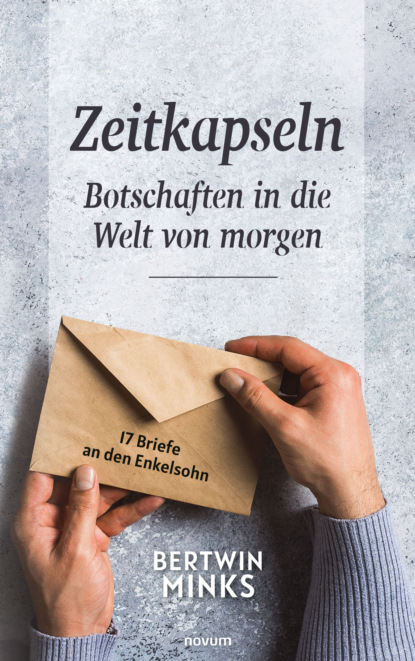- -
- 100%
- +
Diese himmelsmechanischen Zyklen wirken natürlich auch in der Zukunft fort. Ihre Zeitskala umfasst Jahrzehntausende bis hin zu einigen Hunderttausend Jahren. Wie ausgeprägt und in welchen Zeiträumen die Milankovic-Zyklen das globale Klima wirksam beeinflussen können, hängt allerdings von der Überlagerung mit anderen klimawirksamen Faktoren ab.
Das globale Klima kann auch durch andere astronomische Ereignisse massiv und nicht vorhersagbar beeinflusst werden. Einschläge von größeren Asteroiden oder Kometen haben in der Erdgeschichte mehrfach Spuren hinterlassen. Durch solche Katastrophen-Szenarien wird auch das globale Klima einschneidend verändert. Impakte sind als Zufallsereignisse nicht berechenbar oder vorhersagbar, doch sie können die Klimaentwicklung des Planeten praktisch jederzeit erheblich und für lange Zeiträume umgestalten.
2.6 Kosmische Strahlung
Bei der kosmischen Strahlung handelt es sich um eine hochenergetische Teilchenstrahlung, die von der Sonne, der Milchstraße und aus anderen Galaxien stammt. Sie besteht vor allem aus Protonen (87 %), Alpha-Teilchen (12 %) und sonstigen schwereren vollständig ionisierten Atomkernen. Seit etwa 50 Jahren wird ein Zusammenhang zwischen der kosmischen Strahlung und einer Bildung von Wolken diskutiert. Damit könnte der Intensität der kosmischen Strahlung auch ein Einfluss auf das globale Klima in Form eines abkühlenden Effektes zugeschrieben werden.
Das Erdmagnetfeld stellt normalerweise einen Schutzschild gegen die kosmische Strahlung dar, indem es die Teilchen weitgehend aus der Atmosphäre eliminiert. Es mehren sich jedoch die Anzeichen, dass eine Umpolung des irdischen Magnetfeldes in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten bevorstehen könnte. Die Feldstärke des irdischen Magnetfeldes schwächt sich nämlich seit Jahrzehnten ab. Außerdem ist der magnetische Südpol in den letzten 50 Jahren aus dem kanadischen Archipel über den arktischen Ozean in Richtung der ostsibirischen Inseln gewandert. Diese Polwanderung stellt ein Anzeichen für einen bevorstehenden Umpolungsprozess des Erdmagnetfeldes dar. Er findet im Mittel etwa alle 250.000 Jahre statt. Die letzte Umpolung soll bereits 780.000 Jahre zurückliegen. Das Ereignis ist sozusagen überfällig. Daneben gibt es tiefe kurze Magnetfeldeinbrüche ohne Umpolung, die häufiger stattfinden. Der letzte derartige Einbruch ereignete sich vor 10.000 Jahren.
Die Ursachen für die erdmagnetischen Phänomene werden in instabilen Konvektionen im äußeren Erdkern vermutet. Sie sind aber letztlich nicht genau bekannt. Bei einer Umpolung wird die magnetische Feldstärke allmählich gegen null tendieren und sich danach in entgegengesetzter Feldrichtung langsam wiederaufbauen. Durch diesen Prozess verliert der Planet für eine bestimmte Zeitspanne seinen magnetischen Schutzschild gegen die kosmische Teilchenstrahlung. Es wird vermutet, dass es dabei zu einer verstärkten Wolkenbildung in der Atmosphäre der Erde kommen könnte. Ob und inwieweit dadurch eine spürbare und nachhaltige Abkühlung auf der Oberfläche des Planeten bewirkt wird, bleibt abzuwarten, weil das Ausmaß des Effektes von der Wechselwirkung mit anderen klimawirksamen Faktoren abhängig ist.
3. Die Achterbahnfahrten des globalen Klimas im Quartär
Eisfreie Polkappen stellen erdgeschichtlich den globalen Normalzustand dar, der etwa 80 bis 90 % der Erdgeschichte vorgeherrscht hat. Prominente Beispiele dafür sind das paläozoische Karbon, die mesozoische Kreidezeit und das Paläogen. Erdgeschichtliche Zeiten mit vereisten Polkappen (sogenannte Eiszeiten) werden als geophysikalische Ausnahmesituationen betrachtet. Die aktuelle erdgeschichtliche Periode, das Quartär, befindet sich im känozoischen Eiszeitalter, dem Pleistozän. Seit Beginn des Pleistozäns vor etwa 2,5 Millionen Jahren haben ungefähr 20 Zyklen aus Kalt- und Warmzeiten stattgefunden. Eine Warmzeit bezeichnet in der Klimageschichte einen Zeitraum mit im Durchschnitt höheren Temperaturen zwischen zwei Zeitabschnitten mit durchschnittlich tieferen Temperaturen, den sogenannten Kaltzeiten.
In den Warmzeiten lag die durchschnittliche Temperatur in der Regel über den heutigen Werten. In der Eem-Warmzeit sind die Temperaturen beispielsweise in Grönland etwa 5 °C höher gewesen als heute. Daher waren auf der Insel wahrscheinlich die südlichen Gletscher abgeschmolzen. Die jüngste Warmzeit, der die Menschen den Namen Holozän gegeben haben, dauert bereits seit 12.000 Jahren an. Sie hat aber ihr Klimamaximum bereits vor 8.000 Jahren im ausgehenden Mesolithikum erreicht. Einen Überblick über die letzten großen Kalt- und Warmzeiten zeigt die nachfolgende Übersicht:
Kaltzeiten (KZ) und Warmzeiten (WZ)
KZ: Weichsel/Würm – Dauer von vor 12.000 bis vor 115.000 Jahren; WZ: Eem – Dauer von vor 115.000 bis vor 128.000 Jahren
KZ: Saale/Riss – Dauer von vor 128.000 bis vor 310.000 Jahren; WZ: Holstein – Dauer von vor 310.000 bis vor 335.000 Jahren
KZ: Elster/Mindel – Dauer von vor 335.000 bis vor 480.000 Jahren; WZ: Cromer – Dauer von vor 480.000 bis vor 800.000 Jahren
KZ: Elbe/Günz – Dauer von vor 0,8 Mio. bis vor 1,2 Mio. Jahren; WZ: Waal – Dauer von vor 1,2 Mio bis vor 1,45 Mio. Jahren
Das Auf und Ab der Temperaturkurven hat die Flora und Fauna und nicht zuletzt auch die Gattung Homo sapiens vor große Herausforderungen gestellt. Doch viele Arten haben wie der moderne Mensch die Achterbahnkurven des Klimas relativ gut gemeistert. Dazu zählen beispielsweise auch die Eisbären. Erbgutanalysen zufolge existiert diese Art seit 600.000 Jahren und sie ist auch im Holozän biologisch erfolgreich. Das größte Landraubtier der Erde muss seit seinem Erscheinen mindestens zwei große pleistozäne Warmzeiten überstanden haben. Insofern bedienen rührselige Bilder, die abgemagerte und hungrige Eisbären auf einsamen, abschmelzenden Eisschollen zeigen, nur Klischeevorstellungen, die der erfolgreichen Evolutionsgeschichte der Art Ursus maritimus nicht gerecht werden.
4. Klimamodelle
Ein Klimamodell ist im Prinzip ein Computermodell zur Berechnung und Projektion eines Klimazustandes in einem bestimmten Zeitintervall. Es basiert auf einem ähnlichen meteorologischen Modell wie bei der Wettervorhersage, das in der Regel um ein Ozeanmodell, ein Schnee- und Eismodell (für die Kryosphäre) und ein Vegetationsmodell (für die Biosphäre) erweitert wird. Mathematisch handelt es sich bei der Modellierung um ein System nichtlinearer partieller und gewöhnlicher Differenzialgleichungen sowie einiger algebraischer Gleichungen (der Form:
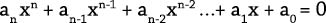
Die Klimawissenschaft unterscheidet zwischen globalen Modellen (mit nur grober Auflösung) und regionalen Modellen für ein bestimmtes Simulationsgebiet (mit höherer Auflösung). Den Gegenstand solcher Modelle bilden sowohl retrospektive Aussagen zur Klimageschichte als auch prospektive Projektionen, die das Klima in der Zukunft vorhersagen sollen.
Die erzielten Ergebnisse sind je nach Modellaufwand unterschiedlich zu bewerten. Für zahlreiche erdgeschichtliche Perioden lassen sich die aus Bohrkernen ermittelten realen Temperaturverläufe relativ gut approximieren. Bei abrupten, seltenen und unvorhersehbaren Klima-Ereignissen versagen die Modelle aber in der Regel. Man muss sich letztlich auch bewusst sein, dass Klimamodelle natürliche Grenzen haben. Diese Schranken resultieren aus den verwendeten Modellen, der begrenzten Anzahl der berücksichtigten Einflussfaktoren, Zufallsereignissen und unzureichend verstandenen physikalischen Grundlagen. So ist beispielsweise die Aktivität der Sonne mathematisch-physikalisch nicht exakt modellierbar. Deshalb kann die zeitliche Veränderung der solaren Strahlungsleistung nicht vorhersagt werden. Darüber hinaus sind Vulkanausbrüche prinzipiell nicht vorhersehbar und auch ozeanische Phänomene wie El Nino und La Nina können, was den Zeitpunkt ihres Auftretens und ihre Intensität anbelangt, prospektiv bisher noch nicht zuverlässig ermittelt werden.
Überdies wird unter Klimatologen nach wie vor das Ausmaß der Klimawirksamkeit des Treibhausgases CO2 diskutiert oder sogar infrage gestellt. Kritiker fordern zudem, dass in den existierenden Klimamodellen eine richtige Balance zwischen der anthropogen verursachten Klimabeeinflussung und der Wirkung natürlicher Klimafaktoren gefunden werden muss.
Die öffentliche Anerkennung und wissenschaftliche Akzeptanz von Klimamodellen hängen ganz wesentlich von ihrer Trefferquote ab. Was den Wahrheitsgehalt prospektiver Modelle anbelangt, wird sich allein das Klima der Zukunft als ein wissenschaftlicher Scharfrichter für die Voraussagen erweisen.
5. Klimaziele und der Handel mit CO2-Zertifikaten
Ein Ergebnis der anhaltenden Klimadiskussion um die von Menschen gemachte Erderwärmung ist das Aufstellen von nationalen und internationalen Klimazielen zur Begrenzung der anthropogen verursachten CO2-Emissionen. Wesentliche Instrumente dieser Ziele sind die Besteuerung von Kohlendioxidemissionen und der Handel mit CO2-Zertifikaten und Emissionsrechten. Die vergebenen Emissionsrechte richten sich an die Betreiber von emissionsrelevanten Anlagen. Die ausgestellten Zertifikate beziehen sich auf genehmigte Mengen von ausgestoßenem CO2. Die Kritik an diesem Handel fokussiert sich auf die Vergabe von zu vielen Emissionsrechten und den Freikauf vom CO2-Reduzierungsgebot durch den wenig transparenten Erwerb von zu zahlreich vorhandenen Zertifikaten. Außerdem scheint dieser Markt inzwischen ein Tummelplatz für unseriöse Anbieter, Betrüger und Kriminelle geworden zu sein (wie Kommentaren aus dem Netz zu entnehmen ist).
Abgesehen davon mag dieser Handel möglicherweise bei dem einen oder anderen aber auch moralisch problematische Assoziationen an die Aktivitäten des Dominikanermönches Tetzel wecken, der zu Beginn des 16. Jahrhunderts im Ablasshandel mit sündigen Seelen in Deutschland äußerst erfolgreich gewesen sein soll!
Bei den Klimazielen geht es nicht vordergründig um die Begrenzung der globalen Oberflächentemperatur, sondern zunächst nur um die Verminderung der Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre. Weitere Ziele sind die Erhöhung der Anteile „erneuerbarer“ Energien und die Senkung des Primär-Energieverbrauchs.
Temperaturschranken zur Begrenzung der Erderwärmung wurden dagegen in internationalen Vereinbarungen (z. B. Kyoto, Paris) im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten festgelegt. Allerdings wird dieser Zeitrahmen lokal und historisch nicht genau definiert oder eingegrenzt. Nach diesen Abkommen soll der globale Temperaturanstieg bis zum Jahr 2.100 auf 2 °C begrenzt werden. Die Vorgaben basieren vor allem auf Computer-Simulationen, die (ausschließlich) den Anstieg der anthropogen verursachten atmosphärischen Kohlendioxidkonzentration abbilden.
Der Ansatz, der den Klimazielen zugrunde liegt, scheint aufgrund folgender Annahmen unvollständig zu sein und wissenschaftlich den komplexen Wechselwirkungsmechanismen klimarelevanter Faktoren nur unzureichend Rechnung zu tragen. Dafür seien beispielhaft folgende Argumente angeführt:
1. Nach dem gegenwärtigen Ansatz wird für die globale Erwärmung allein die steigende CO2-Konzentration in der Atmosphäre als ursächlich angenommen.
2. Es wird postuliert, dass die Variabilität der atmosphärischen Kohlendioxidkonzentration mehr oder weniger ausschließlich vom Menschen verursacht wird.
zu 1.:
Diese These ist unter Klimatologen nach wie vor umstritten. Paläoklimatische Daten scheinen die Ausschließlichkeit dieser Interpretation nicht zu bestätigen. Darüber hinaus werden andere klimawirksame Faktoren bei der Festlegung von Klimazielen völlig ausgeblendet. Was ist beispielsweise, wenn der Parameter der solaren Strahlungsleistung im Rahmen einer sich verändernden Sonnenaktivität, die nicht voraussagbar ist, signifikant schwankt (siehe z. B. Maunder-Minimum) oder sich das thermodynamische Verhalten der transozeanischen Strömungen aus bisher unbekannten Gründen plötzlich spürbar verändert?
zu 2.:
Die Plausibilität dieser Annahme kann nicht überzeugen, weil sie die unvollständige Erfassung und die Stochastik der Aktivität und Intensität natürlicher Quellen außer Acht lässt. Selbst wenn der Eintrag von CO2 in die Atmosphäre durch weltweiten Vulkanismus wesentlich unter der Menge des anthropogen verursachten Anteils liegen sollte, ist und bleibt er aber eine unberechenbare Größe. Sogar einzelne Ereignisse können zeitweilig einen erheblichen Einfluss auf das globale Klima haben. Auch wenn die klimawirksame Nachhaltigkeit der Aktivität natürlicher Quellen in der Regel gering zu sein scheint, vermag der Mensch diese Vorgänge jedoch in keiner Weise zu beeinflussen.
6. Fazit und Ausblick
Die Oberfläche des Planeten Erde ist in ihrer Geschichte gewaltigen und mannigfaltigen Veränderungen unterworfen gewesen. Seit dort vor etwa drei Milliarden Jahren das Phänomen Klima entstanden ist, sind Gebirge aufgefaltet und von der Erosion eingeebnet worden sowie Meere und Kontinente entstanden, die die Plattentektonik wieder ausgelöscht hat. Im erdgeschichtlichen Werden haben Eis- oder Kaltzeiten sowie wärmere Epochen das Antlitz des dritten Planeten unseres solaren Systems geprägt. Sie sind entstanden, wenn sich klimawirksame Faktoren überlagert haben und verschwanden wieder, wenn diese Kongruenzen verloren gingen. An diesem steten Wandel der Bedingungen auf der Erdoberfläche scheinen allein die geophysikalischen Veränderungen das Beständige zu sein.
Die Menschen sollten in die von der Natur gesteuerten klimatischen Vorgänge nicht oder nur behutsam eingreifen. Klimaneutralität scheint das Zauberwort der klimapolitischen Überzeugungen der Gegenwart zu sein! An dieser Maxime werden sich künftig die globalen Aktivitäten unserer Zivilisation messen lassen müssen. Die vernunftbegabte Spezies auf diesem Planeten muss sich aber auch bewusst sein, dass klimatische Veränderungen keine Einbahnstraßen darstellen. Wir leben gegenwärtig in einer Warmzeit des Pleistozäns. Doch in künftigen Erdzeitaltern sollen die Kontinente durch die Plattentektonik erneut zusammenrücken. Diese geotektonischen Prozesse werden in der Zukunft zu gewaltigen Veränderungen des globalen Klimas führen. Dann können auch Kalt- oder Eiszeiten durchaus wieder eine geophysikalische Option für das Klima auf dem Planeten Erde sein!
Doch wer vermag schon zu sagen, ob die rezenten Vertreter der Gattung homo sapiens dann noch diesen Planeten bevölkern werden und über Klimaneutralität, Klimaziele oder das Für und Wider eines bewusst anthropogen beeinflussten Klimawandels streiten können?
4. Brief vom 7. Oktober 2019
Anlagen
Nachdenkblatt – Energiewende einmal anders betrachtet – Das raumzeitliche Perpetuum mobile
Leipzig, 7. Oktober 2019,
zu öffnen am 1. Mai 2035
Mein lieber Matti,
an dem Tag, an dem du diesen Brief öffnen wirst, könnte ich meinen 85. Geburtstag feiern, natürlich nur, wenn mir das von meinem Lebensschicksal vergönnt sein sollte. Dieses Alter liegt über dem Wert, den die einschlägigen Statistiken für die Lebenserwartung eines Menschen meines Jahrgangs vorsehen. Na schauen wir mal, ob die Zukunft ein derart gnädiges Schicksal für mich bereithalten wird. Aber lassen wir den Familien- und Lebenskram heute einmal beiseite. Ich möchte dir in diesem Brief meine Ansichten zu einem gewichtigen gesellschaftlichen Thema mitteilen, das auch deine Zukunft maßgeblich berühren dürfte.
Das Konzept der sogenannten „Energiewende“ beherrscht ähnlich wie die „Klimawandel-Problematik“ seit einigen Jahren die öffentliche Diskussion in unserem Land. Sie wird es sicherlich auch noch eine ganze Weile tun. Der Begriff Energiewende bezeichnet im Kern den mehr oder weniger vollständigen Verzicht auf fossile Brennstoffe, wie Kohle, Erdgas oder Öl, zur Energieerzeugung. Er umfasst darüber hinaus aber auch die konsequente Ablehnung der friedlichen Nutzung der Kerntechnologie zur Energiegewinnung. Stattdessen sollen Windkraft, Fotovoltaik, Solarthermie, Geothermie und Biogasverstromung den Weg in eine ökologisch unbedenkliche Zukunft der Energieerzeugung eröffnen.
Wenn man die Diskussion in den Medien aufmerksam verfolgt oder im Internet dazu recherchiert, dann führt an diesem Energiekonzept bei energiepolitischen Betrachtungen heutzutage (2019) kaum mehr ein Weg vorbei. Politik und Medien versuchen, den Leuten zu vermitteln, dass dieser energiepolitische Ansatz als ein energiewirtschaftlicher „Königsweg“ alternativlos sei. Es heißt, dass bei dessen konsequenter Umsetzung es sogar gelingen könnte, die Eintracht von Menschen und Natur wiederherzustellen. Doch sind diese Vorstellungen bloße energieromantische Schwärmereien oder wirklich so folgerichtig, zwangsläufig und scheinbar unabwendbar?
Matti, ich gestehe dir unumwunden, dass ich an der angeblich so alternativlosen Energiewende grundlegende Zweifel habe. Das Nachdenkblatt soll dich auf einige Schwachstellen und Ungereimtheiten an dem von der Politik und den Medien propagierten energiepolitischen Konzept aufmerksam machen.
Versteh’ mich bitte nicht falsch, Sonne und Wind können trotz der in der Anlage zu diesem Brief skizzierten technologischen Unzulänglichkeiten und naturgesetzlichen Schranken regional durchaus einen sinnvollen Beitrag zur Versorgung von Haushalten oder auch Gewerbebetrieben mit elektrischer Energie leisten. Was mich an dem Konzept der angeblich alternativlosen Energiewende stört, ist der ideologisch daherkommende und vehement propagierte Ausschließlichkeitsanspruch der sogenannten „erneuerbaren“ Energien. Die Initiatoren und Befürworter der als „Energiewende“ deklarierten energiepolitischen Vorstellungen versuchen, den Leuten weiszumachen, dass man den Energiebedarf eines hoch industrialisierten Landes wie Deutschland mit Windturbinen, fotovoltaischen Anlagen und vielleicht noch Biobrennstoffen problemlos decken kann. Ein so einseitig ausgerichtetes energiepolitisches Konzept, das unser Land vor allem zu einem großflächigen Windpark umgestalten möchte, kann aufgrund naturgesetzlicher Schranken nicht nachhaltig funktionieren.
Für mich hört der erneuerbare Spaß auf, wenn Windturbinen bedrohlich nahe an Siedlungen errichtet, Abstandsregeln aufgrund des enormen Flächenverbrauchs immer mehr aufgeweicht und gesundheitliche Bedenken verharmlost werden. Darüber hinaus sind Windräder, die inmitten von Wäldern entstehen sollen, wegen der Beeinträchtigung, Störung und Beunruhigung örtlicher Biotope ökologisch als bedenklich einzuschätzen und daher abzulehnen. Wo bleibt denn bei solchen energiewirtschaftlichen Praktiken der Aufschrei des vermeintlich grün angestrichenen Zeitgeistes?
Die Schlüsselfrage in der Diskussion um die künftige Energieversorgung ist nach meinem Dafürhalten die friedliche Nutzung der Kernenergie. Aus heutiger und mehr noch künftiger mitteleuropäischer Sicht wird sich der nationale Ausstieg aus der Kerntechnologie als ein Fehler herausstellen. Er ist als eine hektische und unbegründete Reaktion auf das Reaktorunglück im japanischen Fukushima erfolgt. Dort sind durch einen Tsunami Notstromaggregate ausgefallen, wodurch nicht redundant ausgelegte Pumpen versagt haben. Das gegen eine Tsunami-Einwirkung anfällige Konstruktions- und Betriebskonzept des nuklearen Kraftwerkes mag ein sträflicher technologischer Leichtsinn gewesen sein. Die lokale Havarie ist jedoch kein Grund, eine leistungsfähige Kraftwerkssparte zu ächten, die zudem Energie erzeugt, die das globale Klima nicht belastet.
In unserem Land gibt es weder Tsunamis noch nennenswerte Erdbeben. Außerdem schließen die modernen Kraftwerkstechnologien Havarien wie seinerzeit in Japan aus. Die populistische Entscheidung, national aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie auszusteigen, war eine unnötige Verbeugung vor dem Druck grüner Ideologiepropaganda. Sie ist nach meinem Dafürhalten eine politische Kurzschlussreaktion gewesen und hatte mit technologischer Vernunft und energiewirtschaftlichem Sachverstand nichts zu tun. Wahrscheinlich sollte sie den Regierenden Wählerstimmen sichern.
Von Kritikern wird oft übersehen, dass die Kernkrafttechnologie in den letzten Jahrzehnten erheblich vorangeschritten ist. Inzwischen gibt es Kernreaktoren der vierten Generation, die sehr effizient arbeiten. Aufgrund des geringen Mengeneinsatzes an nuklearem Brennstoff erweist sich die Lagerung von Spaltprodukten auf dem Betriebsgelände zunehmend als eine realistische Option. Dadurch können Gefahrguttransporte reduziert, ja vielleicht sogar überflüssig gemacht werden. Darüber hinaus lassen sich inzwischen mithilfe von Transmutationsverfahren die Halbwertszeiten der verbleibenden Nukleotide signifikant verringern. Damit ließe sich zukünftig möglicherweise auch die Endlagerproblematik relativieren.
Neben den modernen nuklearen Kraftwerktechnologien stellt das sogenannte small modular reactor (SMR)-Konzept eine technologisch pfiffige Variante der friedlichen Nutzung der Kernkraft dar. Die in den USA erfundene technologische Lösung besteht aus Mini-Atomkraftwerken in modularer Bauweise, die überall anwendergerecht in Wasserbecken aufgestellt werden können. Die Reaktoren benötigen keine Bedienperson, gelten aufgrund ihrer geringen Größe als „durchschmelzungssicher“ und sollen ohne Entsorgungsprobleme abgewrackt werden können. Diese bemerkenswerte kerntechnische Innovation erfreut sich weltweit zunehmender Beliebtheit. Da die SMR-Technologie auch mit „erneuerbaren“ Energiekonzepten effizient kombiniert werden kann, soll sie sogar schon den einen oder anderen engagierten Klimaaktivisten überzeugt haben. Wer weiß, vielleicht wird das SMR-Konzept in 16 Jahren längst zu einer globalen Erfolgsgeschichte geworden sein?
Dagegen stammen die Feindbilder der ideologisch politisch „grün“ aufgestellten Gegner der friedlichen Nutzung der Kernkrafttechnologie überwiegend aus den letzten drei Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts. Aus dieser Zeit resultiert vor allem die Altlasten- und Endlagerproblematik. Doch angesichts der Fortschritte in der aktuellen Entwicklung moderner Kernspaltungstechnologien mutet die Kritik an deren friedlicher Nutzung heute etwas museal an.
Allerdings dürften die Menschen das globale Energieproblem erst gelöst haben, wenn sie in der Lage sein werden, die Kernfusionstechnologie zu beherrschen. Warum sollte es nicht gelingen, die Prozesse, die die Sonne seit Jahrmilliarden in ihrem Innern betreibt, trotz immenser technologischer Herausforderungen auch auf der Erde zu realisieren? Dazu bedarf es natürlich einiger Visionen. Verbote, Vorbehalte, Gängelei und Ignoranz sind auf einem so anspruchsvollen Weg in die energetische Zukunft nicht hilfreich. Sie werden sich eines Tages ganz gewiss als ein energiepolitischer Fehler erweisen!
Zum Glück gibt es, was die friedliche Nutzung der Kernkraft anbetrifft, in anderen Ländern keine derartig ideologisch begründeten Denk- und Innovationsverbote. Die Vorstellung, dass die Menschen eines Tages die Kernfusion technologisch beherrschen könnten, erfüllt mich mit Zuversicht und Hoffnung. Denjenigen, die stets nur vor den unwägbaren Risiken der Kernenergie und vor Super-GAU-Szenarien warnen, ist entgegenzuhalten, dass nach der Logik einer solch’ pessimistischen Philosophie der Mensch niemals hätte ein Feuer anzünden dürfen!
Wenn es in unserem Land nicht gelingt, die öffentliche Meinung von der Konkurrenzlosigkeit der friedlichen Nutzung der Kernenergie mit dem Fernziel Kernfusion zu überzeugen, wird Deutschland irgendwann mit Windturbinen zugestellt sein. Spätestens dann werden die Menschen hierzulande erschrocken feststellen, dass sie eigentlich in einem großflächigen Windpark leben und sich energietechnologisch in einer Art Steinzeitalter befinden. Matti, ich bin aber optimistisch, dass schon deine Generation die für mich unverständliche und unbegründete Ächtung der friedlichen Nutzung der Kernenergie auf den Prüfstand der energiepolitischen Vernunft stellen wird. Meine Zuversicht resultiert aus der Tatsache, dass im globalen energiepolitischen Mainstream die Kerntechnologie als unverzichtbar angesehen wird. Warum also sollte nicht eine nationale politische Fehlentscheidung, die künftigen Generationen intelligente energietechnologische Innovationen verbieten will, korrigiert werden können? Wenn man die naturwissenschaftlichen Fakten kritisch würdigt, kommt man zwangsläufig zu der Ansicht, dass die Energiewende aus naturgesetzlichen Gründen nur ein Weg in eine energiewirtschaftliche Sackgasse sein kann. Die Politik wird irgendwann zur Kenntnis nehmen müssen, dass sich auf die Dauer gegen naturgesetzliche Schranken keine vernünftige Politik gestalten lässt. Diese Erkenntnis mag heutzutage nicht für jedermann verständlich sein. Doch auf lange Sicht wird sie sich für die Gesellschaft als unvermeidlich erweisen. Dann dürfte die nationale Forschung auf dem Gebiet der Reaktortechnik jedoch längst den Anschluss an die internationale Entwicklung verloren haben.