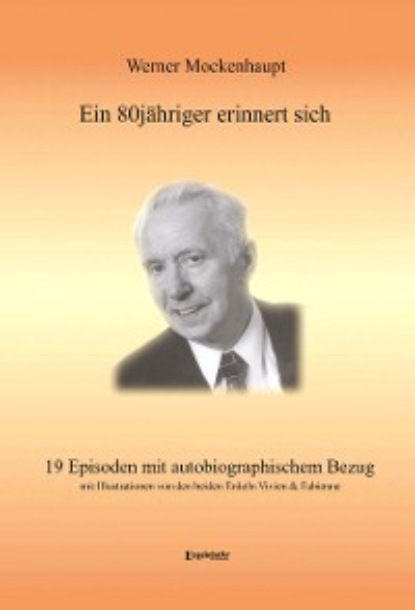- -
- 100%
- +

Werner Mockenhaupt
EIN 80JÄHRIGER
ERINNERT SICH
19 Episoden mit autobiographischem Bezug
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2014
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2014) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
ISBN 9783957440860
www.engelsdorfer-verlag.de
Cover
Titel
Impressum
Das Telefon und meine Erlebnisse
Jakob Jünkerath
Panzer vor der Haustüre
Weihnachten war anders
Vom Angeber zum Angsthasen
Das Hochwasser und seine Folgen
Als im Siegerland der 2. Weltkrieg zu Ende ging
Die erste Lehrstelle ging in die Brüche
Mein Freund der Afrikaner
Der kleine Supermarkt und meine Lieblingsoma
Der kranke Freund
Weihnachten mit Komplikationen
Plötzlich hatten wir es mit der Polizei zu tun
Der Enkel wird 17
Heute schon gelobt?
Miteinander im Gespräch bleiben
Der verlorene Schlittschuh
Türkische Erfahrungen
Der erste Tag im Ruhestand
Das Telefon und meine Erlebnisse
Ja, mit dem Telefon fing alles an, ich war sechs Jahre alt, als ich eines Mittags nach dem Schulunterricht im Büro meines Vaters einen neuartigen Apparat entdeckte. Mein Vater klärte mich auf und sagte: „Das ist ein Telefon“. Bis zu dieser Zeit hatte ich noch nie einen Fernsprechapparat gesehen. Wir wohnten in einem kleinen Ort und ich weiß noch, dass meine Mutter sehr stolz darauf war. Neun andere Bewohner im Dorf hatten schon diese Errungenschaft. Ich durfte nicht damit spielen, aber die Nummer 206 Freudenberg habe ich bis heute behalten. Dann kam der 2. Weltkrieg. Die Welt veränderte sich. Mein Vater wurde Soldat, und unser Telefon wurde abmontiert.
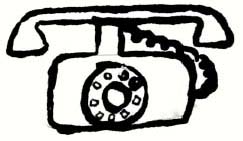
Sechs Jahre später kamen die amerikanischen Besatzungssoldaten, aber die benutzten ihre eigenen Fernsprechverbindungen. Sie funktionierten über sogenannten schwarzen Amidraht, welcher auch für viele andere Sachen zu gebrauchen war, z.B. zum Ziehen, Festbinden oder Verschließen von Gegenständen aller Art.
Erst 1949 kam ein Fachmann und installierte unsern Fernsprecher wieder an den alten Platz. Wir bekamen auch wieder unsere alte Telefonnummer.
Die Anrufe wurden zunächst zur Postzentrale weitergeleitet. Dort wurde das Gespräch von den dort sitzenden Telefonistinnen über Kabel umgestöpselt zu den gewünschten Teilnehmern. Die Telefonistinnen waren schon bald bekannte Persönlichkeiten, sozusagen die Fräuleins vom Amt. Die Poststelle lag nur zwei Minuten von uns entfernt. Da meine Mutter eine sehr gesellige Frau war, gingen die Damen der Post bei uns schon bald ein und aus. Besonders Lore und Erika saßen oft bei uns in der Küche und meine Mutter unterhielt alle. Ich weiß nur noch, dass viel gelacht wurde. Lore wurde auch bald meine Tante, denn als mein Onkel Robert aus der Gefangenschaft zurückkam hat er schon bald seine Lieblingstelefonistin geheiratet.
Kurze Zeit später habe ich mich beruflich nach Iserlohn verändert. Ich konnte mir auch dort noch kein eigenes Telefon leisten. Öfter ging ich dann zum dortigen Postamt. Dort konnte ich billig und komplikationslos mit meiner Mutter und meinen Freunden telefonieren. Erst als ich mich im Jahre 1960 selbstständig machte, habe ich mir ein eigenes Telefon zugelegt. Es musste neu angeschlossen werden, noch mit Kabel legen und Löcher bohren von innen und von außen. Leider stellte ich aber bald fest, dass Telefonieren auch Nachteile hatte. Es wurde viel schwadroniert und oft auch leeres Stroh gedroschen. Manchmal dachte ich an ein Plakat, auf dem stand: Fasse dich kurz.
Als junger, selbstständiger Konditormeister musste ich oft an drei Sachen zur gleichen Zeit denken. Oft sind mir während des Telefonierens Backbleche mit Gebäck schwarz geworden. Ab 1975 kam dann das Faxgerät dazu. Jetzt war es möglich, Nachrichten schriftlich auszutauschen, ohne langweilige, zeitintensive Sprechzeit zu vergeuden.
Schon ein Jahr später kam mein Sohn mit dem Vorschlag: „Du musst dir unbedingt ein Handy anschaffen.“ Er zählte mir all die vielen Vorteile auf, welche ich zusätzlich nutzen könne. Ich knallte ihm den typischen Kölner Spruch um die Ohren: „Kenne mer net, bruche mer net, fott domet.“ Aber damit war er nicht zufrieden.
„Du gehst nicht mit der Zeit; denn in drei Monaten sagen dann viele Freunde und Bekannte: ‚Der Mockenhaupt ist von gestern.’ „Babalapapp“, sagte ich, „ich brauche kein Handy, basta.“
Aber wie es das Schicksal wollte, schon einige Zeit später knickte ich ein. Spät abends auf der Autobahn hatte ich eine Wagenpanne. Bis zum nächsten Parkplatz schaffte ich es noch, aber dann machte der Motor keinen Mux mehr. Der kleine Waldparkplatz war schlecht beleuchtet. Außer mir war weit und breit kein Mensch zu sehen. Nach fünf Minuten war mir schon mulmig zu Mute. Aber ich hatte Glück. Nach einer halben Stunde steuerte ein großer Lastwagen genau auf diesen Parkplatz zu. Ich ging ihm sofort entgegen. Der stämmige Fahrer und seine Frau oder Freundin waren sehr freundlich. Die junge Frau kramte sofort ein Handy aus der Kabine und innerhalb von 20 Minuten stand schon der ADAC Werkstattwagen neben meinem Auto. Nach weiteren 20 Minuten war mein Wagen wieder flott. Schon eine Woche später hatte jetzt auch ich ein Handy.
Es muss im Jahre 1994 gewesen sein, da brauchte ich für eine größere Bestellung noch mehr Informationen. Der Verkäufer sagte mir am Telefon, es wäre am einfachsten und es ginge am schnellsten, wenn ich ihm meine Email-Adresse durchgeben würde. Ich zuckte zusammen, denn so etwas hatte ich nicht. Etwas arrogant und überheblich sagte ich: „Ich habe einen Briefkasten, ein Telefon und sogar noch ein Faxgerät“, und leise sagte ich noch vor mich hin: „Genug ist Genug.“
Mein Freund Gottfried unterstützte mich, und sagte: „Bei mir kommt das nicht mehr in Frage, ich bin jetzt 73 Jahre und mit dem Zeugs gebe ich mich nicht mehr ab.“ Aber der Computer verbreitete sich wie eine Seuche. Es gibt mittlerweile große und kleine, flache und ganz dünne. Die Möglichkeiten der Nutzung sind unabsehbar. Auch ich, der Senior, kam um den Kauf eines Computers nicht mehr herum. Es war zunächst die Neugierde, aber nach einiger Zeit leistete er mir gute Dienste. Briefe schreiben, Informationen suchen und finden, vor allen Dingen die Buchführung ging schneller. Leider übertreiben aber viele junge Leute die Möglichkeiten des Computers, sie sind sozusagen vom Computervirus befallen. Sie haben keine Zeit mehr Bücher zu lesen. Ich sehe sie vertieft in ihr Smartphone in stundenlangen Unterhaltungen in der Straßenbahn, im Café, im Auto, am Strand oder beim Spazierengehen. Sie sind dann für andere total abgemeldet.
Vor kurzem habe ich Hubert kennengelernt. Er arbeitet sozusagen in der Firmenhierarchie an zweiter Stelle. Er klagte über die allgemeine Hetze im Beruf. Der Druck sei überall sehr groß und würde immer stärker. Er erzählte von den vielen Emails, die noch nach Feierabend bei ihm reinkommen und ihn diese noch bis abends spät beschäftigten. Die Medien berichten über die vielen psychischen Krankheiten, die immer mehr zunehmen, weil man immer erreichbar ist.
Jetzt bin ich aus dem Berufsleben raus, deshalb ist für mich vieles nicht mehr nachvollziehbar. Aber interessanter Weise faszinieren mich in letzter Zeit die vielen Möglichkeiten des Computers immer mehr, und ich werde immer wissbegieriger. Dann erwische ich mich mit dem Wunsch, noch mal 30 Jahre jünger zu sein.
Jakob Jünkerath
Er war sieben Jahre älter als ich und für mich der beste Fußballer der Welt.
Ich bewunderte ihn schon als elfjähriger Pimpf, wenn ich ihm als Zuschauer auf dem Sportplatz zu jubelte. Schon als kleiner Straßenfußballer wollte ich so werden wie er. Wenn er als Mittelfeldspieler des Vereins „Adler 09 Niederfischbach“ und als Kopfballspezialist die Bälle haargenau servierte, das war nicht nur für mich, sondern auch für viele Beobachter, große Klasse.

Eines Tages fiel mir auf, dass Jakob Jünkerath nicht mehr zu sehen war. Ich suchte ihn auf den Dorfstraßen, fragte noch bei anderen, fußballbegeisterten Leuten, aber nichts, keiner wusste, wo er war. Jakob war wie vom Erdboden verschwunden. Wir Jungs konnten uns keinen Reim daraus machen.
Man schrieb das Jahr 1945, kurz vor Ende des 2. Weltkrieges. Anfang Januar tauchten zwei fremde Männer im Dorf auf. Sie trugen teure, schwarze Ledermäntel und machten meist ein strenges und wichtiges Gesicht.
Mein Freund Gottfried wurde von ihnen nach Jakob Jünkerath gefragt und viele andere auch, aber keiner wusste was. Allerdings hatte ich manchmal den Eindruck, dass manche Dorfbewohner untereinander flüsterten und tuschelten.
Nach drei Tagen waren die fremden Männer – Gott sei Dank – wieder verschwunden und wir Jungs hatten sie auch bald wieder vergessen.
Vier Monate später war der Krieg zu Ende.
Wir bestaunten die amerikanischen Soldaten, sie spielten auf der Straße Volleyball und waren zu uns Halbstarken sehr freundlich. Bald hörte ich auch wieder etwas von unserm Fußballverein. Und plötzlich, für mich ganz unverhofft, lief mein Idol Jakob wieder auf dem Platz und zauberte seine Kunststücke. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht bis in den letzten Winkel. Gleichzeitig wuchs die Spannung mit der Frage: Wo war er in den vergangenen vier Monaten gewesen? Wo hatte er sich aufgehalten?

Mein Opa hat mir das dann in Ruhe erklärt. Ich hing an seinen Lippen, ich wollte das nun ganz genau wissen. Jakob Jünkerath war ein Halbjude, (für mich war es damals noch ein neues Wort) deshalb war er auch zum Militärdienst nicht geeignet. Seine Mutter hat irgendwann gespürt, dass ihr einziger Sohn in großer Gefahr war. Von seinem Vater hatten sie schon seit fast drei Jahren nichts mehr gehört. Deshalb handelte die Mutter jetzt sofort. Unser Freund wurde also noch frühzeitig von zwei verschwiegenen Leuten auf einem zehn Kilometer entfernten, kleinen Bauernhof im hügeligen, bewaldeten Siegerland evakuiert und dort in einer Scheune vier Monate lang versteckt. Die Gestapo, das waren die Männer mit den Ledermäntel, haben Jakob jedenfalls nicht gefunden.
Noch Jahre später erzählten die Dorfbewohner von dem lebensgefährlichen Wagnis, welches die Bauersleute Christian und Mathilde auf sich genommen hatten, da sie ihn bis zum Kriegsende verborgen hielten. Mein Opa sprach dann immer von einer mutigen Tat.
Aber nun war Jakob wieder da. Er arbeitete in einer Blechwarenfabrik, wo Ofenrohre hergestellt wurden. Trotz der schlimmen Zeit ließ ihn der Fußball nicht los. Wieder standen wir Jungs an der Seitenauslinie des Sportplatzes und staunten über seine fußballerischen Fähigkeiten. 21mal konnte er mit dem Ball dribbeln, ohne dass das Leder den Boden berührte.
Bei ihm hatte ich einen Stein im Brett. Deshalb konnte ich ihn auch dazu bewegen, eine Schülermannschaft zu gründen. Er hat uns dann lange Zeit 14tägig betreut und trainiert. Das war ein großer Erfolg und wir waren alle sehr stolz.
Jakob Jünkerath blieb dem Verein und dem Ort noch viele Jahre eng verbunden. Sein Charakter und seine Persönlichkeit standen in hohem Ansehen. Er hat mir in schwieriger Zeit Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Durchhaltevermögen beigebracht. Wenn ich heute, nach 70 Jahren, meinen Heimatort besuche, denke ich sofort an Jakob Jünkerath, er hat mir in einer entscheidenden Lebensphase viel wertvolles Gedankengut mit auf den Weg gegeben.
Panzer vor der Haustüre
Er rumpelte über die Dorfstraße. Von weitem dröhnten die Panzerketten, welche sich rücksichtslos in die dünne Straßendecke eingruben. Als nach zehn Minuten das lärmende Ungetüm an mir vorbeizog, überkam mich ein ehrfürchtiges Staunen über dieses großartige Fahrzeug. Ich hatte in meinem dreizehnjährigen Leben schon viele verschiedene Waffengattungen gesehen und teilweise auch ausprobiert, aber dieses fauchende Ungetüm war absolute Spitze.

So etwas hatte ich in Natura noch nicht gesehen. Es war schon immer mein Wunsch, einmal einen richtigen Panzer zu sehen. Ich wollte in aber nicht nur sehen, ich wollte ihn riechen, fühlen und hören. Jetzt hatte ich die Gelegenheit, und ich nutzte sie mit allen Sinnen. Nun kam auch mein Freund Günter von der anderen Straßenseite und schrie mir ins Ohr: „Wo ist denn der Fahrer?“
Er hatte Recht. Das Monstrum wirkte wie ferngesteuert, wie von einem anderen Stern. Und der Panzer fuhr weiter und mittlerweile siebzehn Kinder liefen hinterher. Nach hundert Metern fuhr er langsamer, und dann blieb er stehen. Wir Kinder standen im Nieselregen und wollten wissen: „Was passiert jetzt?“ Und es passierte etwas. Die Klappe auf dem Turm ruckelte etwas und wurde dann von innen hoch gehoben.
Ein Soldat kam zum Vorschein, nach den Schulterstücken zu urteilen war es ein Feldwebel. Da kannten wir uns aus. Nun kletterte auch noch ein Unteroffizier aus der Luke. Die Soldaten untersuchten die Bodenbeschaffenheit in einer großen Mulde, welche direkt neben unserem Haus lag. Bisher hatte sich noch niemand für diese Senke interessiert. Jetzt aber hatte ich den Eindruck, dass dieses Stück Erde plötzlich ein sehr wichtiger Punkt war.
War es auch, denn der Unteroffizier kraxelte wieder in den Panzer und lenkte das große Fahrzeug mit viel Lärm und viel hin und her mitten in das große Loch. Ja, und dann stand der Panzer da. Wie aus Erz gegossen. Für mich und meinen Freund ein Anziehungspunkt erster Güte. Einmal durften wir sogar einen Blick vom Turm nach unten in das Innere des Fahrzeugs werfen.
Nach drei wunderschönen, sonnigen Tagen, im Frühjahr 1945 gab es plötzlich Unruhe in der Nachbarschaft. Mein Opa, meine Mutter, Tante Gertrud und noch andere Frauen trafen sich öfters bei uns im Keller.
Sie flüsterten untereinander mit ernsten Mienen, und manchmal sah ich, dass meine Mutter verweinte Augen hatte. Ich schnappte auch Wortfetzen auf: wie Panzer, Amerikaner, große Geschütze, Gefahr. Mitten in der Nacht weckte mich mein Bruder und meinte: „Es liegt was in der Luft.“ Ich hörte, wie Tante Gertrud unten im Haus mit einem schreienden Kind hin und her lief. Gleichzeitig vernahm ich einzelne, schwache Detonationen in weiter Ferne. Ich fand das alles nicht so sehr wichtig, drehte mich auf die andere Seite und schlief sofort wieder ein. Der Schreck am anderen Morgen war gewaltig. Der Panzer war weg, er war wirklich nicht mehr zu sehen. Ich sah nur noch die Spuren in dem Asphalt, und die waren dann in einer matschigen Nebenstraße verschwunden. Wir hatten schon keine Schule mehr, und was sollten wir nur mit dem ganzen Tag anfangen?
Drei Tage später, morgens um 11 Uhr, waren sie da, die amerikanischen Soldaten. Sie waren friedlich und schenkten uns weißes Brot. Einen Tag später kamen drei amerikanische Offiziere.
Sie inspizierten die Spuren des deutschen Panzers, machten Skizzen und befragten meine Mutter, die aber nichts verstehen konnte. Viel später erst habe ich verstanden welches Glück wir hatten, dass der große deutsche Panzer beizeiten das Weite gesucht hatte. Es wäre noch lange auf beiden Seiten geschossen worden, und es hätte sicher auch Tote und Verletzte gegeben, weil in der Nachbarschaft ja viele Kinder, Frauen und alte Leute lebten. Auch unser Haus hätte einige Treffer abbekommen. Alle Dorfbewohner waren der Meinung, dass eine göttliche Vorsehung uns wohl gesonnen war.
Weihnachten war anders
Es war kalt im Siegerland. Nicht nur die gestauten Gewässer, auch der Fluss und die Bäche waren zugefroren. Wir Jungen und Mädchen zwischen 14 und 16 Jahren konnten dort Schlittschuhlaufen und Fußball spielen. Auch die noch bleihaltigen Wasserleitungen im Haus mussten an den bekannten Stellen angewärmt werden, damit Mutter waschen und kochen konnte.

Aber viel größer war die Sorge um die 87 Fischbacher Männer, welche jetzt, Weihnachten 1943 in dem noch kälteren Russland im Einsatz waren. Vorige Woche erfuhren wir, dass viele aus unserem Dorf in Stalingrad an der Front waren. Es war genau diese Stadt in Russland, welche in offiziellen Wochenschauen von siegreichen deutschen Soldaten die Rede ist. Nur noch Tage, dann ist Stalingrad in deutscher Hand. So oder ähnliche Parolen wurden auch uns Schulkindern eingehämmert, und diese prägten sich in unsere Köpfe ein. Im nur noch knappen Schulunterricht wurde von Lehrer Finke die damalige Situation erklärt und erleuchtet, natürlich im Sinne der Nazis. In Wirklichkeit war alles anders. Einige aus dem Ort hatten den verbotenen englischen Radiosender abgehört und wir wussten daher, dass dort viele deutsche und russische Landser im eiskalten russischen Winter ihr Leben lassen mussten. Wir konnten uns nun vorstellen, dass dort jetzt in der Weihnachtszeit manche Träne floss und das Heimweh sehr groß war. Aber wir wussten nicht, ob noch alle gesund oder am Leben waren. Aus unserm Freundeskreis kannten wir drei junge Soldaten persönlich, Gerold Müller, Hermann Helbach und Hubert Schmidt. Viele schöne Gelände – und Ballspiele habe ich noch selbst mit ihnen erlebt. Aber jetzt hatten wir Angst dass ihnen etwas zustoßen könnte. Ich traf die Mutter von Gerold Müller, sie sagte: auch ich habe von Gerold seit acht Wochen nichts gehört, „und sie machte ein sehr sorgenvolles Gesicht. Wir wussten, dass unsere drei Freunde zähe Fischbacher Gewächse waren, mit Kälte konnten sie einigermaßen umgehen, aber längere Zeit ohne warme Stube und mit wenig Essen, das war für uns unvorstellbar. Wir waren unruhig, da wir so lange nichts von ihnen gehört hatten. Beim Abschied am Bahnhof vor einem Jahr waren alle guter Dinge und sie haben uns noch lachend nachgewunken. Hermann war groß und dünn, wir nannten ihn immer lange Latte. Hubert war zäh und ausdauernd, er hatte immer das beste Zeugnis. Gerold war ein gemütlicher, humorvoller Junge, er war für uns der Dicke.

Jetzt wollte auch noch die Gestapo wissen, wovon unser Pfarrer denn überhaupt lebt. Immerhin war dieser politisch vorbestraft und bekam deshalb kein staatliches Gehalt mehr. Mein Freund Toni wusste das alles ganz genau, denn sein Vater war der Kirchenrechner. Die gesamten Kollekten mussten auf Heller und Pfennig abgerechnet werden. Auf keinen Fall durfte für unsern Pastor etwas übrigbleiben. Nur die wenigen Kühe, Schweine und Hühner von der Bevölkerung haben unsern Pfarrer nicht verhungern lassen.
Am Weihnachtsabend lag eine gedrückte Stimmung über dem Dorf. Nur die Mitternachtsmette in unserem Siegerländer Dom war voll bis auf den letzten Platz.
Am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien kam Lehrer Erwin Finke wieder in SA-Uniform in die Klasse. Er war noch der einzige Lehrer im Unterrichtssystem. Alle andern waren Lehrerinnen oder Hilfskräfte. Wenn Finke dann in der pickfeinen Uniform vor der Klasse stand, hatten wir alle großen Respekt vor ihm. Wir schmetterten den „Heil Hitler Gruß“, dass dieser noch weit draußen zu hören war.
Aber er kam auch manchmal in Zivil in die Klasse. Er war klein hatte aber eine laute Stimme. Mein Freund Günter nannte ihn Glatzkopf, und er flüsterte mir ins Ohr "Erwin ist nur ein kleines Würstchen". Bald kamen in den offiziellen Nachrichten manchmal nicht nur gute Nachrichten ans Licht.
Die Stimmung fiel auf den Nullpunkt. Hinter mir saß Theo Preußer auf der Schulbank, er wollte anscheinend etwas ganz genau wissen. Seine Zischlaute lagen mir immer laut in den Ohren.
Ich merkte, dass Lehrer Finke ihn absichtlich nicht beachtete, aber die Zischelei ging ihm anscheinend doch auf die Nerven. „Preußer, was gibt’s“, fragte Herr Funke schlecht gelaunt. „Herr Lehrer, Stalingrad ist gefallen“, sagte mein Hintermann in einem etwas triumphierenden Ton. Alle lauerten.
Was passiert jetzt? Preußer hatte das geschafft, was noch keinem von uns gelungen war. Der Lehrer brauchte zwei Minuten bis er sich wieder gefangen hatte.
Für ihn war das sicher keine Neuigkeit, aber das der Schüler die schlechte Nachricht einfach so in der Klasse daher sagte, das wurmte ihn gewaltig. Aber dann ging es los, seine Stimme überschlug sich und die Lautstärke kam voll zur Geltung.
Diese Meldung dürfe auf keinen Fall in diesem negativen Ton vorgetragen werden, und der Führer würde trotzdem andere Siege aus Russland vermelden. Ab dem Zeitpunkt wurden die bisher guten Noten deutlich schlechter.
Eine Woche später kam unser Lehrer mit einem großen, neuen Bild ins Klassenzimmer. Dort war ein gefallener Soldat abgebildet, welcher noch im Tod die deutsche Fahne festhält. Darunter der Spruch: Die Fahne muss stehen, wenn der Mann auch fällt. Jedes Mal nach der letzten Schulstunde mussten wir diesen Spruch laut und deutlich wiederholen.
Der Krieg ging zu Ende. Meine Freunde Gerold Müller, Hermann Helbach und Hubert Selscheid kamen nicht mehr nach Hause.
Von Lehrer Finke haben wir nie mehr etwas gesehen und auch nichts mehr von ihm gehört.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.