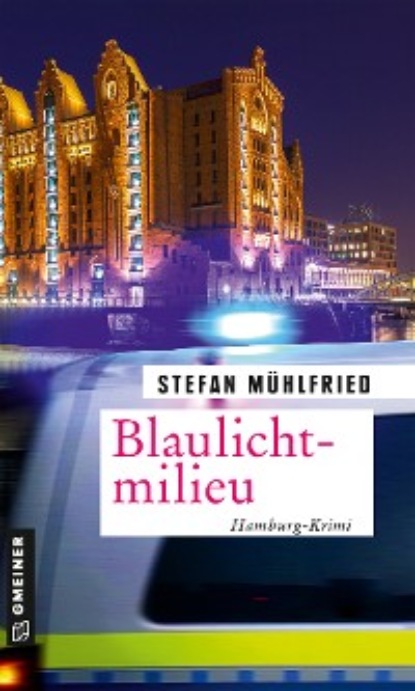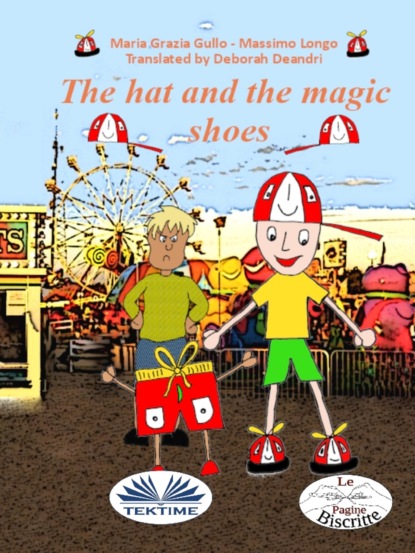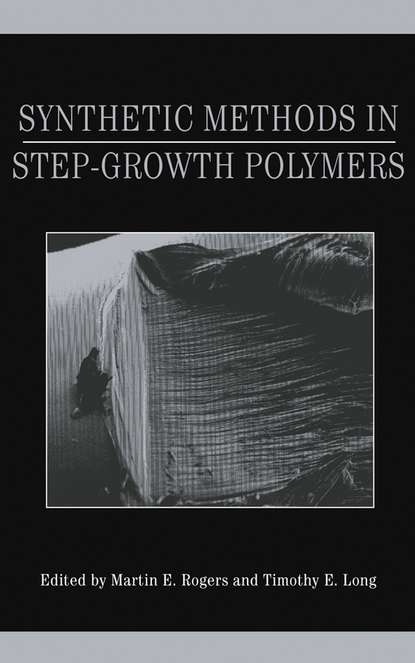- -
- 100%
- +
Marie mochte sie auf Anhieb.
»Zwar hat die Terrormiliz ›Islamischer Staat‹ über ihren Propagandadienst Amak verlauten lassen, sie sei für den Anschlag verantwortlich, aber wie üblich wurde kein Täterwissen offenbart und nur spärlich Informationen herausgegeben: ›Der Ausführer des Sprengstoffanschlags heute in Hamburg ist ein Soldat des Islamischen Staates. Er führte die Operation nach Aufrufen zum Angriff auf Angehörige der Koalitionsstaaten aus.‹ Das war alles.«
»Ist es nicht ohnehin so, dass der IS bereitwillig die Verantwortung für jeden Vorfall übernimmt, der nur im Entferntesten nach einem Anschlag aussieht?«, frage Kubicki.
Zander nickte. »Im Grunde schon. Wir verlassen uns lieber auf unsere eigenen Erkenntnisse, aber die sind dieses Mal ausgesprochen dünn. Für gewöhnlich liegen uns bereits geraume Zeit vor einer Tat zumindest vage Beobachtungen vor. Wenn diese sich weit genug eingrenzen lassen, dann können wir die Tat oft verhindern. Wir kennen unsere Szene, die linke wie die rechte, und wir bekommen jede größere Erschütterung mit. Aber dieses Mal – nichts. Nicht bei den Islamisten, nicht bei den Rechten, nicht bei den Linken. Sogar die Reichsbürger machen Ferien.«
»Für mich klingt das nach Einzeltäter«, sagte Harald.
Behrend, ein großer Mann mit strubbeligen schwarzen Haaren und einem dicken Schnauzbart, nickte.
Er erinnerte Marie an eine ältere Beamtenversion von Tom Selleck als Privatdetektiv Magnum. Nur nicht so gut aussehend.
»Ja«, bestätigte Behrend, »scheint so. Aber im Regelfall haben wir auch die einsamen Wölfe auf dem Radar, denn auf die eine oder andere Art und Weise sind sie alle vernetzt. Extremisten wollen Bestätigung, sie lieben ihre Filterblase, wie das neudeutsch so schön heißt. Wir dürfen zwar nicht alles mithören, doch die meisten kennen wir.«
»Ibrahim Kabaoglu?«, fragte Marie. »War der bei euch bekannt?«
Zander schüttelte den Kopf. »Eine makellos weiße Weste. Braver Staatsbürger und Steuerzahler, kein einziges Mal in einer der Moscheen aufgetaucht, die wir im Fokus haben.«
»Also sehr vorsichtig? Oder hat er wirklich eine weiße Weste?«
»Meine Liebe, wenn wir das wüssten, wären wir ein gutes Stück weiter.«
»Es spricht aber dennoch eine Menge gegen Kabaoglu«, sagte Behrend. »Ich meine, er hatte im wahrsten Sinne des Wortes die Hand an der Bombe, oder?«
Allgemeines Nicken.
»Gut«, sagte Arthur Thewes. »Wir haben einiges auf der Liste: Familie Kabaoglu muss noch heute vernommen werden, und ich möchte so schnell und so genau wie möglich wissen, was heute Morgen passiert ist, von den beteiligten Personen bis hin zur Bauart der Bombe, dem Explosionsradius und allem, das uns helfen kann, den Vorfall zu rekonstruieren. Ich brauche Aussagen von den eingesetzten Polizisten, Ärzten, Feuerwehrleuten, alles.«
»Wir übernehmen Familie Kabaoglu«, sagte Marie.
»Dann übernehmen die Evangelisten die Tatrekonstruktion. Einverstanden?«
»Evangelisten?«, fragte Kubicki.
»Johannes und Markus, vermute ich«, sagte Zander.
Kubicki schmunzelte.
»Ist dieser Boskop schon vernehmungsfähig?«, fragte Thewes.
»Nein«, antwortete Markus Schnittgereit. »Wir waren vorhin im Krankenhaus Boberg wegen ein paar anderer Aussagen. Es scheint ihm besser zu gehen als befürchtet, aber noch ist nichts zu machen.«
»Okay, aber bleibt dran. Mit Glück können wir den Sack zumachen, sobald wir seine Aussage haben.« Arthur stand auf. »Wenn ihr mich bitte entschuldigt.« Er sammelte seine Papiere ein und verließ den Raum.
Für Marie wirkte es wie eine Flucht, und die verwunderten Gesichter ihrer Kollegen zeigten, dass es ihnen ebenso ging.
Er saß vor seinem Fernseher, unfähig, sich zu bewegen. Sein ganzes Sein war von den Bildern eingenommen, die über den Bildschirm flackerten. Die restliche Welt hatte aufgehört zu existieren. Seine Hände waren taub, und die Kommentare aus den Lautsprechern drangen wie durch Watte zu ihm und verhallten in der Leere in seinem Inneren.
»… 17 Tote …«, hallte es ihm durch den Schädel. »… Bombe … Koffer … Flughafen …« Die Kamera schwenkte durch die Halle. »… Turkish Airlines … Zuckerfest …« Bilder in seinem Kopf. Die Mutter, wie sie ihn küsste. Die Schwester, die ihn umarmte. Der Vater, der ihn anlachte und an sich zog.
In dieser Halle. In dieser Trümmerwüste.
Die Kamera zoomte auf den zerstörten Check-in-Schalter. Genau dort. Genau dort hatten sie sich verabschiedet. Genau dort war nun eine riesige, halb eingetrocknete Blutlache.
Das Telefon klingelte, aber es drang nicht zu ihm durch. Wie aus weiter Ferne vermischte es sich mit den Klängen und den Bildern aus dem Fernseher. Er bemerkte es nicht, ebenso wenig wie die Tränen, die ihm über das Gesicht liefen.
Gereizt trommelte Tim mit den Fingern auf die Armlehne des Sofas. Ihre Arbeit am Flughafen war beendet, alle Fahrzeuge wieder an der Wache, die Besatzungen aus dem Einsatz entlassen, aber Tim und viele andere waren noch geblieben. Das half, das Adrenalin herunterzufahren. Je nach Einsatz und Kollegen wurde mal mehr, mal weniger geredet. Auch das half, mit dem Erlebten fertig zu werden. Sie alle waren darauf trainiert, die furchtbaren Bilder nicht allzu nahe an sich heranzulassen, doch manchmal konnten selbst sie sich ihnen nicht entziehen. Niemand kannte das besser als die Kollegen, und niemand war besser geeignet, darüber zu reden. Oder zu schweigen.
Heute sahen sie die meiste Zeit die Berichterstattung über den Anschlag im Fernsehen an. Die Fakten waren offensichtlich, aber wenn Tim in seiner Zeit als Notfallsanitäter und Feuerwehrmann eines über die Presse gelernt hatte, dann das: Fakten reichten nicht. Nicht für die Nachrichten und erst recht nicht für die Boulevardpresse. Schon am Flughafen hatte an jedem Absperrband ein Reporter gestanden, das pflichtbewusst erschütterte Gesicht der Kamera zugewandt, und mit großem Ernst haltlose Mutmaßungen verkündet.
»Gut, dass die Polizei wenigstens schnell geschaltet und keinen von den Affen in die Halle gelassen hat«, sagte Tim. »Wären die uns auch noch über die Füße gelaufen, ich glaube, ich wäre ausgerastet.«
»Und was ist das?«, fragte einer der Jungs vom Löschzug und deutete auf den Fernseher. Das Bild war grob und wackelte heftig, aber es zeigte unverkennbar Tim, Mark und die langhaarige LNA bei der Wiederbelebung.
»Na super«, sagte Mark. »Das werden wir bis morgen alle zehn Minuten auf jedem Kanal sehen.«
Tim seufzte. »Geschafft hat’s der arme Kerl trotzdem nicht.«
»Wo, um Himmels willen, stand die Kamera?«
»Auf dem Löschfahrzeug.«
»Seid ihr bescheuert, den da raufzulassen?«
»Haben wir nicht. Der ist heimlich raufgeklettert, und wir haben ihn erst nach ein paar Minuten entdeckt. Jörg wollte ihn eigentlich mit dem C-Rohr runterpusten.«
Alle lachten.
Der Sprecher unterlegte die eingespielten Bilder mit Kommentaren, die aus den bekannten und hundertmal wiederholten Fakten gespeist und mit Spekulationen und Allgemeinplätzen aufgefüllt waren. »Der Ort der Explosion lag im vorderen rechten Teil der Halle«, sagte er. »Die Detonation war so heftig, dass das komplette Terminal verwüstet wurde. Es muss befürchtet werden, dass im Umkreis von vielen Metern niemand diese Explosion überlebt hat. Offizielle Zahlen gibt es noch nicht, aber unseren Informationen nach beträgt die Zahl der Todesopfer bis zu 20.«
»Stimmt gar nicht«, sagte Lars, der an diesem Morgen einer der ersten vor Ort gewesen war. »Der eine Typ, der war genau da, wo’s geknallt hat. Oder, Clemens?«
Sein Partner nickte. »Hat am Anfang noch vor sich hingebrabbelt. Sowas wie ›Das hätte nicht passieren dürfen‹.«
Tim nickte. »Ja, den haben wir später versorgt. Sah ziemlich finster aus.«
»Hat er euch denn überlebt?«
»Knapp. Ist als einer der ersten nach Boberg.«
»Da hatte er Glück. Die Verbrennungsbetten dürften in Nullkommanichts ausverkauft gewesen sein.«
Tim schnaubte. »Wer die Betten braucht, hatte per Definition kein Glück.«
»Aber er hat eine Chance.«
Tim schwieg.
»Hab ich schon wieder was Falsches gesagt?«
»Was hat der Mann mit ›Das hätte nicht passieren dürfen‹ gemeint?«
»Ist doch egal. Der war völlig durch den Wind. Keine Ahnung, was ich in so einer Situation sagen würde.«
»Du würdest wahrscheinlich Mark einen Heiratsantrag machen.«
Alle lachten, und Tim mit ihnen. Jetzt war nicht die Zeit zum Grübeln. Aber es nagte an ihm. Irgendetwas passte nicht, doch er kam nicht darauf, was.
In der Moschee waren sie nicht. Nicht im Gebetsraum, nicht in den Gemeinschaftsräumen, nicht im Waschraum.
Nervös streifte er durch die Gänge, öffnete jede Tür, sah in jedem Raum nach. Der Imam grüßte ihn, er grüßte flüchtig zurück, den Blick schon wieder woanders. Keiner von ihnen war da. Hatten sie ihn im Stich gelassen? Hatten sie ihn die Drecksarbeit machen lassen und waren dann verschwunden?
Es war Zeit für das Nachmittagsgebet. Er wünschte sich die Nähe des Barmherzigen. Also wusch er sich, ging in den Gebetsraum, richtete sich nach Mekka aus und hob die Hände. »Allahu akbar …«
Er betete, wie es vorgeschrieben war, aber sein Herz und seine Gedanken waren nicht bei der Sache. Die Erleichterung und die Ruhe im Geist, die er sich vom Gebet erhofft hatte, stellten sich nicht ein. Wie auch? Warum sollte Allah einem Sünder wie ihm Frieden schenken? Einem Mann, der all die getötet hatte, die ihm vom Höchsten zum Schutz befohlen waren – die eigene Familie?
Oder prüfte Allah ihn? Stellte er seine Glaubensfestigkeit auf die Probe mit dem höchsten Opfer, das ein Mann seinem Gott darbringen konnte? War es gar gerechtfertigt, die Familie zu opfern, um möglichst vielen Ungläubigen den Tod zu bringen? Hatte er sie Allahs Gnade als Märtyrer anempfohlen und ihnen einen Platz im Paradies verschafft?
Seine Brüder würden Rat wissen. Wo waren sie?
Er ging vor die Tür, suchte sich eine unbeobachtete Ecke und zog das Smartphone heraus. Zwar war es verboten, andere Mitglieder der Gruppe anzurufen – zu groß die Gefahr, dass eines ihrer Telefone den Ungläubigen in die Hände fiel –, aber das war ihm egal. Er musste Gewissheit haben.
Es klingelte und klingelte, dann sprang die Mailbox an und erklärte mit elektronischer Stimme, der Teilnehmer sei zurzeit nicht erreichbar. Er versuchte es ein zweites und drittes Mal, bevor er es aufgab. Eine Nachricht hinterließ er nicht.
Frustriert steckte er das Smartphone weg und machte sich auf den Heimweg. Er war noch nicht weit gekommen, als es in seiner Tasche vibrierte. Der verschlüsselte Messenger, mit dem sie kommunizierten, zeigte eine neue Nachricht an. Hastig öffnete er sie.
»Nicht anrufen«, stand dort, darunter eine Adresse, die er nicht kannte, und eine Uhrzeit.
Eine Stunde. Dann würde sich alles aufklären.
Sein Blick fiel auf die Benachrichtigungsleiste. Ein Anruf in Abwesenheit.
Er tippte auf die Nachricht, die Nummer wurde angezeigt, und seine Welt drehte sich schlagartig in eine andere Richtung.
Es war die Nummer seiner Schwester.
Kapitel 3
21. Mai
»Da«, sagte Harald, »Nummer 15. Fahr rechts ran.«
Es war später Vormittag und die meisten Anwohner waren bei der Arbeit. Die Erwerbslosenquote war hoch in Wilhelmsburg, aber es blieben genügend automobile Arbeitnehmer, um bequem einen freien Parkplatz in der Nähe des Hauses zu finden.
Marie und Harald stiegen aus dem BMW und gingen zum Eingang eines der typisch hamburgischen Wohnblöcke, vierstöckig und dunkelrot verklinkert. Auf der anderen Straßenseite standen keine Häuser, hier erhob sich sieben oder acht Meter hoch der Elbdeich.
Marie überlegte, ob man vom oberen Geschoss der Häuser aus das Wasser sehen konnte. Anderswo in Hamburg würde man für diese Lage am Ufer der Elbe horrende Mieten bezahlen, aber nicht hier auf der Veddel, einem der klassischen Arbeiterviertel Hamburgs. Noch nicht. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor gewiefte Immobilienspekulanten die Häuser aufkauften, grundsanierten und die alteingesessenen Multikulti-Einwohner gegen schicke junge Leute austauschten, die es hip fanden, in ein heruntergekommenes Viertel zu ziehen. Natürlich in Luxuswohnungen. »Gentrifizierung« hieß das, wenn sie sich recht erinnerte. Ein Prozess, der schon einige Stadtviertel vom authentischen Kiez zur Yuppie-Hochburg verwandelt hatte: Sankt Pauli, die Schanze, Ottensen … Lange würde es nicht mehr dauern, bis Wilhelmsburg dran war. Ging vielleicht schon los, wer weiß.
Harald studierte die Klingeltafel. »Kabaoglu, hier. Mann, haben die eine Sauklaue!« Er drückte den Knopf, und sie hörten weiter oben eine altmodische Türklingel schnarren.
Marie lehnte sich gegen die Tür und wartete auf den Summer.
Stattdessen wurde über ihnen ein Fenster geöffnet. »Ja bitte?«, fragte eine jung klingende Frauenstimme.
Sie traten einige Schritte zurück und blinzelten nach oben. Eine dunkelhaarige Frau Mitte 20 lehnte aus dem Fenster im zweiten Stock.
»Guten Tag, mein Name ist Marie Schwartz, und das ist mein Kollege Harald Grossmann. Können wir bitte Frau Kabaoglu sprechen?«
»Sind Sie Journalisten?«
»Nein.« Marie hielt ihre Dienstmarke hoch. Sie wollte vermeiden, das Wort »Polizei« laut nach oben zu rufen. Das brachte nur unerwünschte Aufmerksamkeit, speziell in Vierteln wie diesem.
Die junge Frau im Fenster nickte. »Kommen Sie rein, die Tür ist nicht verschlossen. Zweiter Stock links.«
Im Treppenhaus roch es nach Kohl, feuchten Wänden und exotischen Gewürzen. Der Handlauf war abgegriffen, die Wände schmutzig und von den Fenstern blätterte die Farbe ab. Umso überraschter war Marie, als die junge Frau die Wohnungstür öffnete und sie in ein blitzsauberes, wenn auch kitschiges Wohnparadies einließ. Auf den alten Bodendielen lagen kunstvoll geknüpfte orientalische Teppiche, die Wände waren mit einer dicken Stofftapete versehen, die obendrein glitzerte. Davor hingen Bilderrahmen mit Familienfotos und ein Spiegel mit einem breiten goldenen Rand in nachgemachtem Barockstil.
Aus dem Wohnzimmer klang ein aufgeregtes Durcheinander von Frauenstimmen bis in den Flur. »Haben Sie Besuch?«, fragte Marie.
Die junge Frau nickte und lächelte flüchtig. »Das sind Trauergäste«, sagte sie in akzentfreiem Deutsch. »Sie waren noch bei keinem türkischen Trauerfall, oder?« Sie war ausgesprochen hübsch, mit einem schwarzen Pferdeschwanz, hohen Wangenknochen und mandelförmigen dunklen Augen, denen man ansah, dass sie geweint hatte.
Marie lächelte verlegen. »Da haben Sie recht. Bitte verzeihen Sie uns, wenn wir uns mit Ihren Bräuchen nicht gut auskennen.«
Die junge Frau winkte ab. »Sie sind von der Polizei?«
»Ja«, sagte Marie und hielt ihr den Dienstausweis hin. »Ich bin Kriminaloberkommissarin Marie Schwartz, das ist Kriminalhauptkommissar Harald Grossmann. Dürfte ich fragen, wer Sie sind?«
»Şahika Kabaoglu. Mein Vater …« Sie schluckte schwer. »Entschuldigen Sie.« Sie zog ein Taschentuch aus der Jeans und putzte sich die Nase.
Marie nickte ihr freundlich zu. »Da gibt es nichts zu entschuldigen. Ihr Verlust tut mir sehr leid.« Sie hasste das Wort »Beileid« und die ganzen abgedroschenen Phrasen, aber sie wusste, dass alles, was sie sagte, lahm klingen musste.
»Danke«, sagte Şahika Kabaoglu. »Sie möchten sicher mit meiner Mutter sprechen, oder?«
»Wenn wir korrekt informiert sind, waren Sie beide am Flughafen. In diesem Fall würden wir gerne Sie beide sprechen«, antwortete Harald.
»Natürlich. Kommen Sie herein.« Sie ging voran ins Wohnzimmer, wo vier Frauen um den Couchtisch saßen.
Die Gespräche verstummten, als Marie und Harald den Raum betraten. Şahika Kabaoglu stellte sie kurz auf Türkisch vor; Marie verstand nur das Wort »Polis«. Kaum war es gefallen, da sprangen alle Frauen bis auf eine vom Sofa auf. Eine bot ihnen die frei gewordenen Plätze an, die beiden anderen liefen in die Küche und kamen gleich darauf mit Tee, Kaffee und Keksen zurück. Wortreich, halb auf Deutsch, halb auf Türkisch, nötigten sie Marie und Harald, sich zu setzen. Marie sah Hilfe suchend zu Şahika, die sich zu ihr beugte.
»Wir alle haben große Hoffnung, dass Sie denjenigen finden, der meinem Vater das angetan hat.«
»Das haben wir vor, das versichere ich Ihnen.«
Şahika Kabaoglu stellte sie ihrer Mutter vor, die neben ihnen auf dem Sofa saß. Sie war Anfang 60, hatte eine stämmige Statur, eine gepflegte Hochsteckfrisur und trug dunkle Trauerkleidung.
»Wollen Sie Kaffee«, fragte Mutter Kabaoglu mit einem mittelmäßig starken Akzent, »oder Tee?«
»Vielen Dank, ich –«
Harald fiel Marie ins Wort. »Tee, bitte. Für uns beide. Vielen Dank.«
Die Tochter goss ihnen ein und schob den Teller mit Keksen herüber. Dann nahm sie gegenüber auf der Vorderkante eines Sessels Platz.
»Frau Kabaoglu«, sagte Marie, »wir würden mit Ihnen und Ihrer Tochter gerne über das sprechen, was gestern auf dem Flughafen passiert ist. Ich verstehe, dass das alles noch sehr frisch und erschreckend für Sie ist. Trotzdem ist es leider notwendig, Sie jetzt schon zu befragen.«
Frau Kabaoglu nickte tapfer. »Ist wichtig, dass Sie alles wissen, damit Sie finden können den, der mein Mann getötet hat. Ich helfe Ihnen.«
»Vielen Dank. Ich –«
»Er war ein guter Mann. Ganz fleißig. Ist schon in der Nacht zu Großmarkt gefahren und hat Ware gekauft, jeden Tag. Immer gute Ware, immer frisch. Kunden waren immer zufrieden. Alle haben gerne gekauft bei uns. Immer freundlich zu den Kunden. Immer viel gearbeitet, damit Şahika und Altay gute Ausbildung bekommen. ›Wir sind doch jetzt Deutsche‹, hat er immer gesagt, und für deutsche Kinder ist Ausbildung wichtig. Noch wichtiger als für türkische Kinder.«
»Ihr Mann hat sich als Deutscher gefühlt?«
»Halb und halb. Ja, hat er gesagt, wir sind als Türken geboren, und wir gehen zu Allah als Türken, aber wir sind in Deutschland, und Deutschland ist gut zu uns, also wollen wir auch Deutsche sein. Er hatte viele deutsche Freunde.« Sie seufzte und hob die Arme. »Und wo sind sie alle? Keiner von ihnen kommt.«
»Ana, das ist anders hier in Deutschland«, sagte Şahika. »Die Deutschen kommen nicht zu Leuten, die trauern, weil sie Angst haben, zu stören.«
»Wirklich?« Frau Kabaoglu sah Marie entgeistert an, die zustimmend nickte. »Das ist doch dumm! Wer traurig ist, der braucht Freunde!« Sie hielt erschrocken die Hand vor den Mund. »Oh, das war schlecht gesagt. Ich wollte nicht sagen, dass Sie dumm sind.«
»Natürlich nicht.« Harald lächelte. »Wir sind ja hier.«
Frau Kabaoglu lachte leise und legte ihm und Marie die Hand auf den Arm. »Sie sind gute Menschen. Sie werden helfen zu finden den Mörder von meinem Ibrahim.«
Marie hatte einen Kloß im Hals. »Frau Kabaoglu, bitte erzählen Sie mir, wie der gestrige Morgen abgelaufen ist.«
Die Witwe nickte. »Wir sind ganz früh aufgestanden, weil Ibrahim sagte, wir müssen unbedingt zwei Stunden vorher an Flughafen sein.«
»Wann waren Sie am Flughafen?«
»20 nach sieben. Ich weiß noch genau, weil Ibrahim so froh war, dass alles gut geklappt hat. Altay hat uns gebracht mit Auto.«
»Wollte Altay nicht mit in die Türkei?«
Şahika schüttelte den Kopf. »Er arbeitet im Mercedes-Werk in Harburg, und er hat leider keinen Urlaub bekommen.«
»Weswegen wollten Sie in die Türkei? Wegen des Zuckerfestes?«
»Nein, mein Cousin wollte morgen heiraten.« Şahika seufzte tief. »Das ist natürlich abgesagt. Die ganze Familie ist völlig fertig.«
»Wo genau hat Ihr Bruder Sie abgesetzt?«
»Direkt vor dem Terminal. Vor der Abflugebene gibt es einen Parkstreifen, da hat er den Wagen abgestellt und ist noch kurz mit uns rein, um mit dem Gepäck zu helfen.«
»Heißt das, Ihr Bruder war in der Halle, als die Explosion stattfand?«
»Das haben wir am Anfang gedacht, aber wir haben ihn nicht gefunden. Irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, nach dem Auto zu sehen, und das war weg. Wir haben bis zum Schluss gehofft, dass mein Vater mit ihm gefahren ist.« Sie lachte trocken. »Völlig blöde Idee. Warum sollte er mit Altay wegfahren? Aber man klammert sich an jeden Strohhalm. Tja.« Sie drehte sich weg und suchte nach einem Taschentuch.
Marie wandte sich der Mutter zu, die zwar zu ihrer Tochter sah, doch offensichtlich tief in Gedanken versunken war. »Frau Kabaoglu?«
Sie schreckte auf. »Ja?«
»Sind Sie direkt in die Halle gegangen, nachdem sie aus dem Auto gestiegen sind?«
»Ja. Ibrahim raucht nicht mehr. Vor zwei Jahren hätten wir noch draußen stehen bleiben müssen.« Sie lachte leise und fing dann unvermittelt an zu weinen.
Marie machte ihren Platz auf dem Sofa frei, damit Şahika sich neben ihre Mutter setzen und sie trösten konnte. Sie ließ sich auf einem Sessel gegenüber nieder. »Was geschah danach?«, fragte sie.
Şahika hob den Kopf. »Wir sind direkt zum Check-in gegangen. Die Schlange war mächtig lang, und mein Vater hatte Panik, dass wir nicht rechtzeitig am Gate sein könnten. Na ja, und da haben wir erst einmal ein paar Minuten gestanden.«
»War Ihr Bruder dabei?«
»Ja, er wollte noch etwas bleiben, um meinen Vater zu beruhigen.«
»Beruhigen?«
»Dass es klappt mit dem Check-in und dass wir genug Zeit haben. Aber ich glaube, Altay war knapp dran, er wurde immer nervöser und schaute dauernd auf die Uhr.«
Marie und Harald tauschten einen raschen Blick aus. »Wie ging es weiter?«, fragte Marie.
»Dann sind wir alle auf die Toilette, ich und meine Mutter, und ein paar Minuten später mein Vater. Er meinte, wir sollten ausnutzen, dass Altay noch da ist und auf das Gepäck aufpassen kann.«
»Wie lange hat das in etwa gedauert?«
»Es war eine ziemliche Schlange vor dem Damenklo. Eine Viertelstunde bestimmt. Aber ich verstehe nicht …«
»Wir müssen den Ablauf der Tat so genau wie möglich rekonstruieren, wie bei einem Puzzle. Jedes kleinste Teil kann wichtig sein.«
»Na gut. Als wir fertig waren, haben wir nach meinem Vater geschaut. Weil er nicht mehr bei den Toiletten war, sind wir davon ausgegangen, dass er bereits zu Altay zurückgekehrt ist, und wollten zurück zum Check-in. Wir waren noch im Vorraum der Toilette, als es auf einmal krachte.«
»Sie haben die Explosion also nicht selbst gesehen?«
»Nein, zum Glück nicht. Aber es war auch so schrecklich genug.«
Frau Kabaoglu hob den Kopf von der Schulter ihrer Tochter. »Ja, schrecklich. Wir sind gleich raus in Halle und haben gerufen: Ibrahim, Ibrahim, Altay, Altay. Aber keine Antwort. War gar nicht laut nach Explosion. Ganz schrecklich, wie leise das war. Ibrahim hätte uns gehört, wenn er …« Sie vergrub ihren Kopf wieder an der Schulter ihrer Tochter.
Şahika sprang ein. »Wir wollten dorthin, wo wir meinen Bruder und das Gepäck zurückgelassen hatten, doch da war totales Chaos. Wir haben nach meinem Vater gesucht, aber wir konnten ihn nicht finden. Und irgendwann hat uns die Polizei fortgeschickt. Da waren überall Rauch und Feuer und Trümmer und Blut. Und Menschen lagen da. Manche haben sich noch bewegt oder geschrien, aber die meisten … Ich wollte auch nicht, dass meine Mutter meinen Vater so sieht.«
Marie nickte. »Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen an dem Morgen?«
Şahika lachte trocken. »Sie meinen, außer dass der Flughafen in die Luft geflogen ist?«
»Haben Sie jemanden beobachtet, der sich auffällig verhalten hat? Vielleicht jemanden, der besonders nervös war oder der unpassend wirkte?«
»In ein paar Tagen ist das Zuckerfest. Halb Deutsch-Anatolien war am Flughafen. Die waren alle genauso nervös wie mein Vater, und praktisch keiner von denen wirkte passend dort.«
»Frau Kabaoglu? Ist Ihnen am Flughafen etwas Besonderes aufgefallen?«
Die Mutter hob den Kopf und schüttelte ihn. »Nein, gar nicht. War ich doch selber so aufgeregt, habe ich gar nicht auf andere geachtet.«
»Das kann ich verstehen. Ich glaube, das ist für heute genug. Wir werden Sie sicher noch einige Male befragen, aber im Moment möchte ich Sie nicht zu sehr belasten.« Sie zog zwei Visitenkarten heraus und gab sie Mutter und Tochter Kabaoglu. »Wenn Ihnen etwas einfällt oder Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an. Auf der Karte steht auch meine Mobilfunknummer, unter der können Sie mich Tag und Nacht erreichen.«