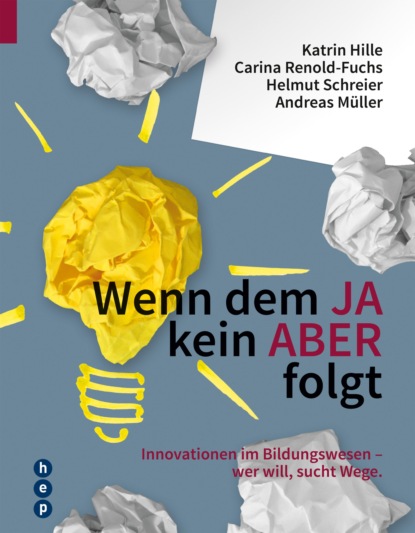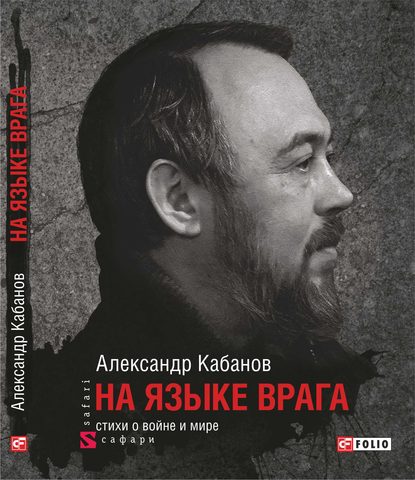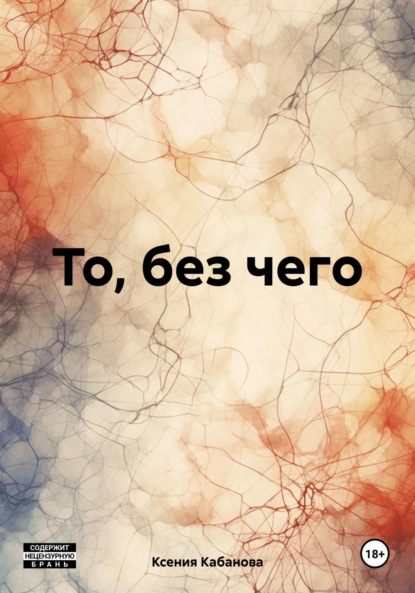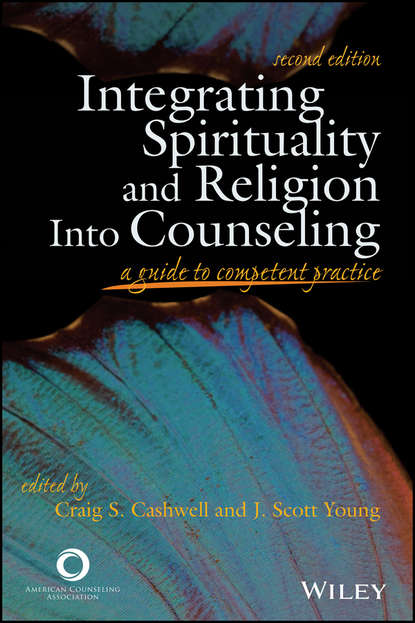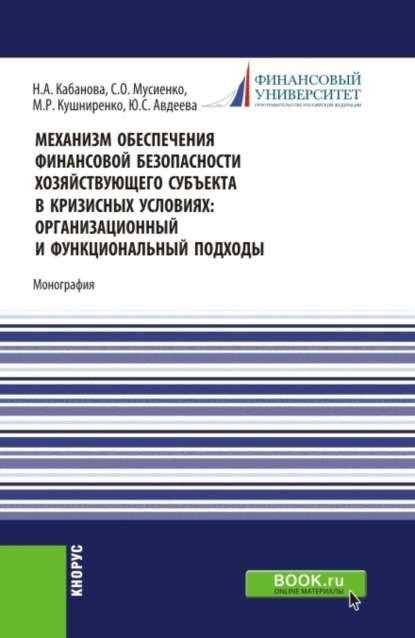- -
- 100%
- +
Natürlich ist das nicht die Lösung des Problems. Es geht um die Herstellung einer Schulgemeinschaft, die von der Norm des Normalen abweichende Kinder willkommen heisst, weil sie den der Vielfalt innewohnenden Reichtum aufzuschliessen versteht.
Leitbilder: Beispiel für den Umgang mit Visionen
Antje erinnert die Eltern am ersten Elternabend, auf Merkblättern und beim Auftritt der Schule im Internet (www.lindenhofschule-brensbach.de) an die rechtlichen Grundlagen eines Bildungsauftrags, der laut Artikel 56, Abs. 1 des Hessischen Schulgesetzes über das unterrichtliche Lernen hinausgeht:
«Der hier festgelegte Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule ist auf bestmögliche Entfaltung der Persönlichkeit der Mädchen und Jungen gerichtet und schliesst die Sorge um ihr körperliches und seelisches Wohl mit ein. Die Grundschule hat insoweit auch sozialpädagogische Aufgaben.»
Sie zählt die Kinderrechte auf und schreibt, dass «Kinder unterschiedlich schnell und weit sein dürfen», dass Lernen aktiv sein bedeutet und die Fähigkeit einschliesst, Verknüpfungen herzustellen und eigene Stärken und Kompetenzen erkennen und aufbauen zu können. Sie erklärt, dass die Rolle der Lehrkraft darin besteht, «ein Feuer zu entfachen, und nicht darin, einen leeren Eimer zu füllen», und dass «wissenschaftliches Denken nicht aus der Position des Wissens hervorgeht, sondern aus der Position der Suche nach Wissen.»
«Kinder dürfen
unterschiedlich schnell
und weit sein.»
Sie schlägt den Eltern zu Schulbeginn vor, auf welche Weise sie ihr Kind unterstützen können, von «Sie können ihr Kind stärken, indem sie ihm etwas zutrauen» bis «Legen Sie gemeinsam Regeln fest für das Erledigen der Hausaufgaben».
In der Anfangsphase, noch vor Übernahme der neuen Schulleitung, war in Brensbach ein professionell begleiteter Prozess der Schulentwicklung eingeleitet worden, der mit der Suche nach dem besonderen Sinn des Unternehmens dieser Schule begonnen hatte, und bald von den Lehrerinnen selbstständig weiter getrieben wurde. «Sonne im Herzen» sollte das Motto sein, und unter dieser Leitvorstellung wurde von ihnen gemeinsam mit der neuen Schulleiterin ein Logo gefunden, ein herzförmiges Lindenblatt mit fünf Hauptadern:

leben – Wir leben in einer offenen und vielfältigen Schule. Jeder ist wichtig.
fördern – Wir fördern kompetenzorientierten Unterricht.
bewegen – Wir bewegen uns und sind handlungsorientiert.
geben – Wir geben Schutz und Stärke.
lernen – Wir lernen miteinander und voneinander in einer freundlichen Atmosphäre.
clear
Absichten, Wörter: Wenn es nicht das Beispiel der Grundschule Beerfurth gäbe, wären sie bloss leere Vorstellungen. Die Erfahrung, dass die Vision einer Schulgemeinschaft auf die Wirklichkeit der Verhältnisse übertragen und umgesetzt werden kann, macht den Vorgang erst verfügbar. Was im Raum A intuitiv gelang und sukzessiv aufgebaut worden ist, wird auf Raum B absichtlich und planvoll angewandt. Dies ist aussichtsreich, selbst dann, wenn es in einzelnen Aspekten nicht auf Anhieb gelingen sollte: Der Vergleich macht es möglich, einzelne Punkte eines Pakets zu isolieren und zu bearbeiten, dessen Umfang sonst Demotivation auslösen müsste. Und der Erhalt der Motivation ist womöglich die knappste Ressource in dem ganzen Geschäft von Schule und Unterricht.
Antje erzählt, wie sie die Rahmenbedingungen des Unterrichts umgestaltet hat: Vertretungsstunden werden nicht mehr unvergütet erwartet. (Das Problem besteht darin, dass in einer Situation, in der die Leute unzufrieden sind, auch die Krankheitszeiten und Fehltage steigen, die durch Vertretungsunterricht von Kollegen ersetzt werden müssen, was wiederum deren Unzufriedenheit auslöst.) In Hessen ist es gesetzlich geregelt, Vertretungsunterricht über sogenannte VSS Mittel (verlässliche Schule) zu finanzieren und damit nicht zusätzlich das Kollegium zu belasten. Man kann und sollte diese Möglichkeit im Interesse der Kolleginnen abrufen, wobei allerdings entsprechend vorgebildete Vertretungskräfte zur Verfügung stehen müssen, was im ländlichen Raum jedoch teilweise viel Kommunikations- wie auch Organisationstalent voraussetzt.
Zur Zeit ist sie mit der Einrichtung einer eigenen kleinen Küche für die Lehrerinnen befasst, – gegen einen amtlichen Widerstand, mit dem sie inzwischen umzugehen versteht. «Eine Küche, in der man Kaffee kochen und kleine Snacks zubereiten kann, wird die Zufriedenheit der Kolleginnen mit ihrem Arbeitsplatz erhöhen», sagt sie.
Umgang mit der Zeit:
Schule als Modell für eine menschlichere Gesellschaft
Auch die Schulleiterin strebt nach Zufriedenheit in ihrem Job. Im Streben, ein Vorbild zu sein, neigt sie dazu, ihre Arbeit auszudehnen über die Uhrzeit und die Lebenszeit. Nicht ungewöhnlich, sagt sie, bis morgens um zwei zu arbeiten. Mittagspause? Kannst du vergessen. Das Frühstück morgens wurde eingespart, bis die zweite Schule dazu kam und es nicht länger ohne Stärkung ging. Das Arbeitsleben läuft stets auf hohen Touren. Die Sommerferien sind wichtig, «um runter zu kommen.» – «Da ist noch was: Dass ich keine eigenen Kinder habe, hilft mir, – privat bin ich nie ausgepowert.» Das Wichtigste ist die Wertschätzung, die man durch diese Arbeit erfährt. «Es stand ja zu befürchten, dass mich das Engagement in zwei Schulen kaputt machen würde. Tatsächlich waren die Kolleginnen in der zweiten Schule aber bereits ‹im Aufbruch› und benötigten nur jemanden mit Erfahrung, wie man es anders machen kann und zeigt, wie es gehen kann; eine, die nicht alles ändern will, sondern Leistung und Einsatz wertschätzt, vorhandene Potentiale stärkt und Möglichkeiten zeigt, Schule mit Leben zu füllen im konstruktiven Miteinander, vielfältig, sich gegenseitig stärkend und ergänzend. Mit dem BEP und dem ko-konstruktiven Ansatz von Wassilios E. Ftenakis hatte an der Lindenhofschule diese Entwicklung bereits vor einigen Jahren begonnen, an die ich leicht anknüpfen konnte. Da kommt, wenn es gelingt, eine Wertschätzung zurück, die alles andere aufwiegt.»
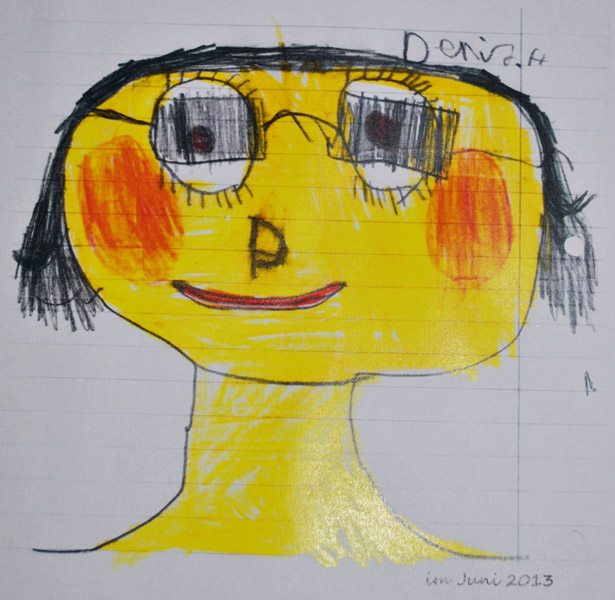
Denis H.: Porträt der Schulleiterin Antje Rümenapf 2013
«Ich nehme mir immer
Zeit, und ich bin mit meiner
ganzen Person da, wenn
ich gebraucht werde.»
«Ich nehme mir immer Zeit», sagt sie, «und ich bin mit meiner ganzen Person da, wenn ich gebraucht werde.» Sie ist früher da, geht später weg, und ist für jeden zu sprechen. Für die vielen Projekte, auf die sie sich einlässt, nimmt sie sich Zeit, zieht Experten hinzu, die Know-how vermitteln, erst für Kolleginnen, dann für die Eltern. So war es bei der Umgestaltung des Schulhofs in Beerfurth, bei der Fachleute zwei Spielbereiche einrichteten, und so wird es bei der Neueinrichtung des Schulhofs in Brensbach sein, wo die mächtigen Linden Platz und Licht beanspruchen, – ein Problem, das durch den Aufbau eines hölzernen Decks gelöst werden könnte, eine zweite Fläche über der ersten, auf zugelassener Höhe der Lindenbäume.
Schule als architektonisch gestalteter Lebensraum für alle, die dort leben und lernen: Die Vorstellung geht über den blossen Unterrichtsbetrieb hinaus und läuft hinaus auf einen Ort, der tagsüber jederzeit zugänglich ist. Die Einrichtung der Räume folgt dem Muster der Zeit. Die Zeit von zwölf bis halb zwei ist für Mittagessen und Spielen vorgesehen (Mittagessen kostet 3.50 Euro, – ein Betrag, den manche Familien als schmerzhaft hoch wahrnehmen). Nachmittags bietet die Beerfurther Schule ein Betreuungsprogramm an, das acht Kinder wahrnehmen. Um die Schule für alle nachmittags offen halten zu können, wurden auf dem Bolzplatz, der zum Schulgelände gehört, vom Sportverein Tore angeschafft und aufgestellt: Eine Zugangsmöglichkeit für alle erfordert die Genehmigung des Schulträgers, die Schule auch ausserhalb der Unterrichtszeiten offenzuhalten.
Die Bewirtschaftung der Zeit, meint Antje, sei ein gesellschaftliches Thema, eine Art heimliches Leitbild; sie beobachte, dass die Eltern zunehmend kaum noch die Zeit haben, miteinander zu sprechen: «Sie geben sich die Klinke in die Hand, und die Kinder müssen sehen, wo sie bleiben.» Die Beziehungen der Menschen führen zu Verhaltensmustern, und der Umgang mit der Zeit in unserer Gesellschaft sei geprägt vom Streben, Ersatzbedürfnisse zu befriedigen. Sie zitiert den Hirnforscher Gerald Hüther, der als Ersatzbedürfnisse die Bedürfnisse von solchen Dingen bezeichnet, die man nicht wirklich braucht: «Mein Auto, mein Haus, mein Urlaub usw.». Wo das Leben der Familien durch das Streben nach Befriedigung derartiger Ersatzbedürfnisse bestimmt sei, bleibe wenig Zeit für den Umgang miteinander, ein menschliches Grundbedürfnis, das für eine intakte Entwicklung von Kindern grundlegend ist, um ein gesundes und zufriedenes Leben führen zu können. «Die Eltern wissen es nicht besser; sie unterliegen gesellschaftlichen Lebensbedingungen und sind in gewisser Weise befangen.»
Alternative Wege müssen aufgezeigt und vorgelebt werden. «Gerade Schulleiter und Lehrkräfte sind Vorbilder, vielen scheint das nicht in vollem Umfang bewusst zu sein», sagt Antje.
Die Schule anstelle der Familie als Keimzelle der Gesellschaft? Die Vorstellung mag manchen als Sakrileg erscheinen, aber wo das alte Idealbild der Familie so weit lädiert ist, dass die Erziehungsfunktion nicht mehr ohne weiteres gewährleistet werden kann, beginnt man die Zusammenhänge womöglich klarer zu sehen: War es nicht schon immer der Fall, dass die Loyalitäten und Bande der Familie der Grossfamilie galten und die Stammeszugehörigkeit festigten, also jenen Tribalismus, der demokratischen Wertvorstellungen im Wege steht, die ohne Rücksicht auf Herkunft die Lebenschancen jedes Menschen fördern?
«Schulleiter und
Lehrkräfte sind Vorbilder,
vielen scheint das nicht
in vollem Umfang bewusst
zu sein.»
Bei der Auseinandersetzung über diese Frage steht die Schulleiterin aufseiten der Schule als Keimzelle der Demokratie. Auch wenn sie die Erziehungsphilosophie von John Dewey nicht studiert hat und sich deshalb nicht bewusst an seinen Vorstellungen orientiert, so folgt sie mit ihrer Arbeit doch seiner Philosophie und liefert ein eindrucksvolles Beispiel für Deweys Idee von Schule als «embryonische Gesellschaft». Dewey versuchte vor hundert Jahren in Chicago einen Weg zu finden, inmitten der «grossen Gesellschaft» des modernen Amerika mit seiner materialistischen Orientierung und seiner manipulierten Öffentlichkeit menschliche Züge festzuhalten und zu bewahren: Wie ist die Verwandlung der grossen Gesellschaft in eine grosse Gemeinschaft möglich? Die Lösung lag für ihn in der Bildung der Menschen, seine Hoffnungen setzte er auf das Schulwesen: Wenn es gelänge, die Gesellschaft in der Modellwelt der Schule zu einer Gemeinschaft umzuformen, dann wäre damit in den Köpfen der Schüler ein Bild geschaffen, das weiter wirksam bliebe, sodass das Ziel – die grosse Gemeinschaft – nicht völlig aus der Welt geraten müsste.
Mit den Fragen der Kinder im Zentrum des Lernens löst Dieter Kauffeld Schulprobleme unserer Zeit – wenn er nicht gerade dem Kollegium erklären muss, wie man Hände wäscht – Von Katrin Hille
DIETER
KAUFFELD

Dieter Kauffeld
*1953 in Kassel
wohnhaft in Kassel
verheiratet
zwei erwachsene Kinder
Studium für das Lehramt für die Grundstufe in Mathematik und Sachunterricht, naturwissenschaftlicher Aspekt an der Gesamthochschule Kassel
1976 Erstes Staatsexamen
1979 Zweites Staatsexamen
ab 1977 Lehrer
ab 1992 Schulleiter
Wahrnehmung besonderer Aufgaben für das Hessische Kultusministerium:
Entwicklung eines Konzepts für die Verkehrserziehung in der Grundschule
Erarbeitung eines Entwurfs für die Bildungsstandards
Konzeption der Hess. Orientierungsarbeiten Mathematik über mehrere Jahre
Pädagogischer Berater für Neurowissenschaften und Lernen
Multiplikator und Fachberater für den Hess. Bildungs- und Erziehungsplan
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.