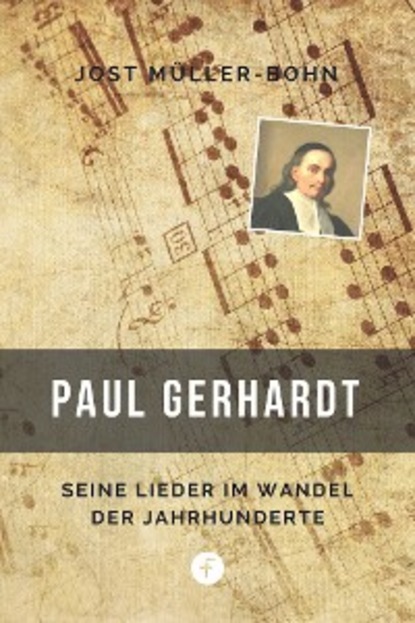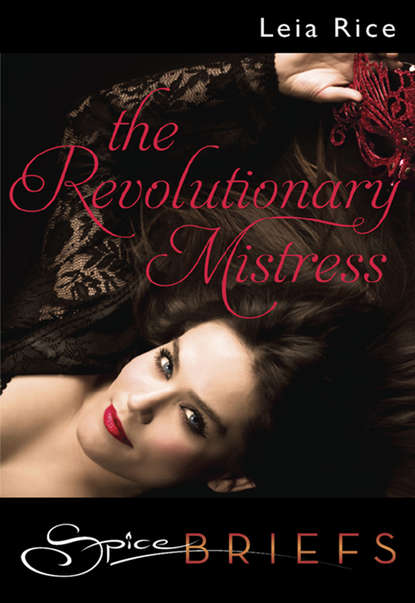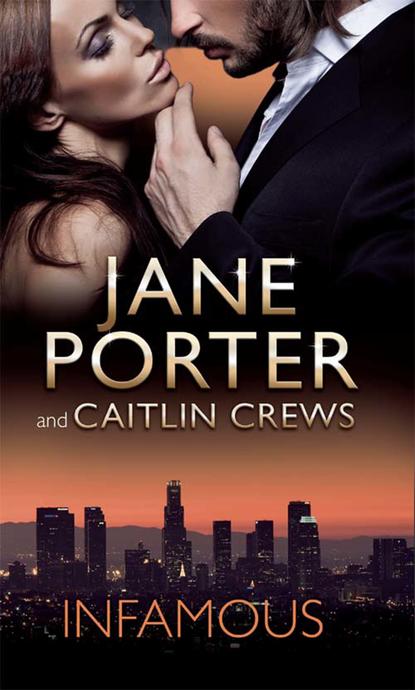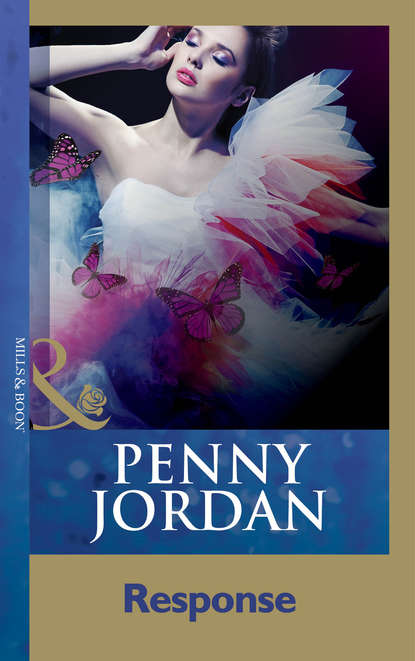- -
- 100%
- +
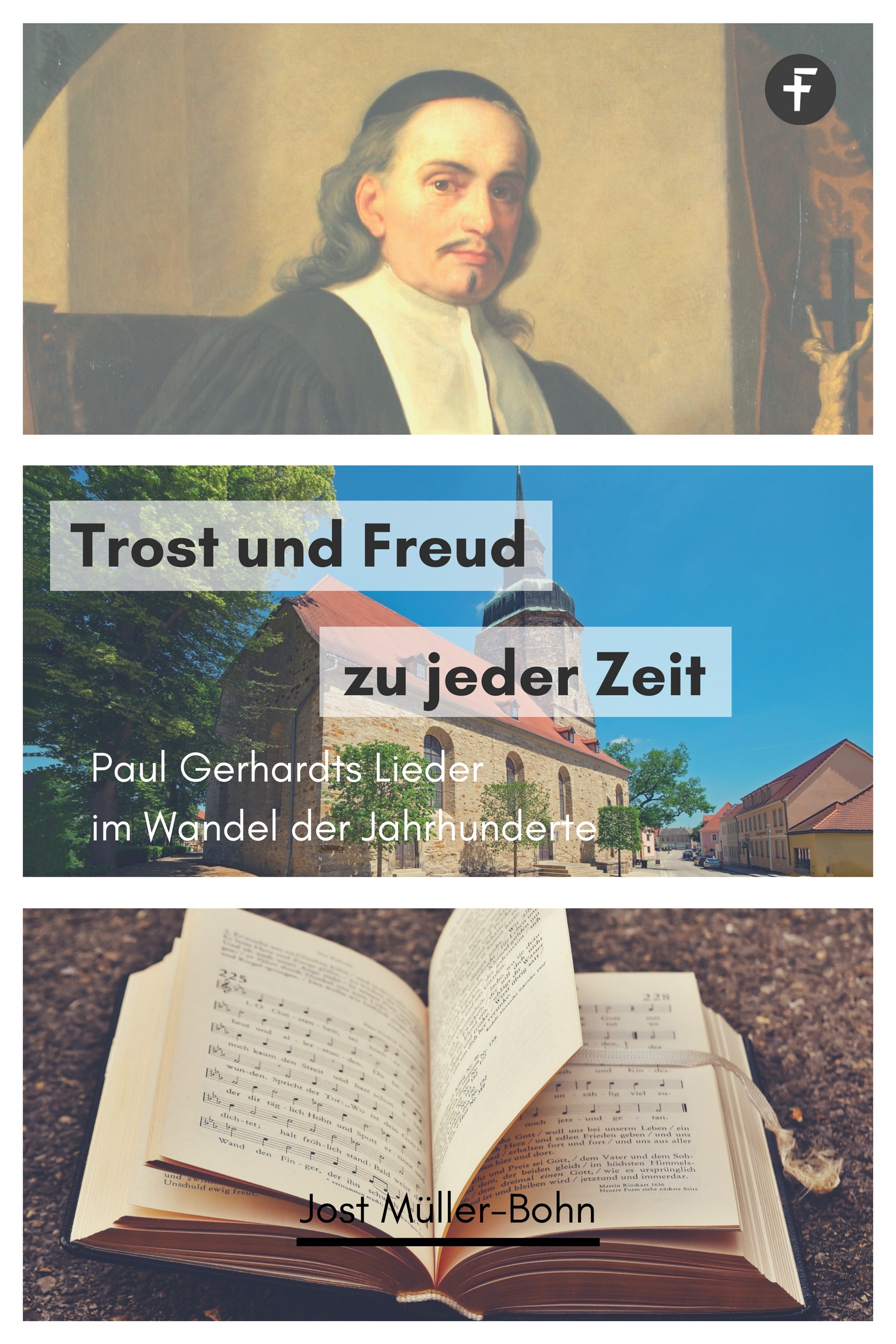
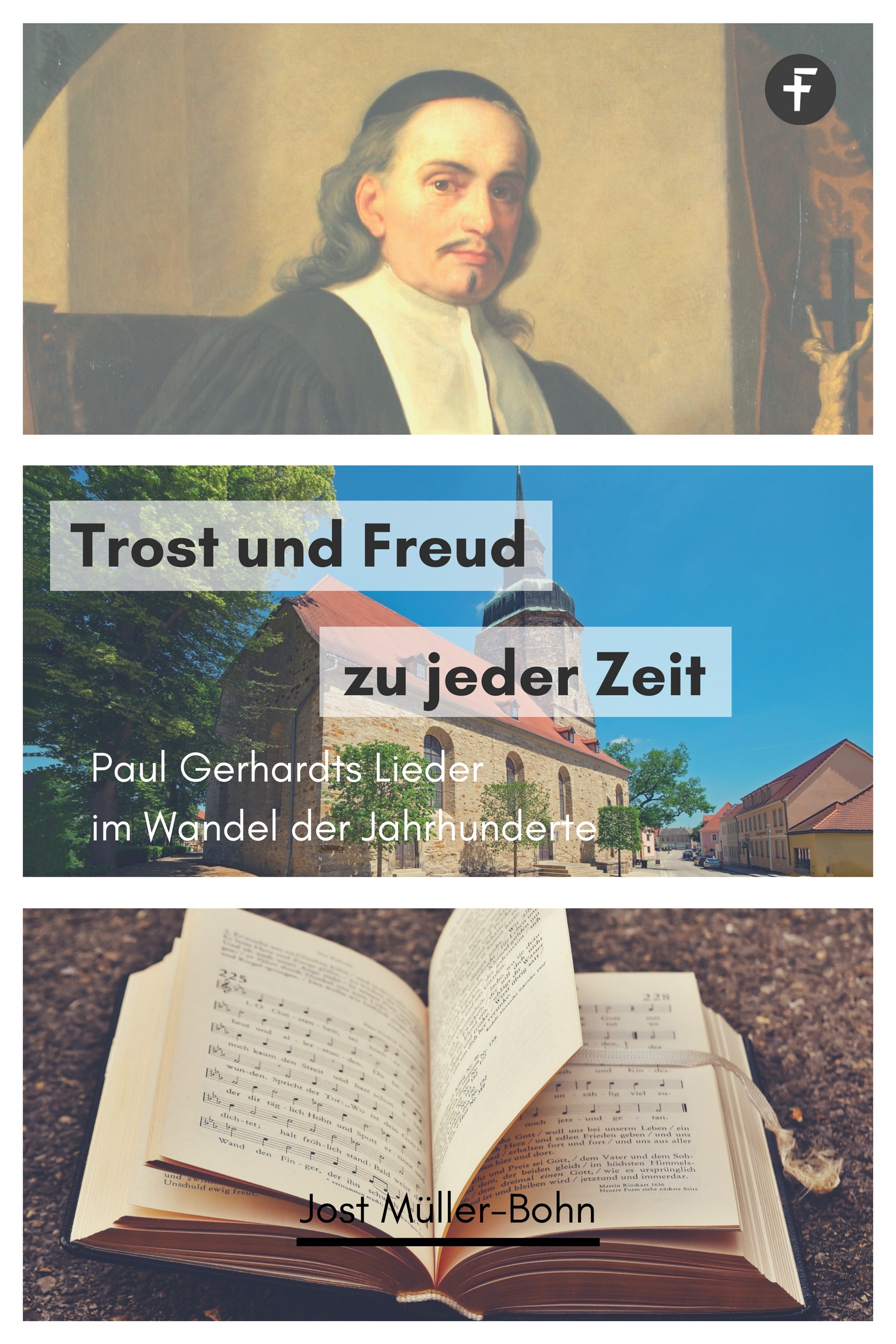
Trost und Freud zu jeder Zeit
Paul Gerhardts Lieder im Wandel der Jahrhunderte
Jost Müller-Bohn

© 2017 Folgen Verlag, Langerwehe
Autor: Jost Müller-Bohn
Cover: Caspar Kaufmann
Lektorat: Mark Rehfuß, Schwäbisch Gmünd
ISBN: 978-3-95893-010-0
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: info@folgenverlag.de
Shop: www.ceBooks.de
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Dank
Herzlichen Dank, dass Sie dieses eBook aus dem Folgen Verlag erworben haben.
Haben Sie Anregungen oder finden Sie einen Fehler, dann schreiben Sie uns bitte.
Folgen Verlag, info@folgenverlag.de
Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über:
Neuerscheinungen aus dem Folgen Verlag und anderen christlichen Verlagen
Neuigkeiten zu unseren Autoren
Angebote und mehr
http://www.cebooks.de/newsletter
Autor
Jost Müller-Bohn, geboren 1932 in Berlin, ist der bekannte Evangelist und Schriftsteller von über 40 Büchern. Er studierte in Berlin Malerei und Musik. Über 40 Jahre hielt er missionarische Vorträge. Seine dynamische Art der Verkündigung wurde weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt.
Als Drehbuchautor und Kameramann ist er der Begründer der „Christlichen Filmmission“. Seine Stimme wurde unzähligen Zuhörer über Radio Luxemburg bekannt. Einige seiner Bücher wurden zu Bestsellern in der christlichen Literatur.
Inhalt
Titelblatt
Impressum
Autor
Vorwort
Sollt ich meinem Gott nicht singen
O Haupt voll Blut und Wunden
Am Abend vor der Schlacht
Die Königin auf der Flucht
Geh aus, mein Herz, und suche Freud
Die Nacht vor dem Tode
Von guten Mächten wunderbar geborgen
Wach auf, mein Herz, und singe
Paul Gerhardt – eine kleine Chronologie seines Lebens
Unsere Empfehlungen
Vorwort
Segensreich ist es, sich mit Lebensbildern von Gottesmännern zu beschäftigen, die uns noch heute durch ihre gedruckten Predigten oder Lieder zum Segen sind. Wir erfahren dabei, wie unsere geistlichen Vorfahren neben Siegen auch manche Anfechtungen und sogar Niederlagen hinnehmen mussten.
Der bekannte Choraldichter unserer Zeit, Rudolf Alexander Schröder (1878-1962), schrieb: »Es ist mir immer, als ginge die Sonne auf, wenn der Name Paul Gerhardt in mein Gedächtnis tritt. Was haben nicht unsere Klassiker diesem Sprachmeister und Sangesmeister zu danken, wo vor ihnen Weisen erklungen von so kristallener Reinheit des Tones und des Wortes wie: Befiehl du deine Wege …?
Seine Lieder sind Wunder der Sprache, Wunder des innigsten Gemütes, in deren Bann wir Heutigen ebenso stehen wie die drei Jahrhunderte vor uns.«
Über dem Lied: »Befiehl du deine Wege …« steht in alten Gesangbüchern als Überschrift: Das Evangelium der Lieder.
Die Verse Paul Gerhardts sind als Lieder erschienen, nicht als Gedichte. Die Bücher, in denen sie zum ersten Mal gedruckt worden sind, waren Gesangbücher. Interessanterweise wurden diese Liederbücher nicht in der Kirche zu Gottesdiensten verwendet, sondern in kleinen Hausgemeinden zur andächtigen Erbauung am Abend und am Morgen. Es hat sehr lange gedauert, bis die evangelische Christenheit von der geistlichen Tiefe und dem Reichtum der Paul Gerhardtschen Lieder etwas verstanden hat.
Meines Wissens gibt es nach Dr. Martin Luther keinen größeren evangelischen Kirchenliederdichter, der uns im geistlichen Liede Glaubenszuversicht und Trost vermitteln könnte, als eben Paul Gerhardt. Wenn bei Martin Luther die versammelte Gemeinde ihren Schöpfer und Erlöser jubelnd preist, so betet bei Paul Gerhardt der einzelne geführte und geprüfte Christ seinen Schöpfer an. Jeder Jünger des Herrn, der aus vollem Herzen in seine Lieder einstimmt, freut sich darüber, dass ein anderer dafür Worte gefunden hat, weil er selbst nicht imstande war, in Worte von dieser Schönheit zu kleiden, was er in seinem Innersten empfand.
Deshalb haben Paul Gerhardts Lieder in ihrer Aussagekraft nichts verloren, sie müssen nicht in unsere Sprache übersetzt werden. Paul Gerhardt redet die Muttersprache der glaubenden Seele, die jeder versteht, der an Jesus Christus glaubt und den Schöpfer verherrlichen möchte.
Seine Lieder bleiben hilfreicher Trost, gelebte Christenfreude und praktische Erbauung. Deshalb haben sich seine Lieder bis in das 20. Jahrhundert in aller Jugendfrische erhalten.
Das Wunder des Schöpfergeistes, aber auch die Einmaligkeit seiner Glaubenssprache lässt sich nicht analysieren.
In diesem Buch kommen historische Persönlichkeiten zu Wort, die unter verschiedensten Umständen ihres Lebens in allen Jahrhunderten den Liedschatz Paul Gerhardts zu Heil und Trost verwendet haben. Johann Sebastian Bach, Husarengeneral Joachim von Zieten, Königin Luise von Preußen, Kunstmaler und Illustrator Ludwig Richter und Pfarrer Dietrich Bonhoeffer sind Menschen, die Trost und Hoffnung aus dem »Hohen Lied der Treue Gottes« schöpfen konnten.
Bekannte und unbekannte Christen haben die Güte Gottes mit den bekannten christlichen Volksweisen gepriesen: »Nun ruhen alle Wälder«, »Geh aus, mein Herz, und suche Freud« oder auch weihnachtliche Andacht gehabt, wenn sie zur Adventszeit sangen: »Wie soll ich dich empfangen«, »Ich steh an deiner Krippen hier«.
Wir wollen mit ihnen neue Lebens- und Glaubenskraft an Paul Gerhardts ewig jungen Liedern gewinnen.

Paul Gerhardt, 1607-1676.
Holzschnitt nach einem Gemälde aus dem Jahr 1876.
Der größte unter den Liederdichtern der evangelischen Kirche nach Martin Luther.
Sollt ich meinem Gott nicht singen
Trübe, melancholische Novembertage gaben der Stadt Berlin ein düsteres Aussehen. Paul Gerhardt saß in seinem Studierzimmer am Schreibtisch. Es wurde bereits am frühen Nachmittag dunkel. Der Pfarrer liebte solche Stunden, in denen die Nebel über die Dächer zogen, den Kirchturm umwehten und sich in den öden Gassen niederließen; dann fühlte er sich umgeben von der Liebe Gottes, seiner Gnade und Barmherzigkeit. Schwermütig veranlagte Leute beneideten ihn deshalb, weil er trotz aller Finsternis doch das helle Licht des Evangeliums sah.
Vor ihm lag ein Schreiben des Kurfürsten. Immer wieder hatte es der Bote Gottes gelesen. Nun erhob er sich; sehr energisch schritt er im Zimmer hin und her, blickte auf das Gemälde über dem Hausaltar und sprach halblaut vor sich hin:
»Ich bin durch die Stellen in der Heiligen Schrift überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Darum kann und will ich nicht widerrufen, weil wider das Gewissen etwas tun weder sicher noch heilsam ist.«
Diese gewaltigen Luther-Worte kannte der Pfarrer auswendig. Er schaute in das großflächige Gesicht des Reformators. Mit solch einer Überzeugungskraft sollte jeder Christ vor seinem Schöpfer stehen und weder Menschen noch Höllengeister fürchten, dachte der Pfarrer.
Wieder trat Paul Gerhardt zum Schreibtisch, setzte sich und zündete eine Kerze an. Nachdenklich stützte er seinen Kopf auf. Schön und gut, dachte er, man soll die Reformierten nicht verketzern, lästern oder gar verdammen. Der Kurfürst ließ mitteilen, dass es nie seine Absicht gewesen sei, die Gewissensfreiheit der lutherischen Christen einzuschränken. Doch wie war dies nun zu verstehen? Sollte man um des lieben Friedens willen immer nur schweigen? Kämpfte nicht jeder katholische Priester mit Eifer und Leidenschaft gegen die Lehre der lutherischen Ketzer? Nun sollten alle lutherischen Pfarrherren ein Schreiben unterzeichnen, in dem sie feierlich versprachen, nichts gegen das reformierte Glaubensbekenntnis zu sagen. War er nicht bei der Ordination als lutherischer Pfarrer durch den Amtseid verpflichtet worden, treu und gewissenhaft den Inhalt der Bekenntnisschriften Luthers zu lehren und zu verbreiten? Wie konnte er schweigen, wo es galt, treu mit dem Munde zu bekennen?
»Nein, und nochmals nein! Ich will mich durch die weltliche Obrigkeit nicht binden lassen«, sagte Paul Gerhardt mit Bestimmtheit.
Noch einmal las er sehr sorgfältig den kurfürstlichen Revers: »… dass das unzeitige Verdammen und Andichten, Verlästern und Verleumden auf der benachbarten Universität Wittenberg nicht nachgelassen, sondern die übermäßige, vergällte Bitterkeit auch noch dahin ausgebrochen ist, dass unsere reformierte Religion und deren Bekenner zuhöchst beleidigt und einem Reformierten in einem lutherischen Herrenland und Gebiet das bloße Wohnrecht abgeschnitten und versagt wird und unsere Untertanen zu Ungehorsam und Widersetzlichkeit gegen uns aufgewiegelt werden …«
Es klang nach bitterem Hohn – gewiss waren es reformierte Ratgeber, die den Landesherrn zu diesem Schreiben veranlasst hatten.
Es wurde an die Tür geklopft und zugleich auch geöffnet.
Anna Maria kam mit dem zweijährigen Sohn Paul Friedrich auf dem Arm herein. Für den Vater war es die liebsamste Unterbrechung, wenn der Kleine zum »Gute-Nacht-Kuss« von der Mutter gebracht wurde.
»Welch ein Schatten in deinen Augen, mein Liebster«, sagte Anna Maria; dabei legte sie ihm ihre Hand auf die Schulter. »Ja, ja – Anna, es sind schwere, böse Zeiten für einen lutherischen Pfarrer und vielleicht auch für seine Frau. Manchmal reut es mich fast, Theologe zu sein. Gern wollte ich das Pfarramt niederlegen, um mich nur der göttlichen Dichtkunst zuzuwenden. Doch das wäre leidensscheu und nicht lutherisch standhaft. Im Übrigen, von der Dichtkunst lässt es sich wohl auch nicht ausreichend leben«, fügte er noch hinzu. Unwillig schüttelte er den Kopf, dass die langen Locken durcheinanderwirbelten. »Fort mit euch, ihr lästigen Schatten! Fort aus Herz und Sinn!«
»Papa – lieb …«, rief der Kleine begeistert und streckte seine Ärmchen nach ihm aus.
Liebevoll nahm der Vater sein Kind an sich und drückte das Lockenköpfchen an seine Brust. »Mein kleiner, süßer Schatz – ja, ja, der Papa hat dich lieb, und du hast deinen Papa lieb.« Er drückte ihn noch fester an sich, trat an das Fenster und blickte zum verhangenen Himmel empor. »Mein Gott, gerechter Vater, nachdem du vier meiner Kinder zu dir gerufen hast, bin ich der festen Zuversicht, dass du mir meinen Paul Friedrich lassen wirst. Ich habe ihn dir versprochen. Er soll ein glaubensfester Diener deines Reiches werden!« Er hielt ihn mit beiden Händen in die Höhe. »Und wenn auch der Kurfürst von Brandenburg keinem seiner Untertanen mehr erlaubt, in Wittenberg an der Universität zu studieren, du wirst dort dein Theologiestudium absolvieren, mein Junge, und ein rechter lutherischer Glaubensheld werden!«
Paul Gerhardt nahm seinen Sohn auf den rechten Arm und blickte über den Nicolai-Friedhof und über die Dächer der Stadt.
»Heute bleibt der Nebel wohl lange in den Mauern der Stadt hängen! – So ist es auch mit unseren Wegen, sie sind oft von vielen Ungewissheiten umnebelt. – Wann hat nur aller Streit ein Ende?« Anna Maria griff ihren Mann am Arm. »Du sollst dich frei entscheiden, Paul. Denk nicht an Weib und Kind. Du stehst und fällst deinem Herrn, dem höchsten Richter. Keine Macht der Welt soll dein Gewissen beschweren.« Sie schmiegte sich an ihn. »Gott hat mich reich beschenkt und mir eine rechte Gefährtin an die Seite gestellt, die zu mir passt, die mit mir kämpft, auch mit mir zieht, und sei es bis ans Ende der Welt.«
Anna Maria blickte hinunter zur Straße. »Wie ausgestorben sind die Gassen. Bei diesem trüben Wetter kann man den Kometen nicht sehen. Die Leute meinen, es gäbe wieder Krieg – das Ende aller Dinge sei gekommen.«
»Törichtes Geschwätz«, sagte Paul energisch. »Ja, damals, als ich noch ein Knabe war, da erschien anno 1618 der Komet – er hatte einen langen Feuerschweif – und es kam der große Krieg – mein Gott – Krieg, Krieg und immer wieder Kriegsgeschrei. Könnte uns nicht bald der helle Morgenstern aufgehen, um den ewigen Frieden anzuzeigen? Kometen kommen und gehen, aber sein Wort bleibt ewig bestehen. Er, der Herr Jesus Christus, wird kommen wie ein Dieb in der Nacht – wenn das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheint – wenn die Posaune erschallt und er erscheint auf den Wolken des Himmels, dann sollen wir bereit sein, ihm entgegenzugehen.« Er reichte ihr das Kind zurück. »Bring mir den Kleinen jetzt ins Bett, ich will noch etwas tun.«
Anna Maria verschwand. Bald hörte man sie im Nebenzimmer singen:
»Breit aus die Flügel beide,
o Jesu, meine Freude,
und nimm dein Küchlein ein.
Will Satan mich verschlingen,
so lass die Englein singen:
›Dies Kind soll unverletzet sein!‹«
Paul Gerhardt dachte an seine Kindheit, ja, an sein turbulentes Leben. Wie viel Not und Qual hatte er erleiden und ansehen müssen. Der Vater starb, als er gerade sieben Jahre alt war. Die Mutter zog ihn unter den enormen Lasten des nicht enden wollenden Krieges auf. Als Fünfzehnjähriger kam er auf die Fürstenschule zu Grimma – dann brach die Pest in dieser Gegend aus. Die kriegerischen Völkerscharen hatten viele Seuchen mit ins Land geschleppt. Sein Studium in Wittenberg wurde immer wieder durch kriegerische Ereignisse unterbrochen. Dreißig Jahre dauerte dieses unheimliche Morden und Brennen.
Kaum war er als angehender Theologiekandidat heimgekehrt, brannte seine Heimatstadt nieder. Die Hälfte aller Häuser, Magazine und Ställe wurde vernichtet – auch sein Geburtshaus brannte lichterloh. Die Kirche und das Pfarrhaus mit allen Dokumenten und Chroniken wurden von den Flammen verzehrt. Nöte über Nöte häuften sich; sie hätten ihn eher zum Schreien als zum Loben bringen können.
Der Dichter rückte seinen Sessel an den Tisch. Im matten Schein der Kerze schrieb er:
Ist Gott für mich,
so trete gleich alles wider mich,
so oft ich ruf und bete,
weicht alles hinter sich.
Hab ich das Haupt zum Freunde
und bin geliebt bei Gott,
was kann mir tun der Feinde
und Widersacher Rott?
Er dachte an seine Glaubensbrüder Reinhardt und Lilius. Sie hatten das »Toleranzedikt« des Kurfürsten nicht unterzeichnet und wurden beide ihrer geistlichen Ämter enthoben. Was sollte nun geschehen? Welchem Schicksal ging er entgegen, da den Mitgliedern des Konsistoriums bekannt war, dass er, Paul Ger-hardt, seinem Freund und Bruder Reinhardt geraten hatte, den Revers nicht zu unterschreiben?
Am 16. Februar 1666 erschien Paul Gerhardt vor dem hohen Rat des Konsistoriums. Ihm wurde dringend geboten, das »Toleranzedikt« zu unterschreiben; denn seine Amtsbrüder Reinhardt und Lilius seien ja wegen der Verweigerung ihrer Unterschrift unverzüglich ihrer Ämter enthoben worden, drohte man ihm.
Paul Gerhardt schaute in die Gesichter der hohen Geistlichkeit. In ihren Perücken und Roben hatten sie etwas Mumienhaftes an sich. Der Vorgeladene reckte sich zu seiner ganzen Größe auf: »Hochverehrtes Konsistorium – meine Brüder in dem Herrn! Urteilen Sie selbst, ob es wohl gut ist, gegen die Erkenntnis, die man aus der Heiligen Schrift gewonnen hat, zu handeln. Darum ist es beileibe von mir keine Böswilligkeit – ich bin aber in meinem Gewissen gehalten und vom Wort der Heiligen Schrift überzeugt, der lutherischen Lehre treu mein Ordinationsgelübde zu halten. Wenn ich also meine Unterschrift unter folgenden Wortlaut zu setzen habe: ›Ich will jederzeit Gott mit herzlichem Gebet um die Förderung dieser Kirchentoleranz anrufen, und ich werde alle Mittel, die zu der Kirchentoleranz dienen, annehmen …‹, so bedeutet es Verrat und Bruch meines Gelübdes, das ich als Geistlicher des lutherischen Glaubens geleistet habe.«
Einmal begonnen, ließ sich Paul Gerhardt zur vollsten Kühnheit in der Wahl seiner Worte hinreißen:
»Nach meiner Meinung war es kein besonderes Heldenstück und auch kein sonderlicher Beweis christlicher Nächstenliebe, dem Magistrat der Stadt anzuraten, den abwesenden Amtsbruder Reinhardt, der bekanntlich bei seiner alten Mutter zu Besuch in Halle weilte, der Stadt und des Landes zu verweisen. Ihn aber nach seiner Rückkehr klammheimlich vor Sonnenaufgang mit seinen Angehörigen aus der Stadt abzuführen, scheint mir ein Zeichen großer Hilflosigkeit und den evangelischen Glaubensgrundsätzen recht unwürdig.«
Paul Gerhardt bemerkte die heftige Nervosität bei den einzelnen Mitgliedern des Konsistoriums und deshalb beeilte er sich, seine ungeschminkte Meinung dem hohen Rat mitzuteilen:
»Es ist allgemein bekannt geworden, dass Gott seinen mutigen, treuen Mann nicht verlassen hat. Wie wir vernommen haben, ist Reinhardt in Leipzig zu hohen geistlichen Ehren und Würden gekommen. Als Superintendent, Konsistorialrat und Professor kann er seinem Herrn und Meister Jesus Christus rechtschaffen und weit besser als in Berlin dienen.«
Ein giftiges Raunen war zu vernehmen, doch Paul Gerhardt sprach unbeeindruckt weiter:
»Auch bin ich der Ansicht, dass es durchaus keine großartige Handlung und auch kein Beweis christlicher Weisheit war, den ehrwürdigen Propst Lilius im hohen biblischen Alter durch eine Amtsenthebung – und zwar wegen seiner geraden Haltung gegenüber seinem Gott und Schöpfer – in Gewissensnot zu bringen. Wenn ihm nun sein ältester Sohn – wegen der ungeheuren Seelennot des Vaters – riet, die Unterschrift zu leisten, um ihm dadurch die ungeheuerliche Schmähung, nämlich eine Entlassung in seinem patriarchalischen Alter, zu ersparen, so ist dies auch kein geistliches Heldenstück. Soweit ich seinen körperlichen und seelischen Zustand richtig beurteilen kann, wird ihn dieser Akt infamer Diskriminierung sehr bald ins Grab bringen.«
Der Vorsitzende des Konsistoriums erhob sich, aber Paul Gerhardt erbat sich durch ein Handzeichen noch einen Augenblick der freien Rede: »Hochwürden, bitte gehorsamst noch einen Gedanken anfügen zu dürfen: Da wir zur Ansicht gekommen sind, dass diese Angelegenheit nicht nur uns Berliner Prediger allein angeht, sondern die gesamte lutherische Christenheit, haben wir uns deshalb an die Fakultät zu Wittenberg, Jena und Helmstedt und auch an die Ministerien von Hamburg und Nürnberg gewandt, um mit unseren Glaubensbrüdern in Deutschland in Einklang zu stehen.«
Nun ließ sich der Vorsitzende nicht mehr beschwichtigen. »Herr Gerhardt, Ihr wisst sehr genau, wie Seine Kurfürstliche Durchlaucht Euch deshalb getadelt haben, denn Euch gebührt nicht, dass Ihr dieses Edikt, welches wir aus wohlbedachtem Rat abgefasst haben, an auswärtige Leute zur Beurteilung weiterleiten durftet, wie wir uns ja auch nicht in die Verordnungen der genannten Universitäten und Kirchenministerien einmischen.«
Paul Gerhardt verneigte sich ein wenig, legte seine Hand auf die linke Brusthälfte und entgegnete unbeirrt: »Doch halte ich es für sehr widersprüchlich, geistliche Verordnungen zu erlassen über äußere Angelegenheiten des Staates und Gebote zur kirchlichen Ordnung aufzustellen, die das Gewissen eines rechtschaffenen Christen belasten könnten.«
Er hielt das kurfürstliche Schreiben empor. »Ich möchte deshalb auch von der achttägigen Bedenkzeit, die ich mir erbeten hatte, keinen Gebrauch machen, denn ich bin mir darüber jetzt schon im Klaren, dass ich auch nach einer gewissen Bedenkzeit, um meines christlichen Gewissens willen, meiner wittenbergischen Meinung, nicht anders entscheiden kann. Auch wenn nun mein Entschluss zwangsläufig die Entlassung aus dem christlichen Amt zur Folge hätte, sehe ich diese Angelegenheit lediglich als ein ›Berlinisches Leiden‹ an. Ich bin willig und bereit, mit meinem Blut für die evangelische Wahrheit zu kämpfen, um als Paulus mit Paulus das Schwert des Geistes bis an mein Lebensende tapfer und treu zu führen.« Während des Redens gewannen seine Augen ein Leuchten voll heller Siegeszuversicht.
Es herrschte betretenes Schweigen. Die ehrwürdigen Magister und Räte schüttelten unmutig ihre Köpfe. Paul Gerhardt aber verließ die Sitzung mit erhobenem Haupt. Zu Hause angekommen, setzte Gerhardt sich an den mit Schriften und Büchern überhäuften Tisch und schrieb, inspiriert vom Heiligen Geist:
Nun weiß und glaub ich feste,
ich rühm’s auch ohne Scheu,
dass Gott, der Höchst und Beste,
mein Freund und Vater sei,
und dass in allen Fällen
er mir zur Rechten steh
und dämpfe Sturm und Wellen
und was mir bringet Weh.
Nebenan hörte er seinen Sohn Paul Friedrich munter lärmen. Gerhardt dachte an seine Frau und sein Kind – er wollte sie nicht leichtfertig in finanzielle Not bringen, doch hatte er unmöglich anders handeln können. Wieder tauchte er seine Feder in die Tinte:
Der Grund, da ich mich gründe,
ist Christus und sein Blut;
das machet, dass ich finde
das ewge, wahre Gut.
An mir und meinem Leben
ist nichts auf dieser Erd;
was Christus mir gegeben,
das ist der Liebe wert.
Schneeflocken wirbelten über der Stadt. Das Schloss und die Domkirche waren verhüllt – die weiße Pracht breitete sich über die Allee »Unter den Linden« aus. Ein helles Feuer loderte im gekachelten Ofen. Für diesen Winter hatte seine Kirchengemeinde ihn mit Brennholz versorgt – Gott, der Herr, würde ihn auch weiterhin versorgen; dessen war sich der Gottesmann bewusst. Er schrieb weiter:
Mein Jesus ist mein Ehre,
mein Glanz und schönes Licht.
Wenn er nicht in mir wäre,
so dürft und könnt ich nicht
vor Gottes Augen stehen
und vor dem Sternensitz,
ich müsste stracks vergehen
wie Wachs in Feuershitz.
Paul Gerhardt schloss für einige Minuten seine Augen; er beichtete seinem Herrn und bat um tiefen Frieden und neue Kraft aus dem Glauben.
Nichts, nichts kann mich verdammen,
nichts nimmt mir meinen Mut;
die Höll und ihre Flammen
löscht meines Heilands Blut.
Kein Urteil mich erschrecket,
kein Unheil mich betrübt,
weil mich mit Flügeln decket
mein Heiland, der mich liebt.
Der Dichter dachte an den Ausspruch seines seligen Großvaters: »Lieber Amt und Beruf drangeben und mit Weib und Kind ins Elend ziehen, als wider das Gesetz zu handeln und den Frieden mit Gott verlieren.«
Paul Gerhardt hatte sich entschieden. Munter schrieb er weiter:
Sein Geist wohnt mir im Herzen,
regieret meinen Sinn,
vertreibet Sorg und Schmerzen,
nimmt allen Kummer hin,
gibt Segen und Gedeihen
dem, was er in mir schafft,
hilft mir das Abba schreien
aus aller meiner Kraft.
Kleine Hände bollerten an der Tür – ein zartes Stimmchen rief eindringlich: »Papa – Papa – Fidisch – Papa – Fidisch …«
Schmunzelnd erhob sich Paul Gerhardt; durch den sich öffnenden Türspalt fiel ihm sein kleiner Sohn zu Füßen. »Ja, wer kommt denn da hereingeplumpst? – Klein-Friedrich?«, fragte Gerhardt liebevoll. »Papa – Fidisch!«, lallte das Kind.
»Ja, so ist es recht. Der kleine Friedrich will zum Papa, und der Papa ruft zum himmlischen Vater: ›Abba, lieber Vater‹ und lobt den Schöpfer aller Welt.«
Unterdessen gab es im Rathaus ein reges Kommen und Gehen. Die ehrwürdigen Vorsteher der Handwerkerzünfte, die der Kirchengemeinde von St. Nicolai angehörten, versammelten sich im Vorzimmer des Bürgermeisters. Es waren Zinngießer, Messerschmiede, Kürschner, Tischler, Schneider, Bäcker, Metzger, Schuhmacher, Gewandschneider, Huf- und Waffenschmiede, aber auch die Kupferschmiede. Im Ratssaal herrschte ein erregtes Stimmengewirr, als Bürgermeister Michael Zarlang hereintrat. Die Abgeordneten der Bürgerschaft und die Vorsteher der Zünfte trugen ihre schweren Bedenken wegen der Amtsenthebung ihres geliebten Seelsorgers Paul Gerhardt aus dem Predigtamt vor. Sie baten inständig darum, ein Bittgesuch an den Kurfürsten zu richten mit dem Verlangen, »diesen frommen, ehrlichen und in vielen Landen berühmten Mann« wieder in Amt und Würden zurückzuversetzen. Der Bürgermeister gab seiner Freude Ausdruck, dass nun auch die Vertreter des Handwerks sich der allgemeinen Bürgerschaftsvertretung angeschlossen hatten und las ihnen aus dem Bittschreiben an den Kurfürsten vor: