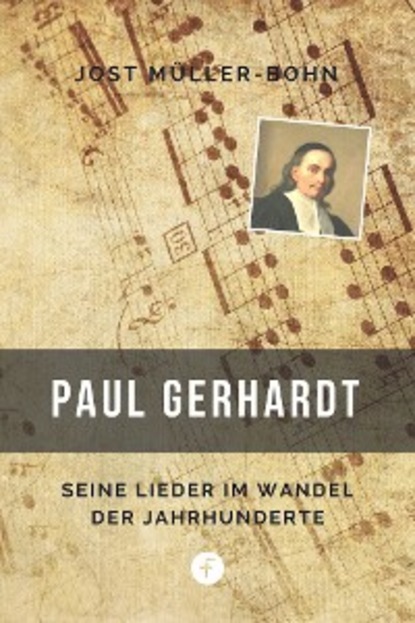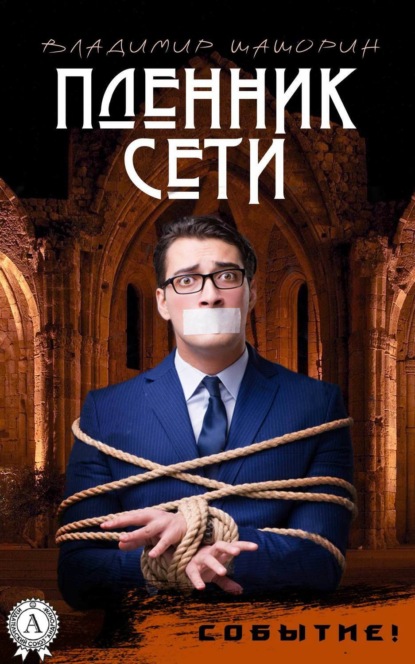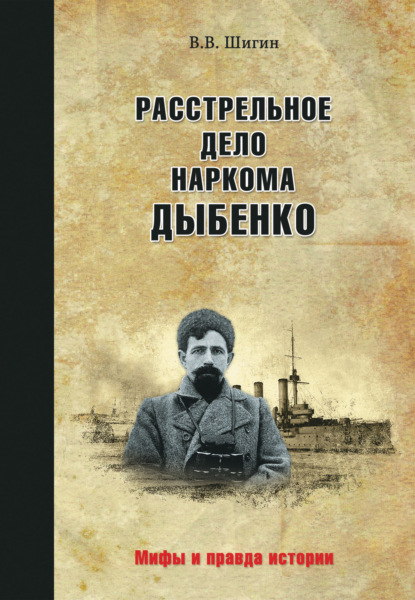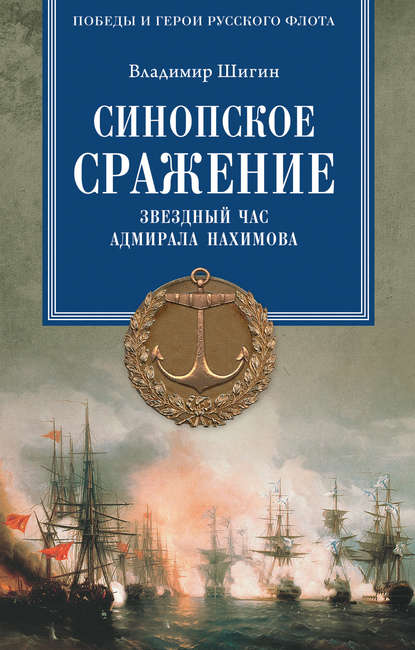- -
- 100%
- +
»So ist uns und unserer Kirche doch wieder ein neuer Schmerz darin zugestoßen, dass wir erfahren müssen, dass Herr Paul Gerhardt, unser geliebter Prediger und Seelsorger, uns soll entzogen werden. Aber es ist im Rat und der ganzen beiden Städte Berlin und Cölln mehr als bekannt, dass dieser Mann nimmer mehr wider Seiner Kurfürstlichen Durchlaucht Glauben und dero Genossen geredet und keine Seele mit Worten oder Werken angegriffen. Was wird denn aus uns und unserer Stadt endlich werden, wenn wir die Frommen nicht behalten und so mit ihrem Gebet bisher nur vor dem Zorn Gottes gestanden, nicht mehr bei uns haben sollten? Darum wolle der Magistrat für gedachten Herrn Gerhardten treufleißige Fürbitte anhalten und es bei Seiner Kurfürstlichen Durchlaucht untertänigst dahin vermitteln helfen, dass dieser fromme, ehrbare, in vielen Landen berühmte Mann uns möge gelassen werden.«
Zunächst zeigte sich Kurfürst Friedrich Wilhelm wenig beeindruckt von dem ihm überreichten Bittschreiben der Bürgerschaft und des Handwerks. Als sich aber die adeligen Stände wegen dieser leidigen Angelegenheit für Paul Gerhardt verwandten, versprach der Herrscher, nach der Rückkehr von seiner Reise darüber entscheiden zu wollen. Die fürstlichen Stände erinnerten den Großen Kurfürsten daran, dass er versprochen habe, das »Toleranzedikt«, welches von den Geistlichen unterschrieben werden sollte, zuerst ihnen, den Ständen, vorzulegen. Da dies aber nicht geschehen sei, wagten sie es, als die adligen Stände, die Art und Weise dieses Schreibens zu kritisieren. Die Fürsten baten, er, der Kurfürst, möge vor allem Diakonus Paul Gerhardt wieder in sein Amt zurückkehren lassen, denn dieser Mann Gottes habe sich allezeit als ein friedliebender Christ erwiesen.
Der Große Kurfürst ließ den Fürsten mitteilen, dass er nach der Rückkehr aus Kleve diese Angelegenheit behandeln wolle.
Man hatte Paul Gerhardt wohl in seinem Pfarrhaus belassen. Seine Gehaltsbezüge waren ihm nicht genommen, sodass er zunächst keine Sorge um das tägliche Brot haben musste. Aber Paul Gerhardt war sehr einsam, denn er konnte seiner Berufung als Prediger nicht nachgehen. Er litt unter dem Pauluswort: »Denn, dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen; denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte!«
Doch beugte sich der geprüfte Mann vor Gott und auch seiner Obrigkeit nach dem Motto:
Befiehl du deine Wege
und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege
des, der den Himmel lenkt.
An die Gräfin Maria Magdalena zu Lippe schrieb er unter anderem: »Ich meines Teils lasse den lieben Gott hierunter walten und bin mit seiner allerheiligsten Regierung wohl zufrieden, nachdem er mir nur das einige widerfahren lassen, dass ich mein armes Gewissen nicht kränken und betrüben dürfe. Denn was würde mir’s helfen, wenn ich gleich ein Königreich, ja, die ganze Welt gewinnen könnte, und sollte Schaden an meiner Seele leiden? Hingegen, was kann mir das schaden, wenn ich gleich in meinem äußerlichen und zeitlichen Wohlergehen etwas entbehren muss, wenn ich mir das schönste Gut, den köstlichsten Schatz, das allerteuerste Kleinod behalte? – Ist es Gottes Wille, dass ich ihm noch öffentlich in dieser Welt als Prediger dienen soll, will ich ihm gern das wenige, was noch übrig ist, von meinem Leben aufopfern. Will er nicht, so will ich ihn dennoch in meiner Einsamkeit preisen, loben und danken, solange sich mein Mund regt und meine Augen offen stehen.«
Am 10. Januar 1667, einem kalten, klaren Wintertag, saß Paul Gerhardt in seinem Studierzimmer in der Stralauerstraße und schrieb ins Reine, was ihm in den langen Nachtstunden Wort für Wort und Zeile für Zeile gekommen war:
Die Welt, die mag zerbrechen,
du stehst mir ewiglich;
kein Brennen, Hauen, Stechen
soll trennen dich und mich;
kein Hunger und kein Dürsten,
kein Armut, keine Pein,
kein Zorn der großen Fürsten
soll mir ein Hind’rung sein.
Bei Kerzenlicht hatte er um Mitternacht im Paulusbrief an die Römer meditierend wieder und wieder gelesen:
»Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? – Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.« Je länger und intensiver er las, umso beglückender wurde er von der Liebe Christi durch den Schöpfergeist ergriffen, getröstet und erfreut. Deshalb fügte er noch hinzu:
Mein Herze geht in Sprüngen
und kann nicht traurig sein,
ist voller Freud und Singen,
sieht lauter Sonnenschein.
Die Sonne, die mir lachet,
ist mein Herr Jesus Christ;
das, was mich singen machet,
ist, was im Himmel ist.
Der Liedtext war vollendet – der Dichter las noch einmal Strophe um Strophe. Dabei schritt er von der Tür zum Fenster und ging denselben Weg zurück. Als er nun so auf- und abgehend das Arbeitszimmer abschritt, vernahm er plötzlich hellen, frischen Gesang von außen her. Interessiert trat er ans Fenster und zog die Vorhänge zurück. In Wintermänteln und Pelzen vermummt, standen die Schüler des Gymnasiums im hohen Schnee. Kantor Ebeling, der Nachfolger des bekannten Komponisten und Organisten Criiger, dirigierte die Schülerschaft. Klar und deutlich klang es zu ihm herauf:
»Weg hast du allerwegen,
an Mitteln fehlt dir’s nicht;
dein Tun ist lauter Segen,
dein Gang ist lauter Licht;
dein Werk kann niemand hindern,
dein Arbeit darf nicht ruhn,
wenn du, was deinen Kindern
ersprießlich ist, willst tun.«
Während der Kantor den Einsatz zur nächsten Strophe gab, blickte er kurz empor, nickte dem Pfarrer freundlich zu und ließ die Jungen singen:
»Und ob gleich alle Teufel
hier wollten widerstehn,
so wird doch ohne Zweifel
Gott nicht zurücke gehn;
was er sich vorgenommen,
und was er haben will,
das muss doch endlich kommen
zu seinem Zweck und Ziel.«
Als nun auch die Schüler den Pfarrer entdeckten, zogen sie ihre Mützen und Kappen vom Kopf, schwenkten sie munter in die Höhe und riefen mit lauter, voller Stimme: »Vivat Paulus Gerhardtus! Es lebe unser Pfarrer von St. Nicolai!«
Handwerker, Hausfrauen, Kinder und vorüberkommende Nachbarn, die Gemeindemitglieder, bildeten eine ansehnliche Schar. Alle jubelten ihrem geliebten Seelsorger zu, vor Freude über die Nachricht seiner Wiedereinsetzung in das Pfarramt. Gegen 11 Uhr erschien der Bürgermeister Zarlang mit zwei Ratsherren in der Stralauerstraße. Paul Gerhardt begleitete sie in sein Studier- und Amtszimmer. Der Bürgermeister rieb sich fröstelnd die Hände.
»Es ist mir eine rechte Freude und Genugtuung, Ihnen, mein lieber Herr Gerhardt, die Wiedereinsetzung in Ihr geliebtes Pfarramt zu bestätigen.« Dabei schüttelte das Oberhaupt der Berliner Bürgerschaft dem Pfarrer kräftig die Hand.
»Gestern, am Nachmittag, waren die Mitglieder des Magistrats zur Audienz bei Seiner Kurfürstlichen Durchlaucht ins Schloss bestellt. Der Herr Oberpräsident von Schwerin eröffnete uns, dass gegen Ihn als Amtsperson keine Klagen vorliegen, als eben nur, dass der Herr Diakonus Paul Gerhardt nicht gewillt war, das Toleranzedikt zu unterschreiben. Seine Kurfürstliche Durchlaucht halten also dafür, dass der Herr Gerhardt die Meinung der Edikte nicht recht begriffen habe. Dessen ungeachtet soll der Pfarrherr wieder in sein Amt eingesetzt und ihm gestattet sein, das Predigtamt wie vorher zu treiben.«
Der Bürgermeister klopfte dem Pfarrer leutselig auf die Schulter.
»Die Freude über die Nachricht hat sich in der Bürgerschaft wie ein Lauffeuer verbreitet, wie Ihr ja seht und hört, sodass wir in der nächsten Nummer des Wochenblattes im ›Sonntagischen Mercurius‹ lesen werden, dass Seine Kurfürstliche Durchlaucht ab sofort befohlen haben, wegen der erwiesenen Unschuld Herrn Paul Gerhardt in seinem Amt von neuem zu bestätigen. In diesem Sinne werde den Gemeindemitgliedern von St. Nicolai, aber auch den Bürgern der beiden Städte Berlin und Cölln, amtlich kundgetan, dass die offizielle Suspendierung durch Anordnung des kurfürstlichen Kabinetts rückgängig gemacht wurde.«
Paul Gerhardt reckte sich empor. Er wusste nur zu gut, was der Geheime Sekretär, der ihn bereits am Tag zuvor besucht hatte, gemeint, als er im Auftrag seines Landesherrn mitteilte: »Seine Kurfürstliche Durchlaucht hege die Zuversicht, er würde sich dennoch allemal des Inhalts aus dem Edikt gemäß zu bezeigen wissen und alle Verketzerung und Verdammung der Reformierten sich strengstens enthalten.« Das hieß mit anderen Worten: Paul Gerhardt, du brauchst das Toleranzedikt zwar nicht zu unterschreiben, aber du musst dich auch so der Anweisung gehorsam fügen.
Der Pfarrer bat die hochwürdigen Herrn, doch Platz zu nehmen und begann bedacht zu antworten: »Es ist mir eine Freude, meine Herren, dass Sie gekommen sind und mir die gute Nachricht bringen, dass unser Kurfürst meine Mäßigung anerkannt hat. Im Grunde bin ich mir auch zu keiner Zeit bewusst gewesen, wodurch ich meine Absetzung verdient haben könnte. Nun muss ich Ihnen aber leider zu verstehen geben, dass ich mich über die Wiedereinsetzung in mein geliebtes Amt nicht von ganzem Herzen freuen kann, weil ich aus dem Inhalt des kurfürstlichen Bescheids entnehmen muss, dass ich dem lutherischen Bekenntnis kaum ungehindert treu bleiben kann.«
Gerhardt legte seine beiden Hände auf die Knie. »Im Gegenteil. Durch den Bescheid des kurfürstlichen Geheimsekretärs am gestrigen Abend habe ich Kenntnis erhalten, dass Seine Kurfürstliche Durchlaucht in Zukunft von mir erwartet, dass ich das Toleranzedikt auch ohne Unterschrift respektieren müsse.«
Mit betretenen Mienen folgten der Bürgermeister und die Ratsherren den Ausführungen des Geistlichen.
Paul Gerhardt faltete seine Hände. »Ich habe in der vergangenen Nacht vor meinem königlichen Herrn, dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde, im Gebet gerungen und es mir nicht leicht gemacht. So bin ich dann zu der Erleuchtung gekommen, dass ich der Wahrnehmung meines Amtes unter diesen Voraussetzungen meinem lutherischen Bekenntnis nicht mit reinem Gewissen dienen kann. Was aber schon mit einem zweifelnden Gewissen geschieht, ist vor Gott nicht recht und bringt dem Glaubenden keinen Segen, sondern Fluch. Deshalb fürchte ich, einst im großen Gericht Gottes in dieser Weise nicht bestehen zu können …«
Der Bürgermeister versuchte seinen Pfarrer zu unterbrechen, doch Paul Gerhardt zeigte ihm mit unbeirrbarer Miene, dass er seine Ausführungen beenden wolle. »Deshalb will ich dem geistlichen Amt, in das ich durch die Gnade des Kurfürsten wieder eingesetzt worden bin, aus eigenem, freiem Entschluss unter diesen Umständen entsagen. Meine Gewissensbedenken sind zu groß, und ich bin durch die Vorgänge der letzten 24 Stunden darin bestärkt worden, dass ich mein lutherisches Gewissen nicht rein halten kann.«
Er stand auf und ging respektvoll zum Bürgermeister. »Es tut mir leid, meine Herren. Bitte verstehen Sie mich in meiner Entscheidung. Ich wollte Sie nicht kränken, aber ich kann nicht anders handeln.«
Er verneigte sich kurz; der Bürgermeister und die Ratsherren standen auf; betroffen sahen sie zur Erde. Der Bürgermeister zuckte resigniert mit den Schultern. »Ich weiß nicht, ob Sie hiermit Gott besser dienen. Wir wollten Ihnen eine frohe Nachricht überbringen – doch scheint die weltliche Obrigkeit in diesem Fall der geistlichen keine goldenen Brücken bauen zu können.«
Sehr förmlich verabschiedeten sich die Vertreter des Magistrats.
Noch am selben Tag schrieb Paul Gerhardt an den Kurfürsten: »Obgleich unsere liebe Obrigkeit sich zu der reformierten Religion bekennet, so wissen und befinden wir’s doch gleichwohl, dass Sie in dero kurfürstlichen Herzen unsern lutherischen Glauben, welchen wir für den rechten, wahren und seligmachenden halten, nicht feind und gehässig sind, welches wir unfehlbar schließen aus dem väterlich hohen Schutz und Schirm, welchen Seine Kurfürstliche Gnaden uns bei unserem Bekenntnis so gnädigst versprach, auch bis dato gar reichlich und mildiglich geleistet haben. Gott vergelte es unserm lieben Landesvater und lasse es Ihm um Seiner kurfürstlichen Sache dafür wohlergehen immer und ewiglich.«
Treffend hat Karl Hesselbacher diesen Zwischenfall abschließend beschrieben: »Es gehört zu den tragischen Geschehnissen in der Geschichte der evangelischen Kirche, dass sich zwei so aufrechte und große Männer wie der Kurfürst und der Dichter nicht verstanden haben – nicht verstehen konnten! Der Kurfürst war ein wahrer, frommer Mann. Sein Lieblingslied ist ›Befiehl du deine Wege‹ gewesen. Es ist beinah eine tragische Ironie, dass er den Sänger dieses Liedes verstoßen musste.«
Bis tief in die Nacht saßen Paul Gerhardt und seine Frau Anna Maria bei Kerzenschein. Besorgt blickte er in ihre Augen. »Nun bin ich wieder ohne Amt und Stellung, meine Liebste.« – »Ja, ich habe es nicht anders erwartet.« Sie legte ihre linke Hand auf seine rechte. »Daniel war treu und gewissenhaft in seinem Glauben an Gott. Sie fanden nichts, was sie ihm vorwerfen konnten, weil er sein Amt treu und gewissenhaft versah. Nur seine Treue zur Religion brachte ihn in Verruf.«
»Ich werde deshalb nicht gleich in die Löwengrube kommen«, lächelte Paul Gerhardt. Dann besann er sich. »Glaub mir, Anna, ich wollte euch nicht leichtfertig in Sorge und Not bringen. Ich habe meine Herde nicht wie ein untreuer Hirte verlassen. Aber mein Gewissen würde mir keine Ruhe geben, wenn ich der lutherischen Sache nicht treu bliebe.« Er strich ihr sanft über das Haar und blickte in ihre feuchten Augen. »Du bist ja traurig, mein Liebes?«
»Ja, weil die Leute, die an diesen unerquicklichen Umständen schuld sind, nicht wissen, was du für ein herrlicher Mann bist. Wie glücklich könntest du sein, wenn man dir nicht so viele Schwierigkeiten in den Weg legen würde.«
»Glück?«, antwortete Paul. »Mein Liebes, was ist Glück? – Nicht Ehre und Ansehen, auch nicht Amt und Einfluss. O nein, Anna, auch Geld und Besitz bedeuten nicht Glück – sondern das Bewusstsein des himmlischen Friedens und der heiligen Berufung, Gott zu dienen mit Herzen, Mund und Händen.«
»Aber auch ein Mindestmaß an irdischem Auskommen ist nötig, um seiner Berufung nachkommen zu können. Ich liebe deine auffallende Bescheidenheit – doch wollte ich dir mehr Glück wünschen.« Anna Marias Stimme klang sehr traurig.
»Ich bin so froh, mein Liebes, dass ich tief in deinem Herzen zu Hause bin. Du bist mir durch die Liebe innerlich so vertraut; dieses Glück nehme ich täglich aus Gottes gnädiger Hand.« Er ergriff erneut ihre blasse Hand und drückte sie ganz innig. »Was mich noch mehr beglückt: der in mir triumphierende, herrliche Schöpfergeist Gottes, der mich immer neu inspiriert, Lieder zur Ehre des Schöpfers niederzuschreiben …« Er legte seinen Arm um sie, küsste ihre Hand und fuhr fort: »Vor allem kenne ich ein Glück, und um alle Welt wollte ich es nicht eintauschen: das reine Gewissen, in Glaubenstreue dem Lamm Gottes nachzufolgen …«
Annas Augen leuchteten. Ganz sanft begann sie zu deklamieren:
»Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld
der Welt und ihrer Kinder;
es geht und büßet in Geduld
die Sünden aller Sünder;
es geht dahin, wird matt und krank,
ergibt sich auf die Würgebank,
entsaget allen Freuden;
es nimmet an Schmach, Hohn und Spott,
Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod
und spricht: Ich will’s gern leiden.«
Weshalb sie mir wohl dieses Passionslied aufsagt, dachte Paul. Sie sieht so bleich und strapaziert aus. Es schien ihm, als wäre sie von einem besonders großen, inneren Leiden befallen. Ja, auch ihr Antlitz sah krank und matt aus.
Inzwischen war seine Frau an die Stelle gekommen, die Paul Gerhardt selbst für recht gelungen hielt:
»O Wunderlieb, o Liebesmacht,
du kannst, was nie kein Mensch gedacht,
Gott seinen Sohn abzwingen.
O Liebe, Liebe, du bist stark,
du streckest den in Grab und Sarg,
vor dem die Felsen springen.«
Um seiner Anna Maria auch seine große Liebe zur ihr neu ins Herz zu reden, sprach er seine eigenen Liedworte weiter, ja, sie sprachen miteinander:
»Mein Lebetage will ich dich
aus meinem Sinn nicht lassen,
dich will ich stets, gleich wie du mich,
mit Liebesarmen fassen.«
Spontan stand er auf, zog sie sanft an sich und blickte ihr dabei tief in die Fenster der Seele.
»Du sollst sein meines Herzens Licht,
und wenn mein Herz in Stücke bricht,
sollst du mein Herze bleiben.«
»Dies gilt dem Herrn, der dich erlöst hat und in aller Gottesliebe hält und trägt«, sagte Anna und schluckte heftig.
»Dich quält etwas. Du hast irgendeinen geheimen Schmerz, mein Liebes. Was macht dich so erregt und so unruhig?«, wollte er wissen.
»Lass mich offen mit dir reden, Paul.« Sie atmete tief durch. »Unsere Kinder waren nicht sehr lebenskräftig. Sie gingen von uns, ehe sie recht zu leben begannen, in das Reich, wo es kein Leid, keinen Schmerz, keine Klage, keine Mühsal und auch nie wieder Trauer geben wird.« Verzweifelt kämpfte sie mit den Tränen. »Auch unser Paul Friedrich, den uns Gott noch gelassen hat, ist ein Sorgenkind geblieben. Ich konnte ihm keine Muttermilch mehr geben. Und die beste Amme ersetzt keine Mutter. Ich weiß, was der Mutter ans Herz geht, ergreift auch die Seele des Vaters.«
Sie legte ihren Kopf an seine Brust und begann zu weinen.
»Ich fühle und weiß es, dass ich das Kind nicht großziehen kann. Seit seiner Geburt habe ich Schmerzen und Stiche in der Brust; sie werden immer heftiger. Bald wird der Herr mich rufen …«
Ein Weinkrampf erstickte ihre Worte, sie zitterte am ganzen Leib. Anna klammerte sich fest an ihren Mann. Paul Gerhardt war bis in die tiefste Tiefe seiner Seele erschüttert, dass er nur noch flehen konnte: »Anna, meine liebe Anna, verlass mich nicht! Nein, bitte noch nicht! Bitte, Anna! Bitte …!« Doch nach einer gewissen Zeit wurden beide gefasster. Wie eine Stimme aus einer anderen Welt klang es jetzt in ihm:
Was schadet mir des Todes Gift?
Dein Blut, das ist mein Leben.
Wenn mich des Schicksals Hitze trifft,
so kannst du Ruh mir geben;
setzt mir der Wehmut Schmerzen zu,
so find ich bei dir meine Ruh,
als auf dem Bett ein Kranker.
Und wenn des Kreuzes Ungestüm
mein Schifflein treibet um und um,
so bist du dann mein Anker.
Er hatte es anders niedergeschrieben; Schicksal litt er jetzt als Schickung vom Himmel. Als sich beide recht ausgeweint hatten, sagte Anna Maria glaubensfest: »Es sagt mir ganz deutlich eine innere Stimme, dass ich kaum den kommenden Winter überstehen werde. Mein herzinnigstes Gebet zu Gott ist, mir den Heimgang leicht zu machen. Ja, mir und euch ein qualvolles Siechtum zu ersparen.«
Paul Gerhardt hielt sie immer noch fest in seinen Armen. Er drückte sie fest an sich und flüsterte: »Du warst vom Himmel mir beschieden – wie schnell eilt doch die Zeit …«
»Diese Zeit ist die Mutter der Ewigkeit – wer nicht aus Gott geboren ist, der hat eine grausame Ewigkeit. Deshalb musst du leben, mein geliebter Mann, für unser Kind. Es muss auf den Pfad der Ewigkeit kommen. Ich will täglich vor dem Thron Gottes bitten, dass er euch beistehe und zum Segen für andere mache!«
»Ja, Anna, ich will mich fügen in Gottes unerforschlichen Ratschluss; den Trost erfasst das Herz und wird ein Balsam unserer Seele.«
Der Frieden des Himmels klang aus ihrer Stimme, als Anna Maria es ihrem frommen Liederdichter in Erinnerung brachte:
»Befiehl du deine Wege
und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege
des, der den Himmel lenkt.
Der Wolken, Luft und Winden
gibt Wege, Lauf und Bahn,
der wird auch Wege finden,
da dein Fuß gehen kann.«
»Diese Worte werden einst Millionen beten und singen, mein lieber Schatz. Sie werden sich an deinen Liedern innerlich aufrichten und trösten. Der Lohn des Himmels ist dir gewiss, mein treuer Mann.«
Es war ein stilles Jahr – voll Trauer und Gottesnähe. Paul Gerhardt hatte oft den Eindruck, als stünde zwischen ihm und Anna Maria schon der Engel der Herrlichkeit. Ihre Kräfte schwanden. Wenn sie ihren Mann umarmte, hing sie wie ein bleiernes Gewicht an ihm. Oft wollte der arbeitslose Pfarrer verzagen und in melancholischen Anwandlungen alles aufgeben. Sabina, die Schwester seiner Frau, führte den Haushalt, pflegte die Kranke, das Kind und den Vater. An einem düsteren Tag saß der Mann Gottes an seinem Schreibtisch. Er fühlte sich schon verlassen und einsam – da brach es in seinem Innern auf. Er nahm den Federkiel zur Hand und schrieb:
Wie soll ich dich empfangen,
und wie begegn ich dir,
o aller Welt Verlangen,
o meiner Seelen Zier?
An diesem Tag schien es überhaupt nicht hell werden zu wollen.
Paul Gerhardt starrte in den Nebel. Seit über einem Jahr hatte er keine Einnahmen mehr. Aber die Kraft des Heiligen Geistes entzündete in ihm ein heiliges Feuer:
O Jesu, Jesu, setze
mir selbst die Fackel bei,
damit, was dich ergötze,
mir kund und wissend sei.
Mit wohltuenden Seufzern fügte er Zeile um Zeile hinzu. Sein Leben stand ihm vor Augen, die Berg- und Talwanderungen der Jahrzehnte.
Ich lag in schweren Banden,
du kommst und machst mich los;
ich stand in Spott und Schanden,
du kommst und machst mich groß
und hebst mich hoch zu Ehren
und schenkst mir großes Gut,
das sich nicht lässt verzehren,
wie irdisch Reichtum tut.
Das martervolle Bild des geschlagenen, des gekreuzigten, des zur Sünde gemachten Gottessohnes erschien vor seinem geistigen Auge.
Nichts, nichts hat dich getrieben
zu mir vom Himmelszelt,
als das geliebte Lieben,
damit du alle Welt
in ihren tausend Plagen
und großen Jammerlast,
die kein Mund kann aussagen,
so fest umfangen hast.
Und so, als wollte er sich selbst ermahnen, sich selbst eine Lektion erteilen, fasste er zusammen:
Das schreib dir in dein Herze,
du hochbetrübtes Heer,
bei denen Gram und Schmerze
sich häuft je mehr und mehr;
seid unverzagt, ihr habet
die Hilfe vor der Tür;
der eure Herzen labet
und tröstet, steht allhier.
Im Nebenraum jubelte Paul Friedrich: »Mutter, wie schön ist es bei dir!«
»Sei still, der Vater arbeitet«, mahnte die besorgte Dulderin.
»Großer Gott«, stöhnte der Gottesmann, »was soll aus dem Kind werden? Wie wird es überhaupt weitergehen?« Da kam ihm die Predigt seines Meisters in den Sinn: »Darum sorget nicht für den andern Morgen, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe.« Nun neigte sich der Dichter über sein neues Lied und schrieb:
Ihr dürft euch nicht bemühen
noch sorgen Tag und Nacht,
wie ihr ihn wollet ziehen
mit eures Armes Macht.
Er kommt, er kommt mit Willen,
ist voller Lieb und Lust,
all Angst und Not zu stillen,
die ihm an euch bewusst.
Wochen waren vergangen. In der Adventszeit hatte der Kantor das Lied in Noten gesetzt. Für den Gemeindegebrauch wurden mehrere Abschriften in der Versammlung verteilt, sodass einige Belesene es singen konnten.
Am Weihnachtsfest saß Paul Gerhardt mit seinem Sohn und seiner Frau in der erleuchteten Kirche. Von allen Seiten grüßten ihn seine treuen Brüder und Schwestern der Gemeinde. Unter dem Schwall der Orgelklänge sangen sie miteinander:
»Er kommt zum Weltgerichte,
zum Fluch dem, der ihm flucht,
mit Gnad und süßem Lichte
dem, der ihn liebt und sucht.
Ach komm, ach komm, o Sonne,
und hol uns allzumal
zum ewgen Licht und Wonne
in deinen Freudensaal.«
Paul Gerhardt blickte empor zum Kruzifix. Er schaute in die gotischen Spitzbögen und sah seine Anna Maria im Freudensaal ankommen, umflutet vom ewigen Licht und unsagbarer Wonne. Scheu blickte er zur Seite – Anna Maria hatte ihre Augen geschlossen. Auf ihren bleichen Wangen sah er rötliche Flecken; sie schimmerten wie Rosen des Todes. Betend dachte der Liederdichter:
Ach komm, ach komm, o Sonne,