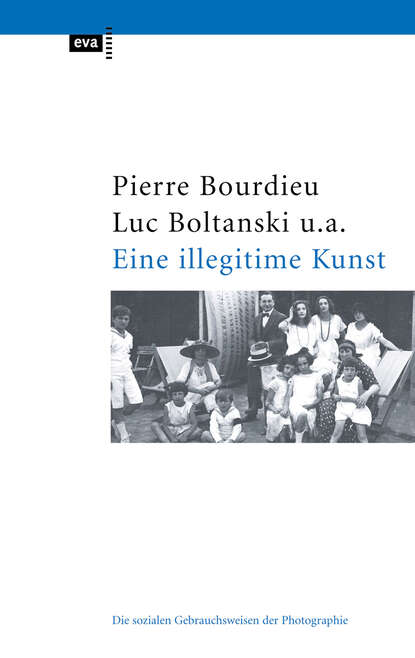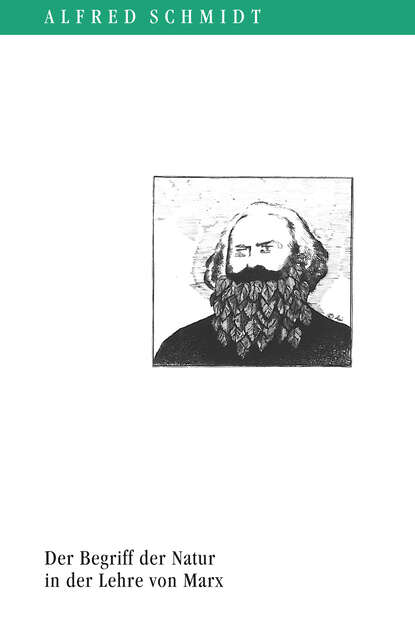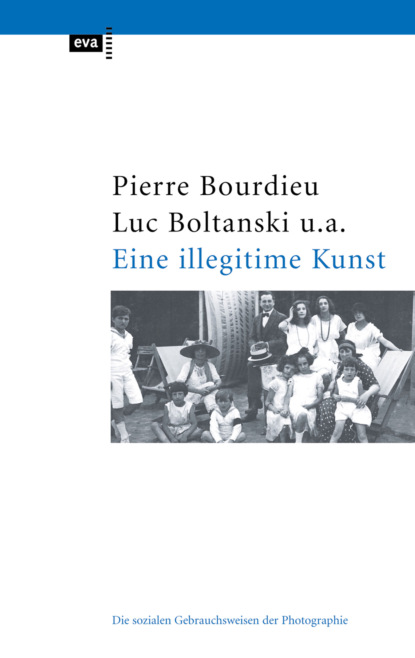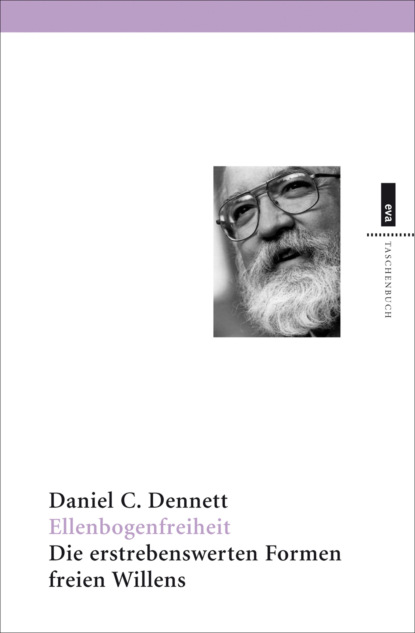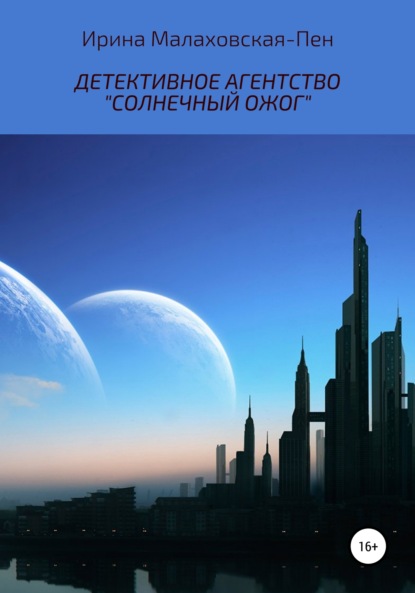Letzte Fragen
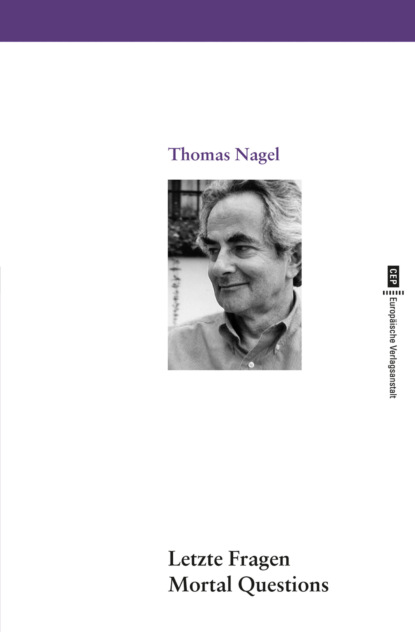
- -
- 100%
- +
Normalerweise laufen diese Vorgänge natürlich bei weitem nicht so geordnet ab – manchmal handelt es sich ja gerade um einen regelrechten Ausbruch – aber ich glaube, daß dieses sich überlappende System jeweils verschiedener sexueller Wahrnehmungen und Interaktionen in der einen oder anderen Ausprägung die Grundbedingungen jeder vollentwickelten sexuellen Beziehung ausmacht, und daß Beziehungen, die nur einen Teil dieses Komplexes umfassen, in einem signifikanten Sinne unvollkommen sind. Diese Darstellung ist lediglich schematisch, was indessen unvermeidlich ist, sofern Allgemeingültigkeit angestrebt werden soll. Jede wirklich sexuelle Handlung trägt weit spezifischere psychologische Züge und unterscheidet sich von anderen durch charakteristische Einzelheiten. Dafür sind nicht nur die angewandten physischen Techniken und anatomischen Besonderheiten verantwortlich, sondern auch eine Unmenge von Eigenheiten, die für das Bild charakteristisch sind, das die Beteiligten voneinander und von sich selbst haben, und die in die sexuelle Handlung eingehen. (Uns allen ist nicht unbekannt, daß Menschen nicht selten ihre eigenen sozialen Rollen mitsamt denen ihrer Partner mit ins Bett nehmen.)
Dennoch ist das allgemeine Schema von großer Bedeutung. Die darin enthaltenen Überwucherungen verschiedener Stadien wechselseitiger Wahrnehmung sind ein Beispiel für eine Art von Komplexität, die für menschliche Interaktionen typisch ist. Denken wir als Beispiel einmal an Aggression: Ärgere ich mich über jemanden, möchte ich ihn das auch spüren lassen. Entweder möchte ich, daß es bei ihm zu Selbstvorwürfen kommt, indem ich ihn dazu bringe, sich durch die Augen meines Ärgers zu sehen, und das, was er dabei sieht, selber abstoßend zu finden. Oder ich möchte bei ihm zu reziprokem Ärger oder zu Furcht Anlaß geben, indem ich ihn dazu bringe, meinen Ärger als eine Bedrohung oder als einen Angriff zu empfinden. Was ich erreichen will, hängt davon ab, weshalb und wie sehr ich mich ärgere, aber in beiden Fällen spielt der Wunsch eine Rolle, im Objekt meines Ärgers bestimmte Gefühle hervorzurufen. Die Befriedigung meiner Emotion besteht darin, daß ebendies gelingt; und zwar indem ich Herrschaft über die Gefühle meines Objekts ausübe.
Ein anderes Beispiel für ein solches reflexives wechselseitiges Erkennen finden wir im Phänomen des Bedeutens und der Bedeutung, denn bei ihm scheint die Absicht im Spiel zu sein, einer anderen Person eine Meinung oder andere Wirkung zu vermitteln, indem die Person auf ebendiese eigene Absicht, die Wirkung hervorzurufen, aufmerksam gemacht wird. (Diese Einsicht geht auf Grice3 zurück, dessen Position ich an dieser Stelle nicht im Detail referieren möchte.) Sexualität hat nun eine verwandte Struktur: Sie beinhaltet das Verlangen, daß der Partner dadurch erregt wird, daß er mein Verlangen nach seiner Erregung bemerkt.
Es ist nicht ganz leicht, die elementaren Typen des Gewahrens und der Erregung zu definieren, aus denen sich diese Komplexe zusammensetzen, und deshalb bleibt meine Diskussion lückenhaft. In gewissem Sinne ist das Objekt des Gewahrens im eigenen Fall dasselbe wie beim sexuellen Gewahren einer anderen Person, obwohl das Gewahren in beiden Fällen nicht dasselbe ist; der Unterschied ist ebenso beträchtlich wie der zwischen dem Gefühl, ärgerlich zu sein, und dem Gefühl, den Ärger einer anderen Person zu verspüren. Alle Stadien sexueller Wahrnehmung sind verschiedene Ausprägungen der Identifikation einer Person mit ihrem Körper. Es wird nämlich die eigene oder eines anderen Unterwerfung unter, respektive das eigene oder das andere Eintauchen in den Körper wahrgenommen, ein Phänomen, das von Paulus und Augustinus mit Widerwillen erkannt wurde – beide hielten »das Gesetz der Sünde in meinen Gliedern« für eine gravierende Bedrohung der Herrschaft des heiligen Willens.4 Für sexuelles Verlangen und dessen Äußerung ist das Verschmelzen von unwillkürlicher Reaktion mit bewußter Kontrolle von eminenter Wichtigkeit. Die Erektion, aber auch die anderen unwillkürlichen physischen Komponenten der Erregung, symbolisierten für Augustinus die Revolution, die sein Körper gegen ihn führte. Auch Sartre betont die Tatsache, daß der Penis kein willkürlich kontrolliertes Organ ist. Aber bloße Unwillkürlichkeit ist auch für andere körperliche Vorgänge charakteristisch. Beim sexuellen Verlangen verbinden sich unwillkürliche Reaktionen mit der Unterwerfung unter spontane Impulse: Nicht nur der Puls und die Sekretion, sondern auch die Handlungen unterliegen der Herrschaft des Körpers; im Idealfall ist willkürliche Kontrolle lediglich erforderlich, um die Äußerung jener Impulse in geeignete Bahnen zu lenken. Bis zu einem gewissen Grade trifft dies auch auf einen Trieb wie den Hunger zu, aber in diesem Fall übt der Körper eine beschränktere, weniger umfassende und weniger extreme Herrschaft aus.
Der Körper wird nicht auf dieselbe Weise ganz von Hunger ausgefüllt wie er von Verlangen durchdrungen sein kann. Aber die Eigenschaft, die das spezifisch sexuelle Eintauchen in den Körper am besten hervorhebt, besteht darin, daß dieser Vorgang sich in den schon beschriebenen Komplex wechselseitiger Wahrnehmung einzufügen vermag. Hunger führt zu spontanen Interaktionen mit Nahrung; sexuelles Verlangen hingegen führt zu spontanen Interaktionen mit anderen Personen, deren Körper ihre Souveränität in gleicher Weise geltend machen, indem sie unwillkürliche Reaktionen und spontane Impulse in ihnen hervorrufen. Diese Reaktionen werden wahrgenommen und ihre Wahrnehmung wird ihrerseits wahrgenommen, und auch diese Wahrnehmung wird wiederum wahrgenommen. In jedem Stadium wird die Herrschaft des Körpers über die Person gefestigt, und der Sexualpartner kann durch physische Berührung, Penetration und Umklammerung leichter in Besitz genommen werden.
Verlangen ist also nicht allein die Wahrnehmung einer immer schon vorhandenen Verkörperung einer anderen Person, sondern im Idealfall trägt es zu deren weiterer Verkörperung bei, die dann ihrerseits wiederum das ursprüngliche Sich-Selbst-Empfinden des Subjekts verstärkt. Dies erklärt, weshalb es so wichtig ist, daß auch der Partner erregt ist, und zwar nicht einfach nur erregt, sondern erregt durch die Wahrnehmung meines Verlangens. Und es wird auch erklärt, in welchem Sinne Vereinigung und Besitz das Objekt des Verlangens sind: Physische Inbesitznahme hat auf die Erschaffung des sexuellen Objekts im Spiegel des eigenen Verlangens zu zielen, nicht nur darauf, daß das Objekt sich meines Verlangens und seiner eigenen privaten Erregung bewußt wird.
Auch wenn dies ein korrektes Modell reifer Sexualität sein sollte, wäre es indes unplausibel, jederlei Abweichung davon als pervers zu bezeichnen. Geben sich zum Beispiel die Partner beim heterosexuellen Geschlechtsverkehr jeweils eigenen heterosexuellen Phantasien hin und umgehen sie auf diese Weise das Erkennen ihres eigentlichen Partners, handelt es sich nach unserem Modell um eine unvollkommene sexuelle Beziehung. Im allgemeinen gilt dies aber allemal noch nicht als Perversion. Solche Beispiele lassen vermuten, daß eine einfache Unterscheidung zwischen pervertierter und unpervertierter Sexualität zu stark nivelliert, um die Phänomene noch angemessen systematisieren zu können.
Doch eine ganze Reihe bekannter Abweichungen stellen verstümmelte oder unvollständige Abarten der vollständigen Konfiguration dar und können dann als Perversionen des wichtigsten Antriebs aufgefaßt werden. Wird sexuelles Verlangen daran gehindert, seine voll ausgeprägte zwischenmenschliche Form anzunehmen, ist es wahrscheinlich, daß es in anderer Form auftritt. Der Begriff der Perversion läßt darauf schließen, daß störende Einflüsse zu einer Abweichung von der normalen sexuellen Entwicklung geführt haben. Auf diese kausale Bedingung kann ich an dieser Stelle nicht ausführlich eingehen. Doch wenn Perversionen in einem gewissen Sinne unnatürlich sind, müssen sie sich aus einer Beeinträchtigung der Entwicklung einer Fähigkeit ergeben, die potentiell vorhanden ist.
Es ist schwierig, diese Bedingung anzuwenden, weil situationsbedingte Faktoren bei allen Menschen die Ausprägung der spezifischen Form des sexuellen Antriebs beeinflussen. Insbesondere frühkindliche Erlebnisse scheinen die Wahl des sexuellen Objekts stark zu beeinflussen. Wenn aber einige Kausaleinflüsse störend, andere dagegen lediglich formend sein sollen, dann heißt das, daß gewisse allgemeine Aspekte humaner Sexualität ein fest umrissenes Potential realisieren, während viele der Einzelheiten, in denen sich die Menschen voneinander unterscheiden, Realisierungen eines unbestimmten Potentials sind: Diese Einzelheiten lassen sich deshalb nicht in natürliche oder weniger natürliche klassifizieren. Die Frage, worin das fest umrissene Potential besteht, ist deshalb von größter Bedeutung, wenngleich die Differenzierung zwischen einem fest umrissenen und einem unbestimmten Potential unklar ist. Offensichtlich kann ein Wesen, das nicht dazu in der Lage ist, die von mir beschriebenen Stadien interpersoneller sexueller Wahrnehmung auszubilden, nicht dieses Mangels wegen als abweichend bezeichnet werden. (Wenngleich sogar ein Huhn in einem erweiterten Sinn pervers genannt werden könnte, sobald es aufgrund von Konditionierung eine fetischistische Fixierung auf ein Telefon ausbildete.) Aber wenn Menschen die Tendenz haben, irgendeine Form wechselseitiger interpersoneller sexueller Wahrnehmung zu entwickeln, können Fälle, in denen diese Entwicklung blockiert wird, durchaus als unnatürlich oder pervers klassifiziert werden.
Einige bekannte Abweichungen lassen sich auf diese Weise beschreiben. Narzißtische Praktiken und Geschlechtsverkehr mit Tieren, Kindern oder leblosen Gegenständen scheinen bei einer primitiven Form des ersten Stadiums sexuellen Fühlens stehengeblieben zu sein. Handelt es sich um einen unbelebten Gegenstand, bleibt das Erlebnis völlig auf die Wahrnehmung der eigenen sexuellen Verkörperung beschränkt. Bei kleinen Kindern und Tieren kann zwar die Verkörperung des anderen wahrgenommen werden, aber die Reziprozität stößt auf Hindernisse: Es ist schwerlich möglich, daß das sexuelle Objekt das Verlangen des Subjekts erkennt und daraufhin beginnt, sich selbst sexuell wahrzunehmen. Auch Voyeurismus und Exhibitionismus sind unvollständige Beziehungen. Der Exhibitionist hat den Wunsch, sein eigenes Verlangen zur Schau zu stellen, braucht aber dabei selbst nicht verlangt zu werden; er kann sich sogar davor fürchten, die sexuelle Aufmerksamkeit anderer zu erregen. Und für einen Voyeur ist es nicht einmal notwendig, überhaupt von seinem Objekt wahrgenommen zu werden und schon gar nicht, daß das Objekt seine Erregung wahrnimmt.
Wenden wir unser Modell hingegen auf die unterschiedlichsten Formen heterosexuellen Geschlechtsverkehrs zwischen zwei erwachsenen Partnern an, scheint überhaupt keine dieser Ausprägungen mehr eindeutig als Perversion gelten zu können. In unseren Tagen findet sich kaum noch jemand, der etwas gegen Oralverkehr einzuwenden hätte, und so angesehene Persönlichkeiten wie die Schriftsteller Lawrence und Mailer haben die Vorzüge des Analverkehrs angepriesen. Anscheinend kann im Prinzip also jeder körperliche Kontakt zwischen einem Mann und einer Frau, der für beide mit sexueller Lust verbunden ist, ein mögliches Medium für das System jener mehrstufigen interpersonellen Wahrnehmung darstellen, in dem, wie ich dargelegt habe, der grundlegende psychologische Gehalt sexueller Beziehungen besteht. Mithin stützt unsere Analyse einen liberalen Gemeinplatz zu diesem Thema.
Die wirklich schwierigen Fälle sind Sadismus, Masochismus und Homosexualität. Die ersten beiden werden weiterhin als Perversionen aufgfaßt, über Homosexualität herrscht Uneinigkeit. In allen drei Fällen hängt das Problem teilweise mit kausalen Faktoren zusammen: Ergeben sich die fraglichen Dispositionen nur dann, wenn die normale Entwicklung gestört worden ist? Aber weil in dieser Frage das Wort »normal« vorkommt, ist sie schon der Form nach zirkulär. Es zeigt sich, daß wir ein unabhängiges Kriterium für einen störenden Einfluß benötigen, aber über kein solches verfügen.
Vielleicht ist es möglich, Sadismus und Masochismus als Perversionen zu klassifizieren, weil dabei keine interpersonelle Reziprozität erreicht wird. Der Sadismus ist schließlich darauf ausgerichtet, passive Selbstwahrnehmung bei anderen hervorzurufen; aber die Handlungen des Sadisten sind aktiv und setzen voraus, daß willkürliche Kontrolle ausgeübt wird – und dadurch kann verhindert werden, daß er sich selbst im erforderlichen Sinn als ein körperliches Subjekt von Leidenschaften wahrnimmt. De Sade behauptet, das Ziel sexuellen Verlangens bestehe darin, unwillkürliche Reaktionen des Partners hervorzurufen, und zwar in erster Linie hörbare. Sicherlich ist die Zufügung von Schmerzen das wirksamste Mittel, dies zu erreichen, aber dabei ist es erforderlich, daß der Sadist seine eigene Spontaneität bis zu einem gewissen Grade einschränkt! Ein Masochist drängt dagegen seinem Partner dieselbe Unfähigkeit auf, die der Sadist sich selbst auferlegt. Der Masochist kann eine befriedigende Verkörperung nur als Objekt der Kontrolle einer anderen Person erfahren, nicht aber als Objekt ihres sexuellen Verlangens. Er verhält sich passiv nicht in Relation zur Leidenschaft seines Partners, sondern im Hinblick auf dessen nichtpassives Verhalten. Außerdem ist die für Schmerz und physischen Zwang charakteristische Unterwerfung unter den Körper von ganz anderer Art als sie für sexuelle Erregung typisch ist: Schmerz führt nicht etwa zu Gelöstheit, sondern zu Verkrampfung. Diese Beschreibungen sind vielleicht nicht in allen Fällen richtig. Aber in dem Maße, in dem sie zutreffen, stellen Sadismus und Masochismus Störungen im zweiten Stadium der Wahrnehmung dar, der Wahrnehmung von sich selbst als einem Objekt des Verlangens.
Homosexualität läßt sich indessen keinesfalls in derselben Weise aus phänomenologischen Gründen als Perversion einstufen. Es gibt hier nichts, wodurch die Entfaltung des gesamten Spektrums interpersoneller Wahrnehmungen zwischen Gleichgeschlechtlichen ausgeschlossen würde. Die Frage muß also in Abhängigkeit davon entschieden werden, ob Homosexualität auf störende Einflüsse zurückgeführt werden kann, welche die natürliche Tendenz zu einer heterosexuellen Entwicklung blockieren oder beeinträchtigen. Und die Einflüsse müßten dabei in weitaus höherem Grade störend sein als jene, die zu einer Vorliebe für große Brüste, für blonde Haare oder für dunkle Augen führen. Denn auch dabei handelt es sich um Zufälligkeiten der sexuellen Neigungen, in denen sich die Menschen voneinander unterscheiden, ohne allerdings pervers zu sein.
In Frage steht also, ob sich die männlichen und weiblichen Dispositionen naturgemäß heterosexuell äußern, sofern sie nicht gestört werden. Das ist eine recht dunkle Frage, und ich weiß nicht, wie man sie beantworten könnte. Mancherlei spricht tatsächlich für eine aggressiv-passiv Differenzierung zwischen männlicher und weiblicher Sexualität. In unserer Kultur löst gewöhnlich die Erregung des Mannes den Austausch der Wahrnehmungen aus; die sexuelle Annäherung geht meist von ihm aus, er kontrolliert großenteils den Verlauf des Akts und natürlich ist er es, der penetriert, während sie empfängt. Haben zwei Frauen oder zwei Männer Geschlechtsverkehr miteinander, können nicht beide zugleich an diesen sexuellen Rollen festhalten. Aber auch bei heterosexuellem Geschlechtsverkehr treten beträchtliche Abweichungen von diesen Rollen auf. Frauen können sich sexuell durchaus aggressiv und Männer passiv verhalten, und es ist nicht ungewöhnlich, daß in einem länger andauernden heterosexuellen Austausch zeitweilig die Rollen gewechselt werden. Aus diesen Gründen scheint es zweifelhaft zu sein, ob Homosexualität eine Perversion sein muß, wenngleich sie, und zwar nicht anders als die Heterosexualität, pervertierte Formen annehmen kann.
Ich möchte mit einigen Bemerkungen über das Verhältnis von Perversionen zum Guten, zum Schlechten und zur Moral schließen. Man kann sich kaum vorstellen, daß der Begriff der Perversion nicht in gewissem Sinne wertend sein sollte, denn er scheint mit dem Gedanken eines Ideals oder immerhin mit der Vorstellung einer erfüllten Sexualität zusammenzuhängen, die von Perversionen in der einen oder anderen Weise nicht erreicht werden kann. Soll der Begriff also haltbar sein, muß das Urteil, daß eine Person, eine Praxis oder ein Wunsch pervers ist, eine sexuelle Wertung ausdrücken; und das impliziert, daß eine bessere Sexualität oder eine bessere Form von Sexualität möglich ist. Dies allein ist noch eine recht schwache Behauptung, denn Wertung könnte ja auch in einer Dimension erfolgen, die für uns nur von geringem Interesse ist. (Vorausgesetzt, meine Überlegungen sind richtig, wird dies allerdings schwerlich der Fall sein.)
Es ist aber eine gänzlich andere Frage, ob es sich in diesem Falle um eine moralische Wertung handelt – eine Frage, deren Beantwortung ein tieferes Verständnis sowohl der Moralität als auch von Perversionen erfordern würde, als es hier erreicht werden kann. Die moralische Wertung von Taten und Personen ist eine eigentümliche und höchst verwickelte Angelegenheit, und bei weitem nicht jede unserer Bewertungen von Personen und ihren Tätigkeiten ist bereits eine moralische Wertung. Wir fällen über die Schönheit, die Gesundheit oder die Intelligenz anderer ein Urteil, das durchaus bewertend und gleichwohl nicht ethischer Natur ist. Beurteilungen menschlicher Sexualität mögen in dieser Hinsicht vergleichbar sein.
Darüber hinaus ist es – wenn wir moralische Fragen nun einmal beiseite lassen – keineswegs selbstverständlich, daß nichtpervertierte Sexualität etwa den Perversionen notwendigerweise vorzuziehen ist. Es könnte so sein, daß irgendeine Form von Sexualität, die wegen ihrer Vollkommenheit als Sexualität am höchsten einzustufen wäre, weniger lustvoll ist als gewisse Perversionen; und wenn Lust für sehr wichtig gehalten wird, könnte dieser Gesichtspunkt bei der Ermittlung rationaler Präferenz schwerer ins Gewicht fallen als Überlegungen, die Vollkommenheit betreffen.
Damit kommt die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem wertenden Gehalt von Urteilen über Perversionen und der eher alltäglichen generellen Unterscheidung von guter und schlechter Sexualität auf. Diese letztere Differenzierung beschränkt sich normalerweise auf sexuelle Akte, und es scheint, daß sie bis zu einem gewissen Grade unabhängig von der anderen Unterscheidung ist: Wer Homosexualität für eine Perversion hält, kann trotzdem zugestehen, daß man zwischen besserer und schlechterer homoerotischer Sexualität unterscheiden kann, und er könnte sogar anerkennen, daß gute homoerotische Sexualität bessere Sexualität sein kann als ziemlich schlechte ›nichtpervertierte‹ Sexualität. Stimmt dies, wird damit also die Ansicht gestützt, daß die Frage, ob etwas als Perversion zu beurteilen ist (immer vorausgesetzt der Begriff der Perversion sei haltbar), höchstens einen Aspekt möglicher Wertung von Sexualität, ja sogar von Sexualität qua Sexualität, abdeckt. Er ist nicht einmal der einzige wichtige Aspekt: Auch sexuelle Unvollkommenheiten, bei denen es sich offensichtlich nicht um Perversionen handelt, können von größter Wichtigkeit sein.
Und selbst wenn pervertierte Sexualität bis zu einem gewissen Grade nicht so gut wäre, wie sie es sein könnte, bliebe schlechte Sexualität allemal noch immer besser als gar keine. Dies sollte eigentlich unstreitig sein: Denn nichts anderes scheint auch für andere wichtige Dinge, etwa für Essen und Trinken, für Musik, für Literatur und für den Kontakt zu anderen Menschen zu gelten. Letzten Endes muß man ja unter den Alternativen wählen, die einem wirklich offenstehen, wobei es ohne Bedeutung ist, ob es auf das äußere Umfeld oder auf eigene Veranlagung zurückzuführen ist, daß einem gerade diese Alternativen offenstehen. Und die Alternativen müssen schon ungemein düster sein, bevor es vernünftig wird, sich für schlechterdings nichts zu entscheiden.
Übersetzt von Karl-Ernst Prankel und Ralf Stoecker.
Massenmord und Krieg
Apathische Reaktionen einer breiten Öffentlichkeit auf die von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten in Vietnam verübten Greuel lassen den Schluß zu, daß moralische Rücksichten bei der Kriegführung in der amerikanischen Bevölkerung ebensowenig Sympathie genießen wie unter den Verantwortlichen der US-Militärpolitik.1 Macht sich überhaupt einmal jemand für Restriktionen in der Kriegführung stark, dann gewöhnlich allein unter Berufung auf geltendes Recht. Die moralischen Fundamente solcher Beschränkungen verstehen indessen nur die wenigsten so richtig. Es wird mir im vorliegenden Kapitel um den Nachweis gehen, daß derlei Restriktionen weder rein konventioneller Natur sind noch willkürlich, und daß ihre Gültigkeit nicht einfach bloß auf ihrem Nutzen beruht. Es gibt mit anderen Worten selbst dann ein moralisches Fundament, auf dem all das gründet, was in einem Krieg verboten ist, wenn die bislang anerkannten völkerrechtlichen Konventionen noch weit davon entfernt sind ihm hinreichend Ausdruck zu verleihen.
I
Man benötigt keine ausgefeilte Moraltheorie, um zu erklären, was zutiefst unrecht ist an Bestialitäten wie dem Massaker von My Lai, denn weder dienten sie noch sollten sie überhaupt strategischen militärischen Zwecken dienen. Und ferner: Wenn die Beteiligung der Vereinigten Staaten am Indochinakrieg von vornherein immer schon unrecht war, dann kann dieses Engagement ohnehin nicht als Rechtfertigung für auch nur die mindeste ihm dienliche Maßnahme herhalten – geschweige denn für ›Maßnahmen‹, die sogar im gerechtesten aller Kriege nichts anderes wären als widerwärtige Greueltaten.
Doch im Vietnamkrieg gaben sich Einstellungen allgemeinerer Art zu erkennen, die bereits in der Vergangenheit die Führung von Kriegen beeinflußt haben. Und so stehen wir denn, sollte dieser Krieg eines Tages endlich hinter uns liegen, auch in der Zukunft vor dem Problem, wie denn ein Krieg grundsätzlich überhaupt geführt werden darf; und die Gesinnung, der die besondere Weise geschuldet ist, wie in Indochina Krieg geführt wurde, wird sich dann gewiß nicht in Luft aufgelöst haben. Mehr noch, weitgehend die gleichen ethischen Probleme können sich ebensogut bei Aufständen oder bei Kämpfen stellen, die aus ganz anderen Gründen und gegen ganz andere Gegner geführt werden, und es ist fürwahr nicht leicht, in seiner ethischen Überlegung an einem klaren Bild davon festzuhalten, was bei der Führung eines Krieges noch zulässig ist und was nicht. Schließlich gibt es neben all den Militäraktionen, bei denen es sich um offenkundige Verbrechen handelt, noch eine Reihe anderer Fälle, die weitaus weniger leicht einzuschätzen sind. Die allgemeinen Prinzipien, die unserem ethischen Werten zugrunde liegen, bleiben hier in ein Dunkel gehüllt, und ihre Obskurität mag uns dann dazu verleiten, Intuitionen eines durchaus gesunden Menschenverstandes zugunsten von Kriterien aufzugeben, deren Grundprinzip etwas offener zutage tritt. Will man dieser Versuchung widerstehen, bedarf man eines besseren Verständnisses der einschlägigen Restriktionen als wir es gegenwärtig besitzen.
Ich beabsichtige hier, das allgemeinste moralische Problem zu diskutieren, das sich stellt, sobald ein Krieg geführt wird: das Problem von Mittel und Zweck. Nach einer der vertretenen Auffassungen sind den Dingen, die im Krieg begangen werden dürfen, Grenzen gesetzt, und zwar gleichgültig wie erstrebenswert der erreichbare Zweck auch immer sein mag – ja, sogar gleichgültig wie teuer das Befolgen dieser Einschränkungen erkauft wird. Ein Mensch, der sich von der Evidenz solcher Restriktionen motivieren läßt, kann sich gegebenenfalls schon sehr bald in einem akuten moralischen Dilemma befinden. Er mag beispielsweise sicher sein, daß das Foltern eines Gefangenen ihm die nötigen Informationen verschaffen würde, um eine verheerende Katastrophe abzuwenden, oder daß das Flächenbombardement einer Siedlung einen terroristischen Feldzug zum Stillstand bringen wird. Ist er obendrein fest davon überzeugt, daß der Nutzen einer Maßnahme ihre Nachteile klar und deutlich überwiegt, und glaubt er dennoch, daß er die Maßnahme nicht ergreifen darf, gerät er in ein Dilemma – verursacht durch den Konflikt zweier disparater Kategorien ethischer Gründe: Wir können sie im folgenden als die beiden Kategorien der utilitaristischen und der absolutistischen moralischen Gründe bezeichnen.