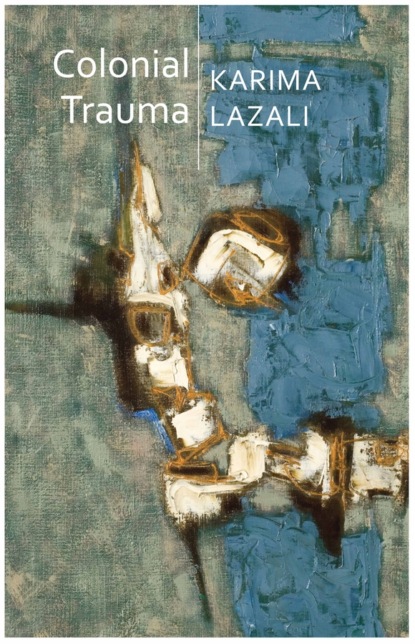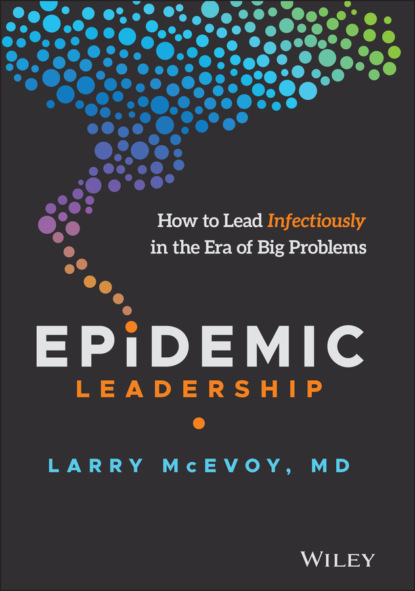- -
- 100%
- +
Wenn wir beispielsweise Sport treiben oder in Stress geraten, dann steigt das ANS aufs Gas und die Nervenfasern des Sympathikus beginnen zu feuern. Dabei werden seine Botenstoffe, die Neurotransmitter Adrenalin und Noradrenalin, ausgeschüttet. Der Körper schaltet in einen höheren Gang. Puls, Atemfrequenz und Blutdruck steigen an und der Muskeltonus erhöht sich, was manchmal als Verspannung im Nacken spürbar wird. Das System geht in die Erregungsphase über und sämtliche Energiereserven des Körpers werden mobilisiert. Gespeicherte Fett- und Kohlenhydratvorräte werden angezapft und in die Blutbahn abgegeben, damit die Zellen genügend Kraftstoff für die Verbrennung zur Verfügung haben. Je höher die Drehzahl des „Motors“, desto mehr Energie wird verbraucht. In der maximalen Sympathikusaktivierung schaltet der Körper auf Alarmstufe Rot und aktiviert die Flucht-, Kampf oder Erstarrungsreaktion. Jetzt geht es physiologisch ums nackte Überleben! Das Blut zieht sich aus den Verdauungsorganen zurück und strömt in die Arme und Beine. Keine Zeit für Verdauung und Nahrungsaufnahme, der Körper muss kämpfen oder flüchten!
Dieses evolutionär sehr alte Reaktionssystem hat sich entwickelt, um Situationen zu entkommen, in denen Leib und Leben bedroht sind. Solche Situationen gab es zu Zeiten der frühen Menschen bekanntlich viele, beispielsweise wenn Angriffe wilder Tiere das Leben unserer Vorfahren bedrohten. Heutzutage sind wir derartigen Bedrohungen kaum mehr ausgesetzt. Die heutigen Säbelzahntiger haben eher an unserem Arbeitsplatz Stellung bezogen, laufen über den Bildschirm der täglichen Nachrichten oder tragen den Namen eines streitsüchtigen Nachbarn. Unsere physische Existenz ist dabei nur selten in Gefahr. Die Stressantwort des Körpers ist allerdings nach wie vor dieselbe wie damals und sie verbraucht dabei Unmengen an Energie.
Was die Natur einst für kurze Ausnahmemomente entwickelte, ist heute für viele Menschen zum täglichen Normalzustand geworden. Das Gefühl, ständig innerlich angespannt zu sein, Verhärtungen der Nackenmuskulatur, erhöhter Blutdruck und schneller Puls sowie Schlafstörungen weisen auf diese erhöhte Aktivität des Sympathikus hin. In den Industrienationen ist das Leben in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr schnelllebig geworden. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass der Stresslevel kontinuierlich ansteigt. Deutlich veranschaulicht dies die hohe Anzahl stressbedingter Erkrankungen in den Arztpraxen. Im Unterkapitel „Die Sprache des Herzens verstehen“ werden wir sehen, wie eine Messung des Herzschlagmusters Auskünfte über die Funktionsweise des ANS gibt und wie wir durch den Einsatz der Atmung das Bremspedal der Entspannung, sprich den Parasympathikus, aktivieren und somit dem Stress entgegenwirken können. Die parasympathischen Nervenfasern mit ihrem Hauptnerv, dem Vagusnerv, sind nämlich zuständig für Reparatur und Erholung. Sämtliche Heilvorgänge des Körpers finden unter ihrem Einfluss statt. Der Parasympathikus bringt Ruhe ins System, und ist er aktiv, so sinken Blutdruck und Herzfrequenz und die Verdauungsorgane werden gut durchblutet. Nährstoffe aus der Nahrung können so optimal aufgenommen und im Körper verteilt werden, sämtliche Energiereserven werden wieder aufgebaut. Seine größte Wirkung entfaltet der Parasympathikus dabei im Schlaf. Gehen wir zu Bett, dann stellen wir den Motor unserer Karosserie in seiner Reparaturwerkstatt ab und lassen den Parasympathikus für ein paar Stunden an den heilenden Schrauben drehen.
Ausreichender und erholsamer Schlaf ist für unseren Körper also genauso bedeutsam wie regelmäßige Aktivierungsphasen. Unsere Gesundheit ist getragen von einer Balance im autonomen Nervensystem und dem lebendigen Spiel der beiden Kräfte Anspannung und Entspannung. Übermäßiger Stress bringt diese Balance allerdings aus dem Gleichgewicht und dies hat negative Auswirkungen auf unser Immunsystem. Sehen wir uns nun an, wodurch die Stressspirale des Körpers in Gang gesetzt wird und wie sich akuter und chronischer Stress auf die Immunzellen auswirkt.
DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
• Das autonome Nervensystem passt den Körper an die Anforderungen des gegenwärtigen Moments an.
• Für diese Anpassungsmechanismen besitzt es ein Gas- und ein Bremspedal.
• Der Sympathikus gibt Gas und erregt den Körper.
• Der Parasympathikus bremst den Körper und beruhigt ihn; er sorgt für Regeneration und Erholung.
• Eine ausgewogene Balance im ANS ist wesentlich für die körperliche Gesundheit.
Stress und seine Folgen – das Universum der Psychoneuroimmunologie
2006 war ein herausfordernder Sommer für die Notfallambulanzen im Großraum München. An vereinzelten Tagen zwischen dem 9. Juni und dem 9. Juli schienen die Krankenhäuser förmlich überzugehen mit Patienten, die mit akuten Herzerkrankungen eingeliefert wurden. Speziell an sieben Tagen dieses Zeitraums verzeichnete die Notfallstatistik einen Anstieg an lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen auf das Dreifache und es wurden mehr als doppelt so viele Herzinfarkte registriert wie zu anderen Zeiten.1
Für das medizinische Personal war diese unvorhergesehene Arbeitsbelastung doppelt bitter, denn viele hätten sich über vereinzelte Arbeitspausen gefreut, um wenigstens ein paar Minuten der Fußball-WM-Spiele im Fernsehen zu verfolgen, die gerade im eigenen Land stattfanden. Doch leider schienen die Patientenzahlen immer genau an jenen Spieltagen zu explodieren, an denen die eigene Nationalmannschaft ums Weiterkommen kämpfte. Das Viertelfinale am 30. Juni, in welchem Deutschland Argentinien in einem Elfmeterkrimi bezwang, brachte die allermeisten Herzen mit Blaulicht in die Spitäler! Interessanterweise waren Männer deutlich mehr von dieser Aufregung betroffen und wurden beinahe doppelt so häufig eingeliefert wie Frauen.
Kann man sich wirklich „zu Tode aufregen“? Die Forschung sagt Ja. Emotionen treiben das autonome Nervensystem an, aktivieren den Sympathikus und können Blutdruckkrisen und Entzündungsvorgänge im Körper befeuern, die Herzinfarkte auslösen. Wie stark die Wirkung von Emotionen auf die Physis sein kann, zeigt der Anstieg an Herzattacken deutscher Patienten ausschließlich an jenen Tagen, an denen die deutsche Nationalelf spielte. An den restlichen Spieltagen der vierwöchigen WM, die ohne deutsche Beteiligung stattfanden, wurde die sonst übliche Anzahl an akuten Herzerkrankungen registriert. Allein das Finale zwischen Italien und Frankreich, bei dem es ebenfalls zu einer deutlichen Zunahme kardiovaskulärer Ereignisse in der deutschen Bevölkerung kam, bildete eine Ausnahme. Das einzige Match der eigenen Mannschaft, das die Deutschen emotional wenig zu kümmern schien, war das Spiel um Platz drei, das Deutschland gegen Portugal 3:1 gewann. Dieses weniger bedeutsame „kleine Finale“ ließ die deutschen Herzen kaum höherschlagen und in den Notaufnahmen blieb es ruhig.
Stress – eine reine Kopfsache?
Dieses Beispiel zeigt, wie stark emotionaler Stress unsere körperliche Gesundheit gefährden kann und wie bedeutsam es ist, diesem Stress bewusst gegenzusteuern. Stress ist in unserer Zeit in aller Munde und scheint für viele ein dauerhafter Begleiter zu sein. Der Begriff Stress beschreibt jedoch prinzipiell nichts Negatives. Einer der bekanntesten Stressforscher, der gebürtige Österreicher Hans Selye, definierte Stress einst als natürliche Anpassungsreaktion des Körpers auf jegliche Anforderung. Die Anforderung wird dabei als Stressor bezeichnet. Kann der Organismus sich an die Anforderung anpassen und ein neues Gleichgewicht herstellen, dann spricht man vom Eustress. Diese Form von gesundem Stress kann sogar sehr belebend sein und für unsere körperlich-geistige Entwicklung sozusagen die Würze in der Suppe. Nehmen die Stressoren allerdings überhand und übersteigen sie unsere körperlich-geistigen Ressourcen, dann erleben wir den negativen Stress, auch Distress genannt. Wenn ich im weiteren Verlauf von Stress spreche, dann meine ich diesen gesundheitsschädigenden Distress, der unsere Adaptationsfähigkeit übersteigt und das System aus der Balance bringt.
Bevor wir die Auswirkungen von Stress auf den Körper genauer betrachten, ist es wichtig, zwischen „externen“ und „internen“ Stressoren zu unterscheiden. Externer Stress entsteht, wenn irgendetwas in der Welt um uns herum geschieht, das in uns Stress erzeugt. Dies kann eine Erkrankung oder der Tod eines geliebten Angehörigen sein. Ein Jobverlust oder hoher Arbeitsdruck im Beruf. Streitigkeiten mit dem Partner oder den eigenen Kindern, die intensive Pflege eines Familienmitgliedes und vieles mehr. Der Körper reagiert hierbei mit Stress als Folge eines Geschehnisses in der Außenwelt. Davon unterscheiden lässt sich „interner“ Stress, den wir uns in Form von negativen Gedanken und Emotionen selbst machen. Wir Menschen haben dank unserer Großhirnrinde, dem Neocortex, die erstaunliche Gabe, uns das Leben durch negative Gedanken selbst zu vermiesen. Und wir machen tagtäglich mehr oder weniger von dieser Fähigkeit Gebrauch. Wir haben bereits gesehen, wie vor allem das Bewerten und das angstbesetzte Zukunftsdenken Sorgenspiralen in Gang setzen können. Schuldgefühle, aber auch die Angewohnheit, uns ständig mit unseren Mitmenschen zu vergleichen, sind weitere Garanten für negative Emotionen und innerlichen Stress. Hinzu kommt die reichhaltige Palette an Selbstzweifeln und negativen Glaubenssätzen, die uns suggerieren, den Anforderungen der Welt nicht gerecht zu werden. Auch die Angst vor Krankheiten ist ein großer interner Stressfaktor, der viele Menschen von einer Untersuchung zur nächsten hetzen lässt, um „ja auf Nummer sicher zu gehen“.
Die heutige Forschung zeigt, dass solch „interner Stress“ in Form von negativen Gedanken die Stressreaktion des Körpers in gleichem Maße aktiviert wie reale Bedrohungen der Außenwelt. Letztlich aber führt jeglicher externe Stressfaktor über die Art und Weise, wie wir über ihn denken und diesen Lebensumstand bewerten, schließlich zu internem Stress und setzt folglich die Stressreaktion in Gang. Im Umkehrschluss können wir daher auf jegliche Art von Stresserleben positiven Einfluss nehmen, und zwar über unsere Art zu denken und zu fühlen.
Wenn das Angstzentrum feuert
In unserem Gehirn gibt es eine ganz zentrale Struktur, die darüber „entscheidet“, ob die Stressreaktion eingeleitet wird oder nicht. Es handelt sich um den Mandelkern, die Amygdala, eine paarig angelegte Region im Gehirn, die gemeinhin als „das Angstzentrum“ bezeichnet wird. Sie spielt bei der Emotionsverarbeitung im Allgemeinen, insbesondere jedoch bei Angst und Aggression, eine ganz zentrale Rolle. Als biologischer Radar für Gefahren springt die Amygdala immer dann an, wenn wir irgendeine Form von Bedrohung wahrnehmen, ob nun real in der Außenwelt oder erdacht in der Innenwelt.
Sämtliche Informationen der Außenwelt, die wir über die Sinnesorgane aufnehmen, gelangen über den Thalamus, das sogenannte „Tor zum Bewusstsein“ zur Amygdala. Bei akuten Bedrohungen wird die Amygdala auf direktem Weg, ohne Umschweife aktiviert und leitet ein blitzschnelles Reaktionsmanöver ein. Sind Sie schon einmal beim Anblick einer großen Spinne oder Schlange ganz plötzlich zur Seite gesprungen und wurde Ihre groteske Bewegung dabei gar von einem unbeabsichtigten Kreischen begleitet? Dann haben Sie erlebt, wie die Amygdala in Sekundenbruchteilen die Führung über den Körper übernimmt und das bewusste Denken umgeht. Diese automatisierten Reaktionen sind evolutionär tief in unser Gehirn einprogrammiert und ausgesprochen sinnvoll, da sie unser Überleben sichern. Ohne unseren vergleichsweise langsamen Denkapparat beanspruchen zu müssen, „entscheidet“ die Amygdala in bedrohlichen Situationen für uns und leitet eine lebensrettende Stressreaktion ein.
Die mit Abstand häufigsten Gründe für die Aktivierung der Amygdala sind in den Industrienationen allerdings psychologischer Natur. Nicht plötzlich auftauchende wilde Tiere befeuern das Angstzentrum, sondern das eigene Denken. Denn nicht nur Informationen der Außenwelt, sondern auch die Inhalte unserer Gedanken und Emotionen landen bei der Amygdala und sie entscheidet dann vereinfacht gesagt darüber, ob es sich bei diesen Informationen um ein potenziell bedrohliches Szenario handelt oder nicht. Wird das, was wir äußerlich oder innerlich erleben, als ungefährlich und harmlos eingestuft, dann bleibt die Amygdala ruhig und der Parasympathikus dominiert als nervlicher Ruhepol das Geschehen. Der Körper entspannt sich. Wenn aber das, was wir gerade erleben, ob real oder in Gedanken, eine Bedrohung darstellt, dann wird die Amygdala hochaktiv und versetzt das Gehirn in Alarmbereitschaft. Sie schickt ein Signal an den Hirnstamm, der auch gerne als Reptiliengehirn bezeichnet wird, was zur Aktivierung des Sympathikus führt. Noradrenalin flutet das Gehirn und die Nebenniere beginnt, Adrenalin und Kortisol in die Blutbahn auszuschütten. Diese Stresshormone bewirken nun, dass der Körper in den überlebenswichtigen Flucht- oder Kampfmodus übergeht. Was kurzfristig dem Überleben dient, wirkt sich langfristig jedoch negativ auf unsere Gesundheit aus. Erhöhter Blutdruck sowie ein Anstieg der Blutzucker-und Fettwerte sind die Folge und begünstigen die Gefäßverkalkung. Die Umlenkung des Blutstroms hin zur Arm- und Beinmuskulatur und weg von den Bauchorganen hat zur Folge, dass die Magenschleimhaut schlechter durchblutet wird und eine dünnere Schutzschicht aufbaut. Die aggressive Magensäure kann die Magenschleimhaut dadurch stärker angreifen, weshalb ein permanent hoher Stresspegel zu einer Magenentzündung oder gar einem Magengeschwür führen kann. Viele andere gesundheitsschädigende Folgen sind zudem auf Veränderungen des Immunsystems zurückzuführen, welches durch Stress gehörig aus der Balance gerät.
Stress und Immunsystem – von Schwertkämpfern und Bogenschützen
Seit dem Ende des letzten Jahrtausends gewinnt eine neue Forschungsdisziplin immer größere Bedeutung in der Medizin: die Psychoneuroimmunologie. Dieses Forschungsfeld gibt uns zunehmend Einblicke in die Verzahnung der Psyche mit den Funktionsweisen des Immunsystems und zeigt uns dadurch, wie Körper und Geist zusammenspielen und permanent ineinandergreifen.
Stellen Sie sich das Immunsystem einmal vor wie eine Streitmacht, die unseren Körper vor Eindringlingen bewahrt und im Sinne des Katastrophenschutzes zur Stelle ist, wenn Reparatur-und Heilvorgänge im Körper notwendig sind. Wie ein altertümliches Heer auf dem Schlachtfeld steht diese Verteidigungsarmee einer Schar von Abertausenden feindlichen Angreifern gegenüber. Während Viren, Bakterien und Parasiten auf der Gegenseite Stellung beziehen, formieren sich die Zellen des Immunsystems zu unterschiedlichen Kampfeinheiten mit jeweils hoch spezialisierten Waffen. Das Immunsystem besteht dabei im Wesentlichen aus zwei Teilen: der Nahkampfeinheit, die als vorderste Frontlinie die Angreifer „mit Schilden und Schwertern“ attackiert, und den Bogenschützen, die in zweiter Reihe aus der Ferne wirken.
Die Frontkämpfer werden in der Medizin das angeborene Immunsystem genannt, weil sie uns bereits von Geburt an in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Sie bekämpfen Viren und Bakterien und sorgen für die Wundheilung. Aber auch die Krebszellenbekämpfung gehört zu den Aufgaben dieser Zellen: Das angeborene Immunsystem erkennt mutierte Zellen, die laufend im Körper entstehen, und zieht sie sofort aus dem Verkehr. Diese wichtige Verteidigungslinie wird durch akuten Stress leider erheblich geschwächt.
Zu Beginn einer Stresssituation nimmt die Aktivität des angeborenen Immunsystems durch die Ausschüttung von Noradrenalin zunächst kurz zu. Wir erkennen dies an vermehrten Entzündungsreaktionen, die die Alarmbereitschaft des Körpers signalisieren. Besteht die stresshafte Situation jedoch fort, wird zusätzlich Kortisol aus der Nebennierenrinde ausgeschüttet. Dieses Hormon pfeift die Frontkämpfer wieder hinter die Angriffslinie zurück. In der Folge verringert sich die Abwehrleistung gegenüber Viren und die Wundheilung verzögert sich.
Dieser Effekt wurde durch viele Studien belegt und ließ sich anhand eines Versuchs mit Zahnmedizinstudenten in den USA sehr anschaulich und eindrucksvoll nachweisen. Die Wissenschaftler wollten dabei herausfinden, wie sich Stress auf die Geschwindigkeit der Wundheilung auswirkt. Zu diesem Zweck wurden Studierende der Zahnheilkunde in ein Labor gebeten, wo sie sich einem ungewöhnlichen Prozedere unterziehen mussten. Es wurde ihnen mit dem Skalpell ein 3,5 mm breiter und 1,5 mm tiefer Schnitt am harten Gaumen gesetzt. Zu allem Überdruss mussten die Probanden diese Prozedur sogar zwei Mal über sich ergehen lassen: einmal in der prüfungs- und vorlesungsfreien Zeit und ein weiteres Mal drei Tage vor der ersten großen Semesterprüfung. Die Forscher untersuchten, wie sich der subjektiv empfundene Stresslevel der Studenten, den sie mit Messungen des Kortisolspiegels und psychologischen Fragebögen objektivierten, auf den Verlauf der Wundheilung auswirkte. Das Ergebnis war erstaunlich: In der Ferienzeit dauerte es im Durchschnitt lediglich acht Tage, bis sich die Wunden wieder vollständig verschlossen hatten. In der stressigen Prüfungszeit brauchten die Wunden durchschnittlich elf Tage und somit drei Tage länger, um sich vollständig zu verschließen. Es kam also zu einer Wundheilungsverzögerung von etwa 40 Prozent, nur durch Stress! 2
Schon wieder krank im Urlaub
Wenn wir Schnupfen, Fieber und andere Erkältungssymptome haben, dann ist dies meist keine direkte Wirkung der pathogenen Viren oder Bakterien. Die Krankheitssymptome entstehen vielmehr durch die Aktivität der Immunzellen. Sie schütten Botenstoffe aus, sogenannte Entzündungsmediatoren, die dabei helfen, die betreffenden Keime zu beseitigen. Sozusagen als unerwünschte Nebenwirkung lösen die Entzündungsmediatoren jedoch Krankheitssymptome aus wie die klassischen Entzündungsreaktionen Rötung, Schwellung, Überwärmung und Schmerzen. Diese Symptome sind nicht nutzlos, denn sie zwingen uns vernünftigerweise zur Ruhe, um dem Immunsystem genug Energie für die Heilung zur Verfügung zu stellen.
Ist das angeborene Immunsystem stressbedingt jedoch unterdrückt, dann treten auch weniger Entzündungsreaktionen auf. So kann es in Zeiten hoher Stressbelastung einerseits leichter zu einer Virusinfektion kommen, da die Abwehrfront weniger aktiv ist, andererseits kann dieser Infekt oft weniger symptomatisch verlaufen. Erst wenn die Anspannung nachlässt, die Stresshormone wieder sinken und Ruhe und Entspannung in unser Leben einkehren, kommt es dann zum Ausbruch der Symptome. Jetzt werden die Frontkämpfer wieder lebendig und das Immunsystem hat Zeit und Kraft, den Infekt zu bekämpfen. Deshalb treten sehr häufig zu Beginn eines Urlaubes entsprechende Krankheitssymptome auf. Der Körper nutzt die Pause, um zu reparieren, was lange aufgeschoben wurde.
Ein mittelfristig hoher Stresspegel vermag also die Frontkämpfer des angeborenen Immunsystems in ihrer Aktivität herunterzuregulieren. Die Bogenschützen allerdings blasen zum Kampf.3 Sie gehören zum sogenannten „erworbenen Immunsystem“, weil sie sich erst nach der Geburt entwickeln und bis ins hohe Alter immer neue Verteidigungsstrategien erwerben. Ihre Pfeile werden in der Medizin Antikörper genannt. Sie schwächen beziehungsweise markieren die feindlichen Erreger, damit die Frontkämpfer sie leichter besiegen können. Dieser antikörperproduzierende Teil des Immunsystems wird unter dem Einfluss der Stresshormone überaktiv und die Bogenschützen beginnen, wild um sich zu schießen. Dabei werden auch Zellen des eigenen Körpers in Mitleidenschaft gezogen. Dies geschieht immer dann, wenn Teile des Immunsystems überreagieren, wie das bei Erkrankungen mit allergischer Komponente der Fall ist.4 Dies ist der Grund, warum starker emotionaler Stress zur Entstehung allergischen Asthmas,5 aber auch zu vermehrten Neurodermitis-Schüben führen kann.6, 7
Chronischer Stress und Burn-out – das Immunsystem kippt zur Gegenseite
Wenn der Stress nicht endet und wir über viele Monate oder gar Jahre einem hohen Stresspegel ausgesetzt sind, dann drohen wir nicht nur psychisch, sondern auch körperlich auszubrennen. Die Nebenniere geht sozusagen ebenfalls in den Burn-out und kann die Kortisolproduktion nicht mehr aufrechterhalten. Zusätzlich beginnen sich die Körperzellen bei einem über lange Zeit erhöhten Kortisolspiegel abzuschotten und entwickeln in der Folge eine gewisse Resistenz, wodurch die Wirkung des Kortisols weiter abnimmt. Nun kommt es zu einer Dysbalance des Immunsystems in die Gegenrichtung. Die Bogenschützen ziehen sich zurück und die Nahkampfeinheit wird jetzt überaktiv. Die Frontkämpfer des angeborenen Immunsystems beginnen, im Körper um sich zu schlagen, und erzeugen dadurch eine sogenannte „Silent Inflammation“, also eine stille Entzündung, die chronisch verläuft. Chronischer Stress und damit einhergehende chronische Entzündungsprozesse spielen eine wesentliche Rolle bei der Entstehung, aber auch der Aufrechterhaltung vieler chronischer Erkrankungen. Dazu zählen die Gefäßverkalkung, die Arteriosklerose mit ihren Folgekrankheiten Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall, aber auch die Rheumatoide Arthritis.8 Schließlich wird auch die Zellalterung durch Langzeitstress deutlich beschleunigt.9 Dies hat mit den Telomeren, den Endstücken unserer DNA, zu tun. Sie verkürzen sich unter Stress bei jeder Zellteilung deutlich schneller, wodurch die Körperzellen früher in den Ruhestand gehen.
Emotionen und Immunsystem – die immunologische Macht der Gefühle
Das Zusammenspiel von Stresshormonen und den unzähligen Zellen des Immunsystems ist hochkomplex. Viele Effekte sind noch nicht vollständig verstanden und scheinen sogar widersprüchlich zu sein. Zusammenfassend lässt sich heute sagen, dass akuter Stress und chronischer Stress jeweils unterschiedliche Auswirkungen auf unseren Körper haben. Wenn der Stresspegel entweder zu hoch ist oder zu lange andauert, vermag er das Körpersystem aus der Balance zu bringen. Destruktive Gedanken und negative Emotionen spielen hier eine entscheidende Rolle, da sie die Ursache für inneren Stress sind und den Stresshormonpegel erhöhen.
Eine Londoner Studie, in der 216 britische Beamtinnen und Beamte auf ihren Grad an positiver und negativer Lebenseinstellung untersucht wurden, konnte diesen Zusammenhang eindeutig belegen.10 Das emotionale Befinden der Studienteilnehmer wurde zu mehreren Zeitpunkten sowohl an Werktagen wie auch an Wochenenden erhoben. Zusätzlich dokumentierten die Forscher das subjektive Stresserleben, aber auch den Kortisolspiegel im Speichel, denn sie wollten herausfinden, inwiefern die Qualität der Emotionen mit der Höhe des Stresshormonpegels im Körper zusammenhängt. Dabei zeigte sich, dass die Kortisollevel der unglücklichsten Probanden um ein Drittel höher lagen als jene der zufriedensten Kollegen. Auch das subjektive Stresserleben war unter den unglücklichen Individuen deutlich höher als jenes der Glücklichen.
Nun stellt sich die Frage, ob etwa positive Emotionen auf der anderen Seite auch eine positive Auswirkung auf unsere Gesundheit haben können. Eine faszinierende Untersuchung bestätigte diesen Verdacht.11 Hierbei wurden 334 gesunde Probanden mehrmals wöchentlich über zwei Wochen lang zu ihrem emotionalen Befinden befragt. Zusätzlich mussten sie ihre positiven und negativen Emotionen des jeweiligen Tages aufzeichnen. Darüber hinaus mussten sie angeben, wie häufig sie generell in ihrem Leben positive beziehungsweise negative Emotionen erlebten. Anhand dieser Befragungen und einer anschließenden Analyse durch ein ausgeklügeltes Verfahren wurden sie entweder der Gruppe des positiven emotionalen Stils oder des negativen emotionalen Stils zugeordnet. Mit diesem Verfahren konnten die Forscher sicherstellen, dass es sich bei den Emotionen der Betroffenen um langfristige emotionale Persönlichkeitsmerkmale handelte und nicht etwa um tagesabhängige Stimmungsschwankungen. Weitere Einflussgrößen auf die Gesundheit wie körperliche Bewegung, Rauchverhalten, Alkoholkonsum und mögliche Begleiterkrankungen wurden ebenfalls berücksichtigt. Nach der über Wochen andauernden Erhebung ihres emotionalen Empfindens wurden den Teilnehmern schließlich zwei Arten von Rhinoviren, also klassische Schnupfenerreger, in die Nase geträufelt. Anschließend mussten die Probanden fünf Tage lang in Quarantäne verbleiben. Täglich wurde nun jegliche Entwicklung von Infektionszeichen penibel dokumentiert, um herauszufinden, wie sehr sich der emotionale Stil auf die Abwehrleistung des Körpers gegenüber den Viren auswirkte. Die Menge an produziertem Nasensekret maßen die Forscher, indem sie gebrauchte Taschentücher wogen; sie erfassten Husten- und Schnupfensymptome und überwachten die Entwicklung von Antikörpern als Reaktion auf die Virusinfektion. Die Ergebnisse zeigten, dass die Teilnehmer mit den ausgeprägtesten positiven Emotionen eine dreimal geringere Erkältungsneigung hatten als die Probanden mit den negativsten Emotionen. Angesichts der Tatsache, dass bei Menschen mit ausgeprägt negativer emotionaler Stimmungslage erhöhte Kortisolwerte gemessen werden können, wodurch wiederum die virale Abwehrkette unterdrückt wird, bestätigten diese Untersuchungsergebnisse, dass Emotionen unsere Gesundheit wesentlich beeinflussen.