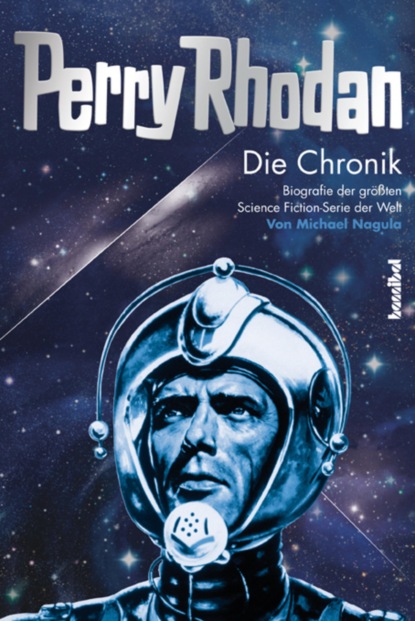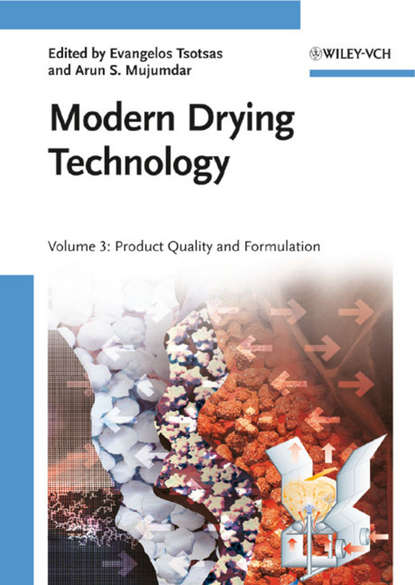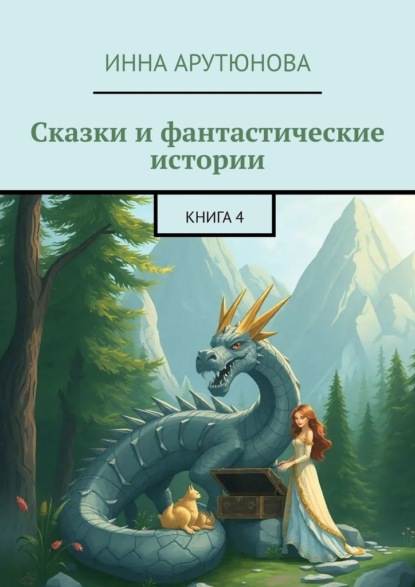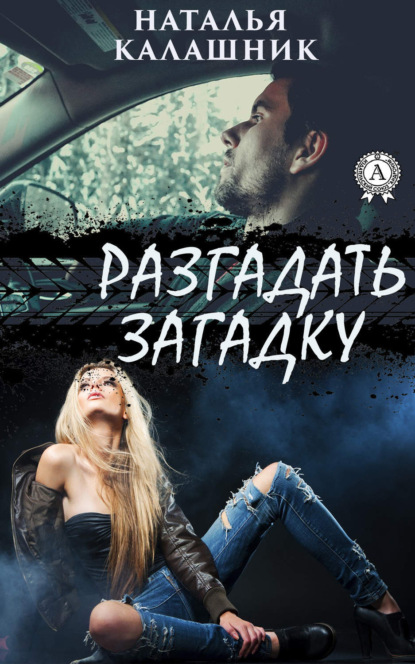- -
- 100%
- +
Was PERRY RHODAN vorausging
Die Welt war traumatisiert. Sie hatte gerade den bislang größten und verheerendsten Konflikt in der Menschheitsgeschichte hinter sich gebracht, den Zweiten Weltkrieg, bei dem sage und schreibe sechzig Millionen Menschen ums Leben gekommen waren, fast die damalige Bevölkerungszahl Deutschlands. Beinahe sechs Jahre lang hatte der Krieg gedauert, der in Europa im September 1939 mit den Angriffen des Deutschen Reiches und der Sowjetunion auf Polen begann und am 8. Mai 1945 mit der Kapitulation der Wehrmacht endete, aber die politischen und gesellschaftlichen Folgen für die gesamte Welt sollten noch Jahrzehnte später deutlich zu spüren sein.
Niemand war von dem Krieg verschont geblieben. Im Holocaust hatte das Dritte Reich zehn Millionen Menschen in Konzentrationslagern getötet, sechs Millionen Juden und vier Millionen Angehörige anderer Volksgruppen. Es war zu einer millionenfachen Entwurzelung in Form von Emigration, kriegsbedingter Flucht und Vertreibung ganzer Bevölkerungsgruppen gekommen. Alle Kriegsteilnehmer hatten immer neuartigere Waffen eingesetzt – zuletzt die noch von den Deutschen mitentwickelte Atombombe, die amerikanische Bomber auf Hiroshima und Nagasaki fallen ließen.
Die Sowjetunion gab in den folgenden Jahren über eine Million Kriegsgefangene frei, aber es dauerte bis 1955, ehe die letzten Zehntausend nach Deutschland heimkehrten. Sie fanden ein Land vor, das von vier Besatzungsmächten kontrolliert wurde: der Sowjetunion, den USA, Großbritannien und Frankreich. Und die Städte glichen noch immer Trümmerlandschaften, weil der Wiederaufbau nur mühsam vorankam.
Bei den Supermächten Sowjetunion und USA hatte das Kriegsende nicht gerade zu einem Ende globaler Machtansprüche oder einem Nachlassen ideologischer Zwangsvorstellungen geführt. Für beide war der jeweils andere des Teufels, und so polarisierten sich die weltanschaulichen Gegensätze und Machtinteressen im so genannten Kalten Krieg, der sich rasch auch auf den Weltraum ausdehnte. Der Weltraum war das neue Grenzland, in dem zunächst wenigstens symbolisch eine neue Vormachtstellung errungen werden konnte. Gleichzeitig war er der Inbegriff grenzenloser Freiheit, weil er noch völlig unerschlossen von Machtinteressen war.
Aber das sollte sich nun ändern. Am 4. Oktober 1957 begann mit dem Start von »Sputnik I« das Raumfahrtzeitalter, und die »Russen« hatten die Nase vorn. »Sputnik I« war der erste künstliche Erdsatellit. Zwei Jahre später, am 13. September 1959, war »Lunik II« der erste künstliche Flugkörper, der gezielt auf der Mondoberfläche aufschlug. Und am 12. April 1961 sollte mit dem ersten bemannten Raumflug von Juri Gagarin die Sowjetunion endgültig zur führenden Raumfahrtnation werden.
In dieser Situation, mitten im Kalten Krieg, suchte die USA nach einem Gebiet der Raumfahrt, auf dem sie ihren Konkurrenten schlagen konnten. Bereits im Juli 1960 hatte in Washington eine Konferenz stattgefunden, auf der die NASA und verschiedene Industriebetriebe einen Langzeitplan für die Weltraumfahrt erarbeiteten. Geplant war eine bemannte Mondumrundung – von einer Landung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Rede. Sie verabschiedeten ein Projekt, das den Namen Apollo trug – nach dem Gott der griechisch-römischen Mythologie, der als treffsicherer Bogenschütze galt.
Was blieb den USA jetzt, nach Gagarins erfolgreicher Erdumkreisung, noch übrig, um den »Russen« ihre Führungsposition in der Raumfahrt spektakulär wieder abzujagen? Nur die Landung auf dem Mond. Am 25. Mai 1961, eineinhalb Monate nach dem großen Erfolg der Sowjetunion, hielt der neue US-Präsident John F. Kennedy vor dem amerikanischen Kongress eine berühmte Rede, in der er eine Vision formulierte: »Ich glaube, dass diese Nation sich dem Ziel verschreiben sollte, noch vor Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf dem Mond landen und ihn sicher zur Erde zurückbringen zu lassen. Kein einziges Weltraumprojekt wird die Menschheit in dieser Zeit mehr beeindrucken und wichtiger für die Erforschung des entfernteren Weltraums sein; und keines wird so schwierig zu erreichen sein und so kostspielig werden.«
Nicht einmal vier Monate später lag an den Kiosken in Deutschland das erste PERRY RHODAN-Heft aus. Es handelte von vier entschlossenen Männern, die diese Vision leben und 1971 von Nevada Fields ins neue Grenzland aufbrechen – und die auf dem Mond in den Besitz einer fortgeschrittenen Technologie gelangen, die es ihnen ermöglicht, der Welt als »Dritte Macht« endlich den lange ersehnten Frieden zu bringen.

Kurt Bernhardts Überlegungen
In München brütete ein beleibter Redakteur, der nicht gerade für seine Sanftmut bekannt war, über einer neuen SF-Serie im Heftformat. Kurt Bernhardt, Jahrgang 1916, war schon ein alter Hase im Verlagsgeschäft. Lange Jahre hatte er beim Rastatter Heftverlag Pabel, dem Erzkonkurrenten des späteren PERRY RHODAN-Verlegers Moewig, die dortige Science Fiction-Sparte betreut – in Deutschland die erste ihrer Art! 1959 war er dann zum Wilhelm Heyne Verlag gewechselt, wurde dort als Cheflektor für den wachsenden Taschenbuchsektor tätig und betreute zudem die Heftreihen des angeschlossenen Moewig Verlags. Jetzt machte er sich Gedanken über die Zukunft – und die lag für ihn im Romanheft.
Der Hunger der Deutschen nach Unterhaltung wuchs nämlich zusehends. Stillen konnten die Menschen ihn aber, zumindest aus heutiger Sicht, bestenfalls notdürftig. Das Fernsehen steckte noch in den Kinderschuhen, Dutzende von Kanälen und Dauerberieselung schienen pure Science Fiction, Reisen und teure Hobbys kamen nur für wenige Begüterte in Frage. Dem Durchschnittsbürger blieben bescheidene Freuden: der gelegentliche Kinobesuch, das Radio und natürlich das Lesen.
Doch selbst hier mussten die meisten auf den Pfennig sehen: Gebundene Bücher waren sündhaft teuer, das Taschenbuch gerade erst erfunden und öffentliche Bibliotheken dünn gesät. Lesehungrige gingen stattdessen in die überall zu findenden gewerblichen Leihbüchereien. Für einige Groschen pro Woche konnte man dort Unterhaltungsware aller Art mieten, so genannte Leihbücher. Auf dickem, minderwertigem Papier gedruckt, mit grellen, effektheischerischen Titelbildern versehen, hatten sie aber im strengen und moralischen Klima der Fünfziger- und Sechzigerjahre etwas Anrüchiges. Viele Leihbücher wurden sogar indiziert.
Aufmerksamen Beobachtern wie Kurt Bernhardt entging nicht, dass die Leihbüchereien ihren Zenit bereits überschritten hatten. Im Aufstieg begriffen war hingegen der Heftromanmarkt. Zahllose Titel wetteiferten an den Kiosken um die Aufmerksamkeit der Leser. Ob Western, Heimat- oder Liebesroman, kaum ein Genre der Unterhaltungsliteratur wurde ausgelassen.
Im Bereich des Science Fiction-Hefts bestritten zwei Verlage den Löwenanteil der Publikationen, der Rastatter Erich Pabel Verlag mit UTOPIA und UTOPIA GROSSBAND sowie der Münchner Arthur Moewig Verlag mit TERRA und TERRA SONDERBAND. All diese Reihen waren zwischen 1953 und 1958 gestartet, und vom Konzept wie vom Design her ähnelten sich die Produkte. Man hatte anfangs auf meist gekürzte Übersetzungen englischer und amerikanischer Autoren gesetzt und später auf Nachdrucke deutscher Autoren aus den Leihbüchern. Dazu gesellte sich inzwischen eine immer größer werdende Anzahl deutscher Nachwuchsautoren, die versuchte, mit ihren angloamerikanischen Kollegen gleichzuziehen.
Was es noch nicht gab, waren Serien mit längeren, über zwei oder drei Hefte hinausgehenden Handlungsbögen. Der erste Versuch in diese Richtung, die Abenteuer des Weltraumhelden JIM PARKER, war bereits im Jahre 1957 eingestellt worden – nach immerhin 59 Ausgaben in nur vier Jahren. Die Qualität der Ideen hatte mit der englischsprachigen Konkurrenz einfach nicht mithalten können.
Es waren eher hausbackene Erlebnisse gewesen, die der forsche Titelheld und Raumfahrer, der mit seinem Kumpel Fritz Wernicke seinen Geburtstag zwischen Erde und Venus mit Waldmeisterlikör feierte, als Abenteuer verkauft hatte. Selbst in den spießigen Fünfzigern konnten sie niemanden so recht vom Hocker reißen. Außerdem unterschieden sie sich von Band zu Band nur unwesentlich, was auch daran lag, dass die Serie von einem einzigen Autor geschrieben wurde. Er nannte sich Alf Tjörnsen und hieß bürgerlich Richard J. Rudat. Später übernahmen Axel Nord – ein noch unaufgedecktes Pseudonym – und Bert Horsley, hinter dem sich Walter Spiegl verbarg, die Serie, konnten ihr aber auch keinen Auftrieb mehr geben.
Kurzbiografie: Kurt Bernhardt
Der 1916 geborene Kurt Bernhardt betreute schon beim Erich Pabel Verlag die erste deutsche SF-Heftproduktion der Nachkriegszeit: JIM PARKERS ABENTEUER IM WELTRAUM und den daraus entstandenen UTOPIA-Zukunftsroman, der 1954 durch den UTOPIA GROSSBAND ergänzt wurde. Fünf Jahre später wechselte er zum Wilhelm Heyne Verlag nach München. Dort wurde er Cheflektor für die Taschenbuchreihen sowie für den Romanheft-Bereich beim angeschlossenen Moewig Verlag. Mit Unterstützung Ernstings startete er als Antwort auf die eigenen früheren Reihen im Frühjahr 1957 die Reihe TERRA, ab Heft 3 betreut von Günter M. Schelwokat, im nächsten Jahr gefolgt vom TERRA SONDERBAND, der mit Band 100 zur Taschenbuchreihe wurde.
Der passionierte Pfeifenraucher gilt heute als Initiator von PERRY RHODAN: Er übertrug den beiden damals erfolgreichsten deutschen SF-Autoren, K. H. Scheer und Clark Darlton, die Entwicklung einer neuen Serie. Außerdem regte er die Mitarbeit von Kurt Mahr und Kurt Brand an. Im Laufe der Jahre betreute er das Perryversum verlagsintern und gab immer wieder entscheidende Impulse, etwa zur Entwicklung einer eigenen Serie für die Hauptperson Atlan und die Entstehung der SILBERBÄNDE, die er sich als Karl-May-Edition von PERRY RHODAN vorstellte, aber auch für zahlreiche andere Serien in Heft und Taschenbuch wie SEEWÖLFE, VAMPIR, DÄMONENKILLER, RONCO, LOBO, DIE KATZE, TERRA FANTASY, UTOPIA CLASSICS und PLUTONIUM POLICE. Der PERRY RHODAN-Serie blieb er bis zu seinem Tod im Jahre 1983 verbunden. Seinem aufbrausenden Temperament hat K. H. Scheer in der Gestalt von Curt Bernard, dem Zahlmeister von Rhodans Flaggschiffen CREST II und III, bereits früh ein Denkmal gesetzt. Der Zeichner H. J. Bruck verewigte ihn auf dem Titelbild von PERRY RHODAN 300 als Sergeanten, der vor Roi Danton salutiert, einer Figur, die Scheer auf seine Anregung hin erschaffen hatte.
Doppelter Erfolg hält besser
Ungeachtet dieses Misserfolgs war Bernhardt aber von dem Konzept einer fortlaufenden Serie überzeugt. Man musste das Projekt nur richtig anpacken – statt auf einen Autor wie bei JIM PARKER auf ein ganzes Team setzen, auf bessere Qualität und inhaltliche Stringenz achten. Nur, wer konnte diese liefern?
Kurt Bernhardt geriet ins Grübeln: Vor sechs Jahren, 1954, hatte der damalige Spätheimkehrer Walter Ernsting unter seiner Regie die Reihe UTOPIA GROSSBAND etablieren können, die immer noch erschien. Zwar hatte es zwischen Ernsting und ihm immer gewisse Reibereien gegeben, aber dass der Filou ihn mit dem Pseudonym »Clark Darlton« genarrt hatte und ihm eigene Romane als angebliche Übersetzungen aus dem Amerikanischen untergeschoben hatte, war längst vergeben und vergessen.
Walter Ernsting alias Clark Darlton brachte aus der Sicht des Lektors zwei besondere Vorzüge mit. Er war fleißig und seine Romane kamen bei den Lesern gut an. Er vermittelte überzeugend die Atmosphäre des Wunderbaren in Raum und Zeit, das Gefühl erhabenen Staunens angesichts der Unendlichkeit des Alls, den »Sense of Wonder«, wie die Amerikaner es nannten. Außerdem hatte er mit dem Science Fiction Club Deutschland (SFCD) bereits 1955 ein Sammelbecken für begeisterte SF-Leser geschaffen, unter denen sich immer wieder das eine oder andere hoffnungsvolle Jungtalent finden ließ. Neue Autoren waren für jede Chance dankbar und würden den Verlag nicht viel kosten – stets eine wichtige Erwägung.
Auch aus dem schrumpfenden Leihbuchsektor kamen Zulieferer in Frage. Seit Jahren tummelte sich dort der unermüdliche Karl-Herbert Scheer. Mit seiner Serie ZUR BESONDEREN VERWENDUNG um zwei Staragenten der nahen Zukunft hatte er sich an die Spitze der deutschen actionbetonten SF geschrieben. Natürlich waren sechs Romane in einem Jahr, wie Scheer sie 1957 für seine Serie vorgelegt hatte, für eine Heftserie noch viel zu wenig. Selbst monatliches Erscheinen war völlig undenkbar. Das hatte er schon einmal gegenüber Ernsting klargestellt. Jeder wollte doch gleich weiterlesen!
Von JIM PARKER war damals alle zwei Wochen ein Roman erschienen …
Also wenn schon, dann – »jede Woche einen!«
Aber war das zu leisten? Erst vor wenigen Monaten, am 14. August 1959, hatte er mit Scheer einen Vorvertrag über eine Reihe namens TERRA FANTASY unterzeichnet, die ausschließlich deutsche Science Fiction bringen sollte … Und es hatte sich als Problem herausgestellt, dass nicht genug gute Autoren zur Verfügung standen.
Vielleicht sollte es eine Serie werden – keine Reihe? Vielleicht sollte er einfach Ernsting und Scheer in die vorderste Reihe stellen, die beiden beliebtesten deutschen SF-Autoren? Und vielleicht sollte er die beiden knappe Handlungsentwürfe schreiben lassen, die talentierte Kollegen von ihnen dann zu Romanen umsetzten?
Zugegeben, Ernsting und Scheer arbeiteten ihrer persönlichen Lebenseinstellung nach sehr unterschiedlich: Der eine war eher versöhnlich ausgerichtet und fabulierte mit fast schon naiver Begeisterung über die Unendlichkeit von Zeit und Raum, wobei er auch gelegentlich die Naturwissenschaft der zu erzählenden Geschichte opferte, während der andere, wie bereits erwähnt, knallharte Actionromane schrieb, die einigermaßen stimmige physikalische Ansätze aufwiesen und in einem feindseligen Universum spielten, dessen Protagonisten sich ständig der Bedrohung durch Aggressoren menschlicher oder nichtmenschlicher Herkunft ausgesetzt sahen.
Aber wie beliebt konnte eine fortlaufende Serie werden, die von beiden gemeinsam gestaltet wurde? Jeder Roman aus ihrer Feder würde ein Hit sein.
Und doppelter Erfolg hält besser!
Kurzbiografie: Clark Darlton
Der am 13. Juni 1920 in Koblenz geborene Walter Ernsting wuchs – bedingt durch die Scheidungen und Ehen seiner Mutter – in Essen, Lüdenscheid und Bonn auf, besuchte bis zur elften Klasse das Gymnasium und hielt sich als Dackelzüchter über Wasser. Sein Vater war Martin Ernsting, der als technischer Zeichner für Aral arbeitete und sich für Atomphysik und neue Erfindungen interessierte. 1940 wurde Ernsting zwangsweise zur Wehrmacht eingezogen, wo er in einer Nachrichteneinheit diente. Über Polen, Königsberg, Norwegen, Frankreich und Riga kam er 1945 ins Kurland und geriet in Gefangenschaft. Ein Mitgefangener denunzierte ihn bei den Behörden, so dass er 1947 zu fünf Jahren Straflager in Kasachstan verurteilt wurde. 1950 kehrte er schwerkrank nach Deutschland zurück und wurde 1952 als Dolmetscher bei den britischen Besatzungsbehörden tätig.
In seiner Jugend hatte Ernsting die Werke von Hans Dominik, Rudolf Heinrich Daumann und TARZAN-Erfinder Edgar Rice Burroughs verschlungen, ganz zu schweigen von den Heftserien SUN KOH, DER ERBE VON ATLANTIS und JAN MAYEN, DER HERR DER ATOMKRAFT, die zusammen fast dreihundert Ausgaben umfassten. In den Soldatenläden entdeckte er nun die britischen und amerikanischen SF-Magazine, die ihn auf Anhieb begeisterten. Mit einer Flasche Gin bewaffnet sprach er bei Erich Pabel vor, der ihn an Kurt Bernhardt verwies. Dieser betraute ihn mit der Aufgabe, geeignete Materialien auszuwählen, zu übersetzen und für die deutsche Heftveröffentlichung vorzubereiten. So wurde er 1954 Herausgeber, Übersetzer und Redakteur des UTOPIA GROSSBAND. Die Veröffentlichung eines eigenen Romans lehnte Bernhardt – unter dem Eindruck des Misserfolgs von JIM PARKER – jedoch ab: Niemand interessiere sich für SF-Romane deutscher Autoren. Und so schmuggelte Ernsting seinen Erstling »UFO am Nachthimmel« als Übersetzung getarnt und unter Pseudonym in die Reihe ein.
Als Clark Darlton – für zwei Romane auch als Fred McPatterson – wurde Ernsting zu einem der produktivsten und beliebtesten deutschen SF-Autoren der Fünfzigerjahre. Im Frühjahr 1955 begründete er den Science Fiction Club Deutschland (SFCD), den er 1958 in den Science Fiction Club Europa (SFCE) umbenannte. Sein Haus im oberbayrischen Irschenberg war längst zu einer Art Pilgerstätte für die Fans geworden, die ihn fast jedes Wochenende aufsuchten. 1961 entwickelte er mit K. H. Scheer zusammen PERRY RHODAN, für den er 193 Hefte und 24 Taschenbücher verfasste, und wirkte ab 1973 zusätzlich an den Serien ATLAN und DRAGON mit. Unter seinem bürgerlichen Namen entstand etwa ein Dutzend Jugendbücher und 1979 der auf den Theorien seines Freundes Erich von Däniken fußende Roman »Der Tag, an dem die Götter starben«. Hinzu kamen drei Dutzend Kurzgeschichten und rund siebzig Romane, die er als Clark Darlton außerhalb von Serien schrieb, darunter »Die neun Unbekannten« (1983), in dem der unsterbliche Graf Saint Germain sich gegen einen Geheimbund stellt, der die Geschicke der Menschheit lenkt. 1992 beendete er seine Laufbahn als Schriftsteller.
Bereits 1981 war Ernsting, der zuletzt in Österreich gelebt hatte, für mehrere Jahre nach Irland gezogen, wo er nahe Cork am Rande einer Klippe lebte. Er starb am 15. Januar 2005 in Salzburg. Nach seinem Tod wurde ein Asteroid nach ihm benannt.
Interview: Ganz privat mit Clark Darlton – Ein Interview von Hans Gamber
Wie hat mit der SF in Deutschland eigentlich alles angefangen?
Für mich persönlich fing alles 1929 an, als ich in einer Zeitschrift eine Geschichte mit dem Titel »Hochzeitsreise in den Weltraum« oder so ähnlich las. Sie fesselte mich ungemein, und ohne es zu ahnen, war ich mit neun Jahren ein SF-Fan geworden. Zu den üblichen Festtagen bekam ich die gewünschten Bücher: Dominik, Daumann, Sieg und andere. Mit vierzehn Jahren wurde dann SUN KOH gelesen, eine für damalige Zeiten relativ tendenzfreie Zukunftsliteratur. Und schließlich kamen mir auch die ersten anglo-amerikanischen Autoren unter die Finger beziehungsweise Augen. Der Krieg unterbrach meine Laufbahn als Fan, aber 1950 war ich wieder dabei. Ich bedauerte es, Science Fiction nur in englischer Sprache lesen zu können, und dachte daran, wie viel »Sense of Wonder« jene entbehrten, die dieser Sprache nicht mächtig waren.
Und das brachte Sie auf die Idee …?
Richtig! Eigentlich war es jedoch die 1953 im Verlag Erich Pabel erscheinende Serie JIM PARKER, die mich auf die Idee brachte, ausländische SF müsse in deutscher Sprache erscheinen. Bücher schienen mir zur Einführung ungeeignet zu sein, wie das Beispiel des Verlages Rauch eindeutig bewies. Also eine erschwingliche Heftserie. Eben so etwas wie JIM PARKER. Ich übersetzte daher einfach einen englischen Roman, der mir geeignet erschien (den späteren UTOPIA GROSSBAND Nr. 1: »Invasion aus dem Weltraum«), und brachte ihn zum Pabel Verlag, zusammen mit meinen Vorschlägen für eine SF-Reihe ausländischer Autoren. Ich landete vor dem Schreibtisch des Cheflektors Kurt Bernhardt, der JIM PARKER gestartet hatte und sich als sehr aufgeschlossen für neue Projekte erwies. Weil ich unerfahren war, befand sich in meiner Aktenmappe auch eine Flasche Gin. Ich stellte mir vor, dass es sich bei einem Gläschen besser plaudern und überzeugen ließ. Das war dann auch tatsächlich der Fall.
Noch heute behauptet Kurt Bernhardt allen Ernstes (allerdings mit einem deutlichen Augenzwinkern), dass die Herausgabe von UTOPIA und das Entstehen des SF-Fandoms, überhaupt die Einführung des Begriffs »Science Fiction« und die heute vorhandene Popularität dieser Literatur, im Grunde genommen nur einer Flasche Gin zu verdanken sei. Kurz und gut: Knapp ein Jahr später erschien der erste UTOPIA GROSSBAND mit meiner Übersetzung. Das war also der zweite Anfang.
Wie ging es dann weiter?
Der dritte Schritt nach JIM PARKER und UTOPIA GROSSBAND war der UTOPIA SONDERBAND, das erste SF-Magazin in Deutschland. Es enthielt SF-Kurzgeschichten, wissenschaftliche Artikel und Filmberichte. Nun kamen auch deutsche Autoren zu Wort, und einige von ihnen sind noch heute als solche tätig. Das Fandom entwickelte sich, aber die typisch deutsche Vereinsmeierei sorgte dafür, dass es nicht so groß wurde, wie ich es mir gewünscht hatte.
Und die anderen Verlage? Sahen die nur zu?
Alles, nur das nicht! Lassen wir die Namen beiseite, aber so viel sei gesagt: Andere Heftserien entstanden und verschwanden wieder. Taschenbuchreihen erschienen, und einige von ihnen existieren noch heute. Aber bleiben wir bei den Heftserien, die einen wirklichen Einfluss auf die Entwicklung hatten und heute noch haben. UTOPIA kam aus den Kinderschuhen heraus und brachte auch bereits bekannte Autoren, und diesem Beispiel folgte dann der Verlag Arthur Moewig, zu dem ich später wechselte – und Kurt Bernhardt hinter dem Schreibtisch des Cheflektors wiedertraf. Das Schicksal hatte uns untrennbar verbunden. Wir brachten die Serie TERRA heraus, der sofort der TERRA SONDERBAND folgte. Zu dieser Zeit stieß dann auch Günter M. Schelwokat zu uns, der bald die Redaktion übernahm, was mir wiederum endlich Zeit gab, mich voll und ganz dem Schreiben zu widmen.
(aus: PERRY RHODAN Sonderheft Nr. 3, August 1978)
Kurzbiografie: K. H. Scheer
Karl-Herbert Scheer wurde am 19. Juni 1928 in Harheim geboren, einer damals ländlichen Gemeinde am Rande von Frankfurt. Sein Vater Karl war Feinmechaniker für Arzt- und Zahnarztbedarf, seine Mutter Susanne, geborene Steubesandt, arbeitete als Verkäuferin in einem Juweliergeschäft. Begeistert las er in seiner Jugend Kurd Laßwitz, Hans Dominik und Jules Verne, die sein Interesse an Technik und Naturwissenschaften weckten, aber auch die Hornblower-Romane von Cecil Scott Forester. In der Schule besserte er sein Taschengeld auf, indem er für säumige Mitschüler Hausarbeiten und Aufsätze verfasste.
Im September 1944 meldete sich Scheer freiwillig zur U-Boot-Waffe, um Marine-Ingenieur zu werden, erhielt eine Grundausbildung und nahm an Übungsfahrten teil, ging jedoch nie auf Feindfahrt. Nach Kriegsende gründete er mit Freunden eine Swing-Band (er selbst spielte Gitarre und Saxophon) und trat in den amerikanischen Offiziersklubs um Frankfurt auf, wobei er auch dem Pianisten Paul Kuhn begegnete. Nebenher begann er ein Maschinenbau-Studium, das er jedoch wegen Überanstrengung abbrach. Parallel dazu entstanden drei oder vier nicht erhaltene Manuskripte utopischer Romane, bis er 1948 in Zeitschriftenfortsetzungen seinen ersten Roman veröffentlichte, »Piraten zwischen Erde und Mars«, dem rasch viele Leihbücher folgten – neben vier Bänden der Piratenserie um ROBERT TAGMAN als Diego el Santo sowie neun um REINHARD GONDER als Pierre de Chalon auch die zwölfbändige Abenteuerserie KLAUS TANNERT, die als Vorläufer der ZBV-Serie gilt, sechs Romane um den Abenteurer ROGER KERSTEN und zwei Krimis für die FBI-Serie JOE BRAND. Den überwiegenden Rest bildeten seine actionbetonten SF-Reißer.
Bei einem Clubtreffen 1956 lernte Scheer Walter Ernsting alias Clark Darlton kennen. Auch wenn nie echte Freundschaft daraus entstehen sollte, verband die beiden in den nächsten Jahren doch hoher gegenseitiger Respekt. Ab 1957 schrieb Scheer die ersten Romane seiner SF-Agentenserie ZBV, und zwei Monate nach Ernstings Umbenennung des SFCD in SFCE gründete er die SF-Interessengemeinschaft »Stellaris«, bei der auch der Offenbacher Fan Willi Voltz Mitglied wurde. 1959 wurde Scheers Roman »Octavian III« mit dem »Hugo« geehrt, dem damaligen deutschen SF-Preis. Auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit entwickelte Scheer mit Ernsting die Serie PERRY RHODAN, deren Exposé-Redaktion er bis Band 647 innehatte. Auch für ATLAN erarbeitete er das Konzept.
In seiner mehr als zehnjährigen Schaffenspause bei PERRY RHODAN zwischen dem Jubiläumsband 500 und seinem »Comeback« mit Heft 1074 – genau tausend Romane nach dem Einstieg von William Voltz – kümmerte er sich gemeinsam mit seiner Gattin Heidrun vorwiegend um neue Romane für seine neu aufgelegte und fortgesetzte ZBV-Serie, die es auf fünfzig Bände brachte, und die Bearbeitung seiner gesammelten SF-Werke für die Reihe UTOPIA BESTSELLER in 44 Bänden. Am 15. September 1991 (er war bereits wieder ständiger und beliebter Autor der von ihm mitgegründeten Serie) verstarb Scheer überraschend an den Folgen einer Lungen- und Rippenfellentzündung.
Interview: Ganz privat mit K. H. Scheer – Ein Interview von Wolfgang J. Fuchs