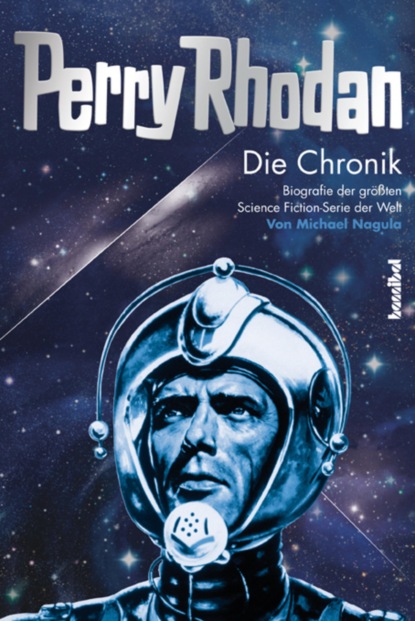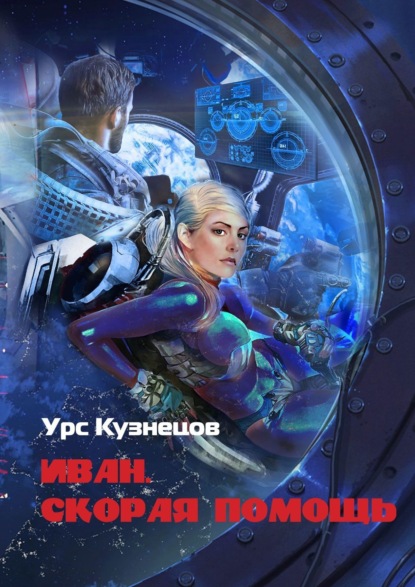- -
- 100%
- +
Wie entstand eigentlich die Serie PERRY RHODAN?
Nun, der Ausgangspunkt war die Idee, eine denkbare Zukunftsgeschichte der Menschheit zu entwickeln. Das ist ein ziemlich weit gesteckter Rahmen, weil es unendlich viele Möglichkeiten gab und gibt, diesen Rahmen zu füllen. Ich hielt es deshalb für angebracht, von zeitnahen Gegebenheiten auszugehen, und habe in meinem ersten Vorschlagsexposé die damals noch utopisch anmutende bemannte Mondlandung als Handlungsgrundlage gewählt. Das war Ende 1960. Anfang 1961 erhielten Walter Ernsting und ich von Cheflektor Kurt Bernhardt beim Moewig Verlag in München grünes Licht für den Start einer »SF-Serie mit feststehendem Helden«. Zum Grundkonzept gehörte, dass sämtliche Fakten der SF mitverarbeitet und neue hinzuerfunden werden sollten und dass die Handlung chronologisch abzulaufen habe. Nach Kurt Bernhardts vorsichtiger Schätzung sollte eine so konzipierte Reihe »mindestens die ersten fünfzig Bände überleben«. Nach den vielen Pleiten anderer Verleger und Verfasser war diese Schätzung eigentlich sogar sehr gewagt. Das gequälte Lächeln unseres damaligen Seniorverlegers Wilhelm Heyne war deshalb nur allzu verständlich. Aber davon war unsere Begeisterung für dieses Projekt nicht zu bremsen.
Die Entwicklung PERRY RHODANS hat ja alle Erwartungen weit übertroffen. Welche Gründe gab es dafür?
Der entscheidende Grund für den dauerhaften Erfolg war wohl der Vorschlag, die neue Romanserie nach Exposés schreiben zu lassen, die einer oder höchstens zwei Autoren verfassen sollten, während ein Autorenteam für die Ausarbeitung der Geschichten zuständig war. Auf diese Weise konnte ein großer Fortsetzungsroman entstehen, der trotz Teamarbeit in sich geschlossen und einheitlich war.
Und wie sahen die ersten Exposés aus?
Sie gingen vom Konzept der stufenweisen Entwicklung aus, beginnend mit der Mondlandung. Dabei stand für mich die Realität des Jahres 1961 mit den bereits bekannten technischen Nutzanwendungen im Triebwerks- und Zellenbau plus Elektronik weit im Vordergrund. Schließlich sollte der Serienbeginn denkbar und für jedermann verständlich und akzeptabel sein. Walter Ernsting und ich diskutierten zunächst über die Namen der handelnden Personen und über Umrissfragen, die dann im Exposé und im Roman konkretisiert wurden.
Im Gegensatz zu über sechshundert nachfolgenden Handlungsexposés waren die ersten drei Exposés allerdings nicht bis ins Detail ausgearbeitet. Die exakte Aufschlüsselung der Grunddaten, die für sämtliche späteren PERRY RHODAN-Romane maßgeblich wurden, erfolgte bei der Niederschrift des ersten Romans mit dem Titel »Unternehmen Stardust«. Auf den darin festgelegten Details aller Art bauten dann die Bände zwei, drei, vier und so weiter auf.
Ab Band vier schrieb ich die Exposés allein. Ich erfand handelnde Personen, baute das Solare Imperium auf, entwarf das Weltbild der Arkoniden und so weiter. Dabei stellte ich mich auch auf Vorlieben einzelner Autoren ein, etwa darauf, dass Walter Ernsting gerne Geschichten bearbeitete, in denen Gucky eine Hauptrolle spielte. Schließlich fertigte ich mehrere Durchschläge an, um dem mittlerweile auf fünf Autoren angewachsenen Team zu ermöglichen, neben dem Stoff des eigenen Romans auch den der Kollegen vor und nach ihnen kennenlernen und berücksichtigen zu können.
Trafen Sie sich häufig mit den Autoren?
Da die Autoren nicht alle am selben Ort wohnten, sah ich sie nach der Einarbeitung in die Serie höchstens zwei- bis dreimal im Jahr. Später trafen wir uns einmal pro Vierteljahr. Zwar waren nicht alle Ideen, die wir bei unseren Treffen diskutierten, in die Tat, sprich in einen Roman umzusetzen, aber es gab doch so manche wesentliche Anregung. Als wir Band 45 erreicht hatten, fiel der Begriff Atlantis. Daraus erfand ich für Band 50 den arkonidischen Kristallprinzen und späteren Imperator Atlan. Das Problem der Unsterblichkeit fand in den Zellaktivatoren eine Lösung, die die aufwendige und handlungshindernde Zelldusche durch ES ersetzte.
Im Zeitraum eines Jahres war die PR-Serie zu einem Erfolg geworden, so dass wir ziemlich optimistisch auch mit dem Erscheinen des hundertsten Bandes rechneten. Nach zwei Jahren Anlaufphase bestand dann kein Zweifel mehr, dass PERRY RHODAN zu einem Begriff geworden war.
(aus: PERRY RHODAN Sonderheft Nr. 4, Oktober 1978)
Die ersten Konzepte
Im Herbst des Jahres 1960 erteilte Bernhardt sowohl Ernsting als auch Scheer den Auftrag, das Konzept für eine fortlaufende Science Fiction-Serie zu erstellen. Ob die beiden jeweils vom Auftrag des anderen wussten, ist nicht bekannt.
Beide Autoren reichten Vorschläge ein, die zwar nicht ohne Änderungen akzeptiert wurden, Bernhardt aber darin bestätigten, dass er sich die richtigen Leute ausgesucht hatte. Dass insbesondere Scheer klar umrissene Vorstellungen von der möglichen Serie hatte, belegt der Begleitbrief zu seinem Entwurf. Scheer schreibt:
»… SF-Serien üblicher Art gibt es in Hülle und Fülle. In der Regel wird die Pleite mit Band 45 seitens des Verlages vorsichtig angedeutet, um mit Band 50 vollstreckt zu werden. Wenn ich eine Geschichte der Menschheit entwickeln soll, so hat sie in unserer Jetztzeit zu beginnen, zu beginnen mit dem bemannten Raumflug, begreifbarer und realistischer Technik, die nach und nach ausgebaut wird. Ich werde demnach auf keinen Fall mit dem Bau des 120. Stockwerks beginnen, sondern mit dem soliden Fundament.
Wenn Sie jedoch das übliche Tralala mit 3- bis 4-Mann-Abenteuerchen im Weltraum wünschen, wenn Sie nicht erklärt haben wollen, warum dieses und jenes Raumschiff überhaupt fliegen kann, dann bin ich in der geplanten Serie fehl am Platze.«
Bernhardt müssen diese Zeilen erfreut haben, entsprachen sie doch voll und ganz seiner Intention, eine Serie aus der Taufe zu heben, die sich qualitativ von der Konkurrenz abhebt. Er beauftragte die beiden Autoren, einen ersten gemeinsamen Entwurf zu erarbeiten – noch ehe die Serie endgültig genehmigt worden war.
Bis dahin war der Weg auch noch weit. Ein Produktionsvorlauf musste geschaffen, weitere geeignete Autoren gefunden werden, dazu kamen noch die Fragen von Finanzierung, Vertrieb und Werbung – Bernhardt wurde betriebsam. Die Autoren hatten ja keine Ahnung. Sie brauchten bloß zu schreiben, aber er – er musste sich um alles kümmern!
Ein Held wird geboren
Am 25. Januar 1961 hielt Kurt Bernhardt eine erfolgreiche Vorbesprechung mit den künftigen Serienautoren K. H. Scheer und Clark Darlton ab. Zufrieden führte er sie aus dem Verlag, damit sie in Oberbayern die konzeptionelle Grundlage für eine SF-Serie schufen, die zu einem ungeahnten Welterfolg werden sollte.
»So, nun fahrt mal schön nach Irschenberg«, trug er ihnen auf, »geht dort in Klausur und bringt uns in zwei oder drei Tagen die Gesamtkonzeption der Serie, wir rechnen so mit dreißig oder fünfzig Romanen insgesamt. Benötigt werden Namen der Hauptpersonen, ausführliche Exposés der ersten vier Romane und Kurzexposés der Bände fünf bis zehn. Dann sehen wir weiter.« So jedenfalls die Erinnerung Walter Ernstings fünfundzwanzig Jahre später.
In Ernstings Mietwohnung in Irschenberg erstellten die beiden mit Hilfe von Zigaretten, Kaffee, Bier, Bergen von Notizen und einer eifrig klappernden elektrischen Schreibmaschine (»einer der ersten in Deutschland«, wie Scheer später verkündete) ein erstes Rohkonzept. Die Handlung sollte im Jahr 1971 einsetzen, in einer Welt, die am Rand des Atomkriegs steht – ein realistisches Szenario in der Zeit des Kalten Krieges, der nur wenige Monate später mit der Kuba-Krise auf seinen ersten Höhepunkt zutreiben sollte. Als Protagonisten bestimmten sie einen amerikanischen Astronauten, der beim ersten Mondflug das notgelandete Schiff eines fremden Volkes, der Arkoniden, entdeckt. Mit Hilfe der Arkoniden gründet er die »Dritte Macht«, einen Staat, der sich als Puffer zwischen Ost und West versteht.
Nach langem Hin und Her einigte man sich auf Ernstings Vorschlag hin, den Protagonisten Perry Rhodan zu nennen. Wie Ernsting auf den Vornamen kam, ist bis heute ungeklärt. Mögliche Quellen sind unter anderen ein Disney-Eichhörnchen, der Schmachtsänger Perry Como sowie Erle Stanley Gardners streitbarer Rechtsanwalt Perry Mason. Auch hatte sein ebenfalls SF schreibender Kollege W. W. Shols, den beide aus dem SFCD kannten, bereits 1959 eine eigene Buchreihe gestartet, deren Hauptfigur Perry Barnett hieß. Vielleicht gab es hier gewisse Anleihen.
Die Herkunft des Nachnamen ist hingegen geklärt: Ernsting übernahm einfach den einer Flugechse aus einem der zahlreichen Monsterfilme, die nach dem Erfolg Godzillas über die deutschen Kinoleinwände flimmerten – Rodan (ohne h!), das zweite Filmmonster nach Godzilla aus dem japanischen Filmstudio Toho.
Jedenfalls berichtete Ernsting schon im August 1967 auf den Leserseiten von TERRA 517: »Karl-Herbert Scheer hatte die Idee von den Arkoniden auf dem Mond, ich hatte den Namen der Serie und einige Ideen. Wir mixten unsere Vorstellungen zu einem Exposé-Cocktail und kehrten damit zwei Tage später zum Verlag zurück.«
Das Exposé für den ersten Roman wurde am 14. Februar 1961 fertig gestellt, keine drei Wochen nach der Auftragserteilung durch Kurt Bernhardt. Außerdem verfassten die beiden einen Ausblick auf die Handlung nach den ersten Heften. Scheer und Ernsting arbeiteten dabei auf eigenes Risiko. Bernhardt hatte die ersten Romane unverbindlich angefordert. Sollte die Serie nicht realisiert werden, würden die beiden leer ausgehen.
Info zur Romanserie: Perry Rhodan
Perry Rhodan ist schlank und hochgewachsen, hat dunkelblondes Haar, graublaue Augen und eine kleine Narbe am rechten Nasenflügel, die sich bei Erregung weiß verfärbt. Er hat einen trockenen und dennoch herzhaften Humor. Am 8. Juni 1936 in Manchester/Connecticut geboren, ist er der einzige Sohn von Jakob Edgar (»Jake«) Rhodan, der als Kind kurz nach dem Ersten Weltkrieg mit Eltern und Bruder aus Deutschland in die USA eingewandert war, und Mary Rhodan, geborene Tibo (frühere Schreibweise: Thibeau), deren Familie ursprünglich aus Lothringen stammt. Seine jüngere Schwester Deborah kam im Frühjahr 1941 bei einem von ihrer Mutter verursachten Unfall ums Leben. Beide Eltern gingen Ende September 1945 mit der ersten Welle amerikanischer Besatzungstruppen nach Japan, wo sie aus erster Hand einen Eindruck der Schrecken von Hiroshima und Nagasaki erlebten. Auf Betreiben seines Onkels Kenneth Malone, eines Colonels der US Air Force, besuchte Perry Rhodan die Kadettenschule und wurde Militärpilot. Als er 1971 als Kommandant der ersten bemannten Mondexpedition startet, ist er nicht nur Astronaut, sondern auch Kernphysiker und Ingenieur für atomare Strahlentriebwerke. Die vierköpfige Besatzung, darunter Reginald Bull, trifft auf dem Mond auf das Raumschiff der Arkoniden Thora und Crest, deren Wissensstand und technische Geräte sie übernehmen dürfen. Bei ihrer Rückkehr auf die Erde bauen sie damit gegen den Widerstand der irdischen Großmächte in der Wüste Gobi die »Dritte Macht« auf. 1976 erhält Rhodan von ES auf dem Kunstplaneten Wanderer eine Zelldusche, die vorübergehend seine Alterung aussetzt. Nach seiner Wahl zum Administrator der Erde entsteht die Terranische Weltregierung. Ein auf ihn programmierter Zellaktivator sichert Rhodan die potenzielle Unsterblichkeit, führt aber auch zum tragischen Tod von Thomas Cardif, dem gemeinsamen Sohn mit Thora. Aus der zweiten Ehe mit Mory Abro gehen die Zwillinge Suzan Betty und Michael hervor, der zum Freihändlerkönig Roi Danton wird. Im Laufe seines Lebens entwickelt Rhodan, als Prototyp des in kosmischen Dimensionen denkenden Menschen, einen immer stärkeren Sinn für kosmische Zusammenhänge und geht der Menschheit – aktiv als Hüter und Beschützer – auf ihrem Weg in die Zukunft voran.
Das Autorenteam entsteht
Der Verlag ließ sich mit seiner Entscheidung Zeit. Dennoch arbeiteten Bernhardt, Scheer und Ernsting mit Hochdruck an der Zusammenstellung eines Autorenteams. Kurt Bernhardt hatte den in der Nähe von München lebenden Schriftsteller Paul Alfred Müller vorgeschlagen, der sich – weil es noch eine ganze Anzahl Namensvettern von ihm gab – nach seinem Wohnort gelegentlich auch Paul Müller-Murnau nannte. Die Hinzufügung des Wohnorts bei häufigen Namen war damals durchaus verbreitet.
Ernsting war von Bernhardts Wahl angetan, schließlich hatte er als Jugendlicher Müllers Vorkriegsserie SUN KOH verschlungen. Bei einem unverbindlichen Gespräch zeigte sich Müller zu einer Mitarbeit bereit, beharrte jedoch als Anhänger der Hohlwelt-Theorie darauf, dass die Serie im Inneren der Erde spielen solle. Da sowohl der Verlag als auch die beiden Chefautoren sich einig waren, die Handlung im Weltraum anzusiedeln, kam es deshalb nicht zu einer Zusammenarbeit.
Ein Kuriosum am Rande: Knapp fünf Jahre später gab es in PERRY RHODAN durchaus einen Handlungsfaden, an dem Paul Alfred Müller seine wahre Freude gehabt hätte. Auf dem Weg nach Andromeda verschlägt es Perry Rhodan und seine Getreuen nämlich in das Innere der Hohlwelt Horror …
Scheer wandte sich unterdessen an den in Darmstadt lebenden Physikstudenten Klaus Mahn, der unter den Pseudonymen Cecil O. Mailer und Kurt Mahr bereits etliche technisch orientierte SF-Heftromane vorgelegt hatte. Zwar hatte er erst 1959 zu veröffentlichen begonnen, aber bereits vierzehn Hefte in UTOPIA und TERRA herausgebracht. Das konnte sich sehen lassen. Und Mahn war Feuer und Flamme und hätte am liebsten sofort mit der Arbeit an der Serie begonnen.
Am 5. März, wiederum drei Wochen nach Niederschrift des ersten Exposés, nahm Scheer auch Kontakt zu einem Freund aus der noch jungen Fan-Szene auf, der als Verlagskaufmann in Bielefeld arbeitete und seit 1958 auf dem Leihbuchsektor tätig war. »Winnie« Scholz, der als William Brown und W. W. Shols veröffentlichte, erwies sich schnell als Bereicherung des jungen Teams. Er stellte aus einem Kiotoer Adressbuch, das bei seinem Arbeitgeber Gundlach verlegt wurde, eine Liste mit authentischen japanischen Namen zusammen, die man für die Mitglieder des Mutantenkorps benutzte. Scheer hatte die Bombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki als Auslöser für übersinnliche Fähigkeiten bei den »Kindern des Atoms« postuliert (wofür er später heftige Schelte von der Kritik bezog), und dieser Beitrag kam ihm gerade recht. Folgerichtig schrieb Scholz Heft 6, das unter dem Titel »Das Mutantenkorps« erschien.
Abermals zwanzig Tage später, am 5. März 1961, lieferte K. H. Scheer das Manuskript des ersten Roman der PERRY RHODAN-Serie ab. Endlich konnten auch die anderen Autoren loslegen, fleißig schrieben sie ihre Texte auf Matrizenpapier. Ständig wurden jetzt Kopien der fertigen Romane an die Teamkollegen geschickt.
Den dritten Beitrag schrieb Scheer ohne Exposé direkt in die Maschine, und am 9. Mai lieferte er das letzte der angeforderten Probe-Exposés ab. Es galt Heft neun, mit dem der erste Erzählabschnitt der Serie endete. Nun begaben sich Kurt Bernhardt und sein Kollege Günter M. Schelwokat damit und mit den ersten vier Romanen in Klausur. Für die Autoren begann das lange Warten. Würde die Serie realisiert werden?
Der unterschätzte Serienautor
Es gibt einen Autor bei PERRY RHODAN, dessen Bedeutung oft zu gering eingeschätzt wird: Kurt Mahr. Zusammen mit Scheer und Darlton gehörte er zu den Profis, die der Serie eine Richtung gaben. Shols, der ein Heft nach ihm an Bord kam, verfasste aus Zeitgründen nur vier Romane, und Kurt Brand und William Voltz traten in eine bereits laufende Serie ein. Aber Mahr schrieb von den ersten hundert Romanen immerhin 28, und bis zu seinem vorübergehenden Ausstieg aus der Serie mit Band 395 sollte diese Zahl sogar auf 75 Romane anwachsen. Er prägte die Serie von Anfang an.
Und es gab einen, der eben darauf gesetzt hatte: Kurt Bernhardt!
Sicher hatte dem Cheflektor schon am 11. Mai 1959 die Gründung einer neuen Weltraumserie vorgeschwebt, die alle Fehler von JIM PARKER vermeiden sollte, und sicher war er schon vorher auf der Suche nach den richtigen Autoren gewesen.
Wie aus einer Korrespondenz hervorgeht, die die Witwe von Kurt Mahr in einem Begleitbuch zum PERRY RHODAN-Con 2003 kommentiert und fotokopiert vorlegte, bekam Mahr zu eben diesem Datum die Antwort auf ein Schreiben, mit dem er sein erstes Manuskript beim Moewig Verlag eingereicht hatte. Der Roman erschien im folgenden Jahr unter dem Titel »Zeit wie Sand« als TERRA-Heft 99, und sofort muss Bernhardt den Eindruck gehabt haben, dass hier ein hoffnungsvoller neuer Autor bereitsteht.
Als Mahr dem Verlag vier Wochen später zwei weitere Exposés zur Ausarbeitung anbot, antwortete Bernhardt am 19. Juni 1959: »Mit ihrem bereits eingereichten Manuskript sind wir sehr zufrieden und können uns sehr gut vorstellen, dass unsere Zusammenarbeit erfolgreich sein wird, wenn Sie weiterhin das Niveau beibehalten.« Aber er ließ es auch nicht an Kritik fehlen. »Nur muss in Ihrem Manuskript mehr Aktion vorhanden sein, das heißt ganz allgemein in Ihren Manuskripten. Die wissenschaftliche Fundierung ist ausgezeichnet, aber Sie wissen ja und müssen immer bedenken, dass wir die Hefte an ein großes Publikum verkaufen. Also bitte versuchen Sie, in Ihren nächsten Manuskripten mehr Aktion zu bringen und somit auch mehr Spannung.«
Am 29. Juli bestätigte Bernhardt den Empfang des zweiten Manuskripts, »Ringplanet im NGC 3031«, und war begeistert. Er kaufte es aufgrund des größeren Umfangs von 300.000 Zeichen, das es für einen TERRA SONDERBAND geeignet erscheinen ließ, zu einem erhöhten Honorar von 500 DM an. Und am 28. Oktober bestätigte Bernhardt den Eingang des dritten Manuskripts im normalen Heftumfang von 240.000 Zeichen, »Der Nebel frisst sie alle«. Auch diese Manuskripte wurden sehr gelobt.
Und damit stand Bernhardt nicht allein. Am 19. Januar 1960 schrieb er an Mahr: »Sie haben sicherlich schon längst gemerkt, dass unsere Lektoratsabteilung für Sie eine kleine Schwäche hat, und darum wollen wir heute etwas tun, was noch nie – auch besonders zeitlich gesehen – der Fall war: Wir schreiben Ihnen den Text einer Postkarte ab, die wir heute erhielten.« Ein Leser hatte dem Verlag seine Meinung zu »Zeit wie Sand« mitgeteilt, der ihn begeistert hatte: »Den vorliegenden Terra-Roman halte ich für einen der besten Romane, die in dieser Reihe erschienen sind, der glaubhaft, in seiner Handlung flüssig und überaus spannend ist. In seiner Menschlichkeit ist dieser Roman wohl kaum zu übertreffen, es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen das mitzuteilen. Mit Freude darf ich hoffen, dass ähnliche Werke in Zukunft weiter erscheinen werden.«
Diesem letzten Wunsch schloss sich auch der Verlag an, und Mahr wurde das viele Lob schon ein wenig unheimlich. »Ich muß Ihnen gestehen«, schrieb er an Bernhardt, »der Moewig Verlag beginnt, mich durch sein übergroßes Zuvorkommen in der Geschwindigkeit, mit der meine Romane beurteilt werden, zu beschämen.«
Und dann blies das erste Schreiben des Außenlektors Günter M. Schelwokat auch noch in dasselbe Horn. »Eingangs möchte ich betonen, dass das gute Ankommen Ihres ersten Romans bei den TERRA-Lesern mich nicht nur als Lektor und Redakteur TERRAs, sondern auch rein persönlich freut und mich in der Auffassung bestärkt, dass es an der Zeit ist, dem gehobeneren, technisch-wissenschaftlich gut fundierten SF-Roman, wie Sie ihn pflegen, selbst im Rahmen der Kleinbände, die ja bislang mehr auf blutig-abenteuerliche Space Operas abgestimmt waren, mehr und mehr Platz einzuräumen.« Und unter Bezug auf das zweite Manuskript erklärte Schelwokat, er habe es »übrigens zur Aufnahme in die Sonderbandreihe empfohlen. Bei Herausgabe dürften Sie dann wohl noch mit einer zusätzlichen Honorierung von 100 DM rechnen. Bei einem guten Abschneiden dieses Romans können Sie erwarten, dass auch ein Teil Ihrer zukünftigen Produktion für die Sonderbände Verwendung finden wird.«
So war es kein Wunder, dass Kurt Mahr, als die Vorarbeiten für PERRY RHODAN anliefen, von Anfang an dabei war. Am 13. April 1961 schrieb er an Bernhardt: »Über Ihre Wertschätzung meiner Mitarbeit an der Perry-Rhodan-Serie freue ich mich sehr. Ich nehme mir vor, Sie nicht zu enttäuschen. Auf jeden Fall will ich es nicht an der gewünschten Intensität der Arbeit fehlen lassen.«
Sechs Tage später wandte Mahr sich erneut an den Cheflektor. »Inzwischen habe ich von Herrn Scheer das Manuskript des ersten Bandes bekommen und schon durchgelesen. Es hat mir sehr gut gefallen. Leider muß ich – ich soll den Band Nr. 5 schreiben – nun noch auf drei weitere Manuskripte und das Exposé des fünften Bandes, das Herr Scheer allerdings schon angekündigt hat, warten. Sie dürfen versichert sein, daß ich mit der Arbeit an PERRY RHODAN im selben Augenblick beginne, in dem ich die nötigen Unterlagen in der Hand habe.«
Am 17. Mai lieferte Kurt Mahr sein erstes Serienmanuskript ab. Er hatte ihm den Titel »Die Anerkennung« gegeben, worauf Bernhardt ihn am 31. Mai bat, ihm doch weitere Vorschläge mit zugkräftigeren Titeln zu machen. Außerdem erklärte er: »Sie haben von Herrn Scheer bereits einen neuen Auftrag für obige Serie erhalten beziehungsweise das entsprechende Exposé, und wir bitten Sie, sich mit dieser Arbeit so schnell wie möglich zu beschäftigen, damit wir das Manuskript bald bekommen.«
Wie ein Donnerschlag muss Mahr jedoch der abschließende Absatz des Schreibens getroffen haben: »Ich werde mich mit Herrn Scheer auch darüber unterhalten, wie weit die Möglichkeit besteht, dass wir Sie noch stärker für die Mitarbeit an der Rhodan-Serie einsetzen können, das heißt dass Sie mehr Manuskripte für diese Serie schreiben als bisher. Ich hoffe, dass Sie mit diesem Vorschlag einverstanden sind, und erwarte gern Ihre Rückäußerung hierzu, damit ich das Notwendige veranlassen kann.«
Weder Bernhardt noch Mahr konnten ahnen, dass der frischgebackene Serienautor einmal sage und schreibe 253 Romane für PERRY RHODAN schreiben würde. Davon entfielen allein 177 auf die Zeit nach seinem Wiedereinstieg, der sich 1971 durch ein erneutes Gespräch mit Kurt Bernhardt anbahnte. In den 22 Jahren, die er noch an der Serie mitwirkte, war beinahe jedes neunte Heft von ihm – ein hoher Anteil, wenn man bedenkt, dass er ab Oktober 1985 gemeinsam mit Ernst Vlcek die Exposés verfasste. In dieser Funktion war er bis Band 1556 tätig, der im August 1991 erschien.
Zwei Jahre später sollte er an einem Blutgerinnsel im Kopf sterben, dass er sich durch einen Sturz auf eine Bordsteinkante zugezogen hatte.
Kurzbiografie: Kurt Mahr
Klaus Otto Mahn, so der bürgerliche Name des Autors, wurde am 8. März 1934 in Frankfurt am Main geboren. Im Oktober 1953 begann er ein Bauingenieurstudium in Darmstadt, ab dem Sommersemester 1956 studierte er Physik – finanziert durch einen Job als Schlafwagenschaffner und seine Romane, die seit 1959 entstanden. Zunächst waren es Liebesgeschichten gewesen, die allerdings abgelehnt wurden, dann zwei Western. Mit der Science Fiction fand er schließlich sein Metier und konnte 1960 bereits auf vierzehn Heftromane in UTOPIA und TERRA verweisen. Als das Angebot zur Mitarbeit an PERRY RHODAN an ihn erging, hatte er gerade beschlossen, in die USA zu ziehen, um an der Erforschung und Entwicklung von Raketentrieben mitzuwirken. Wernher von Braun nannte ihm ein von der US-Army unterhaltenes Büro in Frankfurt, und so übersiedelte er 1962 mit seiner zweiten Frau und zwei Kindern nach Amerika. In East Hartfort, Connecticut, wurde er Projektleiter für die Erstellung eines Softwarepakets zur Auswertung elektronischer Raketentests und stieg im September 1969 aus der PERRY RHODAN-Serie aus. Er zog mit seiner Familie nach Florida und leitete dort für die Satellite Communications Agency die Entwicklung von Informations- und Projektüberwachungssystemen. 1971 kehrte er nach Deutschland und in die Serie zurück. Ab 1985 schrieb Mahr, der seit 1977 wieder in den USA lebte, von jenseits des Atlantiks zusammen mit Ernst Vlcek auch die Exposés von PERRY RHODAN. Er sollte es auf insgesamt 253 Romane, 42 Taschenbücher und 44 Folgen von ATLAN bringen, nicht gerechnet siebzig Einzelwerke und rund 950 Sachartikel über die Serie und wissenschaftliche Themen. Mahr starb am 27. Juni 1993 in Florida an den Folgen eines Unfalls.
Interview: Ganz privat mit Kurt Mahr – Ein Interview von Wolfgang J. Fuchs und Hans Gamber
Ab wann schrieben Sie SF-Geschichten?
Mein erstes ernstzunehmendes SF-Manuskript verfasste ich im Frühjahr 1959 – damals an meiner zukünftigen Karriere als Autor fast schon verzweifelnd, nachdem zwei Versuche, beim Darmstädter Marken Verlag ein LORE-Manuskript unterzubringen, kläglich gescheitert waren. Meinen SF-Roman schickte ich an den Moewig Verlag in München. Sowohl Moewig als auch Pabel veröffentlichten damals SF-Serien. Ich hielt mich an Moewig, weil mir die Moewig-Produkte von der Aufmachung her besser gefielen und ich außerdem von der JIM PARKER-Serie die Nase voll hatte.