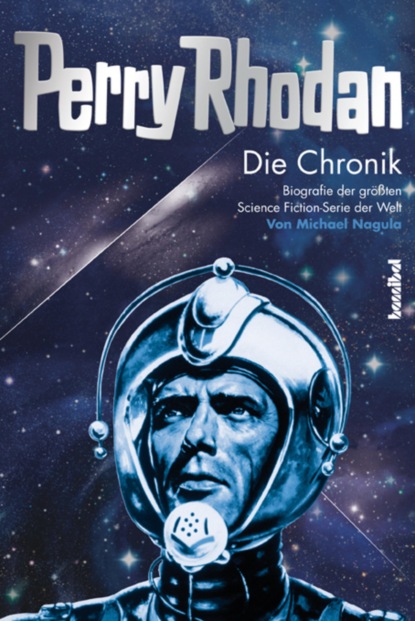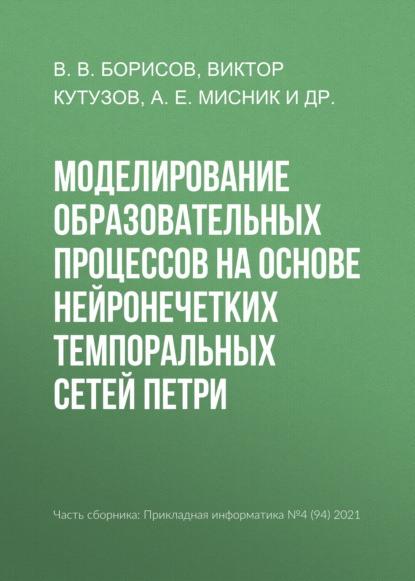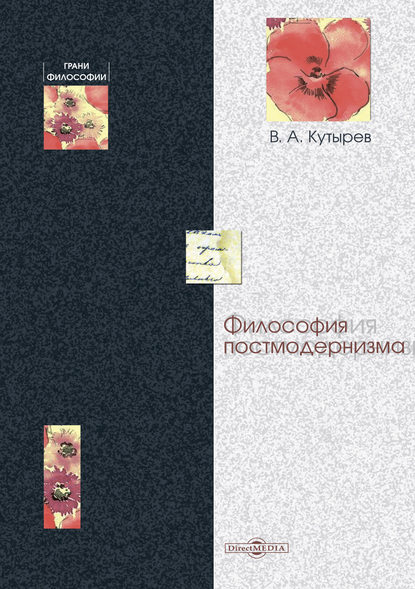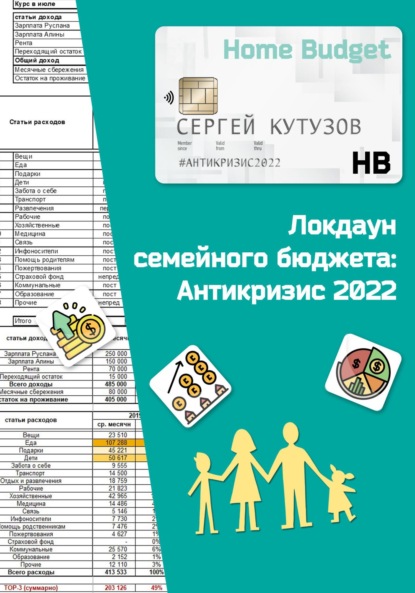- -
- 100%
- +
Seine Ängstlichkeit und eine gewisse Schroffheit waren sicher verständlich angesichts der Situation, dass er in wenigen Wochen nach Amerika aussiedeln würde und beabsichtigte, der Serie weiter als Autor erhalten zu bleiben. Noch wies nichts darauf hin, dass Kurt Mahr und Willi Voltz einmal sehr enge Freunde werden sollten.
Und im Herbst 1962 war es dann so weit: Mahr bestand die Prüfung. Er hatte jetzt sein Diplom in der Tasche. Aber eines hinderte ihn noch am Aufbruch in die Vereinigten Staaten: der fehlende Job. »Ich schrieb an Wernher von Braun und bat ihn um Auskunft, wie man als Deutscher in Amerika eine Anstellung als Physiker finden könne.« Der emigrierte Raketenwissenschaftler riet ihm, sich an ein von der amerikanischen Armee unterhaltenes Büro in Frankfurt zu wenden, das deutsche Wissenschaftler in die USA vermittelte. Und so reiste Kurt Mahr am 5. Dezember 1962 mit Frau, zwei Kindern und Schwiegermutter in die Vereinigten Staaten ab, um fortan dort zu arbeiten.
Später sagte er einmal: »Meine Teilnahme am amerikanischen Raumfahrtprogramm beschränkte sich darauf, dass ich in den Jahren 1962 bis 1966 an Hochenergie-Brennstoffzellen vom Bacon-Typ gearbeitet habe.« Sie wurden an Bord der Apollo-Kapseln verwendet.
Kurzbiografie: Wernher von Braun
Der amerikanische Raketenkonstrukteur deutscher Herkunft (1912 bis 1977) entwickelte seit seinem zwanzigsten Lebensjahr im Auftrag des Heereswaffenamts Flüssigkeitsraketen und wurde 1937 technischer Direktor an der Heeresversuchsanstalt in Peenemünde, wo er die Entwicklung der A4-/V2-Raketen leitete. Nach dem Krieg setzte er seine Arbeit in den USA fort, wurde 1955 eingebürgert und trieb ab 1959 als leitender Mitarbeiter der NASA, zuletzt als Direktor des Raumfahrtzentrums in Huntsville, Alabama, die Entwicklung großer Trägerraketen voran – darunter die »Jupiter C«, mit der im Januar 1958 der Satellit »Explorer I« in seine Umlaufbahn gebracht wurde. Dadurch wurde die Vorherrschaft der Sowjetunion im All gebrochen, und Wernher von Braun wurde eine Symbolfigur für die Zukunft der westlichen Raumfahrt.
Im September 1958 suchte ihn während eines dreitägigen Besuchs bei seinen Eltern im oberbayerischen Kreis Rosenheim auch eine Abordnung des Science Fiction Club Europa unter Leitung von Clark Darlton auf, der ihn danach in einem Artikel als »menschliche Verkörperung unserer Ziele« idealistisch verklärte. Auch Kurt Mahr stand mit von Braun in Verbindung. Die Ehrfurcht vor dessen Leistungen war damals sehr groß. Seine Verwicklung in die Verbrechen des Dritten Reiches, darunter der Einsatz von Arbeitskräften aus dem Konzentrationslager Dora-Mittelwerk, war zu jener Zeit noch nicht allgemein bekannt.
Der vierte Stammautor der Serie, Kurt Brand, hatte gerade wegen sinkender Einnahmen seine Leihbücherei aufgeben müssen und schrieb jetzt, um existieren zu können, verstärkt Western. 1962 erschienen unter den Pseudonymen Buster Brack, Conny Cuba, Cherry Moss und John Rifle gleich fünfzehn davon. Seine wichtigsten SF-Leihbuchromane waren bereits als Heftausgaben bei Moewig und Pabel neu aufgelegt worden, jetzt publizierte er neben sechs PERRY RHODAN-Heften in der Reihe TERRA die Erstdrucke »Der Sternenjäger« und »Der Galaxant«, in dem ein rätselhaftes Wesen die erstarrten Machtstrukturen eines galaktischen Imperiums bedroht – für viele sein bestes und reifstes Werk.
1963 sollte in TERRA seine noch heute überaus beliebte zehnbändige SF-Serie um den Weltraumreporter Yarl starten, für die er in späten Jahren noch das Fragment einer unveröffentlichten Fortsetzung schrieb. Doch dieses Jahr sah mit »Denn der Potomac erzählt«, der unter dem Namen Harry S. Kingston erschien, vor allem noch Brands einzigen Ausflug in den Bereich des Gesellschaftsromans.
Die erste Buchausgabe
Schon Anfang 1962 waren die Vorarbeiten für eine erste deutsche Buchausgabe der PERRY RHODAN-Serie angelaufen. Die Gebrüder Zimmermann hatten damals mit ihren Verlagen Balowa, Hönne und Widukind eine führende Rolle auf dem Leihbuchmarkt inne, und hier speziell auf dem Gebiet der Science Fiction.
Normalerweise wurden Leihbücher später als Heftromane nachgedruckt, so geschehen bei vielen Klassikern von Scheer, Darlton und Shols. Im Falle von PERRY RHODAN war es genau andersherum, wobei die ersten sieben Bände unter dem Widukind-Imprint erschienen, die Bände 8 bis 56 jedoch unter dem Label Balowa.
Insgesamt erschien die Serie binnen sieben Jahren bis einschließlich Band 156 in geringfügig bearbeiteter Form mit jeweils zwei Heften pro Band, unter Auslassung von 43 Ausgaben – darunter Kurt Mahrs Kolonistenabenteuer. Die Zusammenstellung der Bücher besorgte Scheer noch zusätzlich zu seinem gewaltigen Arbeitspensum. Sie sollte ein wichtiges Lehrstück für die SILBERBÄNDE werden, die zwanzig Jahre später von William Voltz zusammengestellt wurden – und zeigen, wie hoch der Qualitätsstandard für eine definitive Buchausgabe wirklich angesetzt werden musste.

Inserat in TERRA 191 (1961)

Punktlandung nach langem Sprint
Bereits Anfang des Jahres 1962 war es bei K. H. Scheer in Friedrichsdorf zu einem folgenschweren Gespräch gekommen. Der Miterfinder von PERRY RHODAN hatte einen jungen Mann zu Besuch gehabt, den er aus seiner eigenen Fanzeit als überaus aktiven Kollegen schätzte. Er hatte seinen Werdegang genau verfolgt und hielt große Stücke auf sein schriftstellerisches Potenzial und seinen Ideenreichtum.
Der 23-Jährige plauderte mit ihm über seinen Erstlingsroman »Sternenkämpfer«, der 1958 unter dem Namen William Ch. Voltz in der Reihe der Wieba-Leihbücher erschienen war, die der in Wuppertal-Barmen ansässige Wiesemann Verlag herausbrachte. Sein Buch hatte einen besonderen Stellenwert gehabt, denn es handelte sich um eine »Sonderausgabe der Buchgemeinschaft Transgalaxis«, genauer gesagt um den »1. Band für die Mitglieder«. Die Veröffentlichung war auf Betreiben des Gründers der Buchgemeinschaft Transgalaxis (TG), Heinrich Bingenheimer, erfolgt, der wie K. H. Scheer und Winfried Scholz Mitglied im Science Fiction-Club »Stellaris« war. Bereits 1957 hatte Bingenheimer eine SF-Anthologie herausgebracht, die auch zahlreiche Kurzgeschichten von William Chr. Voltz enthielt. Sie hatten den jungen Mann, der seitdem bei Bingenheimers Literarischer Agentur unter Vertrag war, deutlich aus der Fanszene jener Zeit hervortreten lassen.
Vielleicht hatten Scheer und Voltz sich bei ihrem Gespräch auch erinnert, dass dieses Leihbuch am 20. November 1959 als UTOPIA-Roman 200 unter dem Titel »Sternenkämpfer und Raumpiraten« seinen einzigen Heftnachdruck erlebt hatte – und das auch noch im Moewig-Konkurrenzverlag Pabel und mit dem einzigen Cover, das Johnny Bruck zu dieser Reihe jemals beitragen sollte. Oder wie ihr Club-Kamerad Heinrich Bingenheimer seinen Kunden den Erstlingsroman angekündigt hatte, nämlich dass der Autor ihnen von seinen beliebten Kurzgeschichten im Nachrichtenblatt von Transgalaxis her bekannt war und dass es sich um einen echten Leckerbissen handelte: »Das Manuskript lag einem größeren Kritikerkreis vor und der Prominenteste aus diesem Kreis, K. H. Scheer, faßte sein Urteil mit den Worten ›Das ist ein ausgezeichneter Roman‹ zusammen.«
Dem Leihbuch selbst hatte damals bei Erscheinen ein Blatt beigelegen, auf dem Bingenheimer die Entstehungsgeschichte der Sonderausgabe umriss: »Der Anfang! In diesen Tagen konnte TG die Vorarbeiten zur langerwarteten ersten Mitgliederausgabe zum Abschluß bringen. Da die Mitgliederzahl TG’s einerseits erst mit rund 1.200 zu Buche steht, andererseits aber auch die täglichen Anfragen und Wünsche der Mitglieder Beachtung finden müssen, habe ich mich schon jetzt zu dieser Publikation entschlossen und mit dem Verlag zwecks Rentabilität der Auflage, und um einen günstigen Mitglieder-Preis zu ermöglichen, vereinbart, daß eine weitere kommerzielle Auflage von 300 Exemplaren gedruckt werden kann, die im Leihbuchhandel vertrieben wird. Die Gesamtauflage beträgt 1.500 Exemplare und somit wird dieses Buch im Handel nicht zu haben sein. Die Mitgliederausgabe erscheint in Sonderausstattung, Ganzleinenband mit Prägung, Widmungsvorsatz, gutes Papier und vierfarbigem Titel-Schutzumschlag.«
Und auf dem Buch selbst machte auch der Klappentext einiges her: »Wenn die Buchgemeinschaft Transgalaxis – Deutschlands führender Utopia-Spezial-Versand – gerade dieses Werk ihren Mitgliedern widmet, ist dies ein Werturteil par excellence. Aus vielen Manuskripten ausgewählt, besticht dieser Roman in seiner großartigen Spannung, in seinen Ideen und mit seiner flüssigen Sprache.« Und man verhehlte den Lesern auch nicht, worum es ging: »Die Geschichte beschreibt eine Zukunft, die trotz aller phantastischen Ereignisse immer real bleibt. Es ist die Geschichte Wade Quentin’s, des Beauftragten der Sternenkämpfer-Liga, erzählt von dem positronischen Gehirn seines Robotgefährten SHAW mit der Seriennummer TNA 347–56. Die Truppe der Sternenkämpfer wurde aufgestellt, als im Jahre 2495 die vereinigten Sternkolonien den Krieg gegen den Mutterplaneten Terra begannen. Es war ein einsamer und fast aussichtsloser Kampf, den dieses Team begann – ein Kampf gegen Menschen und Dinge – gegen Zeit und Wissen einer fernen Epoche.«
Bingenheimer, der diesen Text verfasst hatte, überschlug sich darin fast vor Begeisterung. »Welche Macht besitzt der extraterrestische Telepath des Planeten BOSTIK und auf wessen Seite steht er? Wer ist der eigentliche Feind am Rande der Milchstraße – sind es die Raumflotten der Rebellen oder die Söldner der Sternenreiche? Der Friede eines Universums steht auf dem Spiel und Wade Quentin hat nichts als den Willen, ihn zu erhalten. SHAW, der Robot, ist mehr als eine Kampfmaschine – er ist humanoid und … das müssen Sie selbst lesen – es ist einmalig erzählt! Gehen Sie mit Quentin und SHAW diesen Weg ins phantastische Abenteuer. Versuchen Sie die Lektüre vor dem Schluß einzustellen – es wird Ihnen unmöglich sein! Sternenkämpfer – eine großartige Space Opera über Raum und Zeit!«
Die Begeisterung seines ersten Mäzens, die zur Veröffentlichung des Erstlings geführt hatte, wird Willi Voltz bei jenem schicksalhaften Treffen in Friedrichsdorf sicher durch den Kopf gegangen sein – und auch, dass der Roman bei den Lesern keineswegs gut angekommen war. Im Gegenteil! Bei der regelmäßigen Umfrage des Science Fiction Club Deutschland war er sogar zum schlechtesten Roman des Jahres 1958 »gekürt« worden.
Bestimmt wird ihm auch bekannt gewesen sein, dass es das Wieba-Label nur drei Jahre lang gegeben hatte. Nur vierzehn Bücher waren bis 1959 herausgekommen – neben seinem Erstling »Sternenkämpfer« noch drei weitere Erstlinge deutscher SF-Autoren, die witzigerweise sämtlich den Vornamen Jürgen trugen, allen voran der damals achtzehnjährige Jürgen Grasmück, der als Jay Grams veröffentlichte. Andere erstveröffentlichende »Jürgen« waren der damals ebenfalls achtzehnjährige Jürgen vom Scheidt mit »Männer in Raum und Zeit« gewesen und Jürgen Duensing, damals schon satte neunzehn, mit »Die Flucht aus dem All«. Er schrieb seine wenigen SF-Werke unter dem Namen J. C. Dwynn, und nur bis 1966. Die drei »Jürgen« hatten gemeinsam neun Titel des Wieba-Labels bestritten!
Aber noch konnte Willi Voltz aus Offenbach nicht ahnen, als Scheer dieses Gespräch mit ihm führte, dass Jürgen Grasmück aus dem Nachbarort Hanau später als J. A. Garrett für die Konkurrenzserie REX CORDA tätig sein und als Dan Shocker in Deutschland das Genre des Grusel-Krimis erfinden sollte. Oder dass Jürgen Duensing aus dem nahen Aschaffenburg schließlich in allen möglichen Genres vom Western bis zum Fürstenroman an die tausend Heftromane verfassen sollte, während er nebenbei noch ein Antiquariat führte.
Und doch war es ein schicksalhaftes Treffen in Friedrichsdorf, denn K. H. Scheer schlug dem jungen Mann namens Willi Voltz die Mitarbeit an PERRY RHODAN vor, einer neuen SF-Serie, für die dringend Autoren gesucht wurde, und als dieser das Heinrich Bingenheimer mitteilte, reagierte der Literaturagent hocherfreut, zerriss vor den Augen des jungen Mannes den Vertrag und wünschte ihm alles Gute auf seinem neuen Lebensweg.
In ihren persönlichen Erinnerungen schreibt Inge Mahn, die Witwe des angehenden neuen Starautors, mehr als vierzig Jahre später: »Willi machte sich an die Arbeit. Er las alle bisher erschienenen PERRY RHODAN-Romane und die Exposés, um dann den Roman zu schreiben, der später als Nr. 74 erscheinen sollte. Bis dahin war es jedoch noch ein weiter Weg. Die erste Fassung brachte Willi zu K. H. Scheer, der nach Überprüfung des Manuskripts einige Änderungen und Korrekturen vornahm. Willi schrieb alles noch einmal. Daraufhin wurde das Manuskript an Günter M. Schelwokat gesandt. Dass ein junger Neu-Autor nicht ungeschoren an der Kritik des großen SF-Meisters vorbeikam, war jedem klar. Willi hörte sich die Kritik an, akzeptierte die Änderungsvorschläge, die nicht unbedingt freundlich vorgebracht wurden, und machte sich erneut an die Arbeit.«
Inge Mahn weiß auch zu berichten, dass das Thema dieses Romans erst bei dem Treffen in Friedrichsdorf besprochen wurde. Die Handlung blieb bewusst in sich abgeschlossen. Falls der Roman nicht den Anforderungen entsprechen und der Verlag das Manuskript ablehnen sollte, durfte sich das nicht nachteilig auf die ganze Serie auswirken.
Und das war durchaus ein kluger Schachzug, denn als Cheflektor Kurt Bernhardt erfuhr, dass der Autor von »Sternenkämpfer und Raumpiraten« einen Proberoman verfasste, reagierte er zunächst mit einem heftigen: »Was? Dieser Schmierfink?!« Doch die einfühlsame Schilderung der handelnden Figuren und die Dichte des Geschehens überzeugten auch den erfahrenen Lektor. Am 16. Oktober 1962 unterschrieb er den Vertrag für »Der falsche Mann«. Der junge Autor war vor Freude fassungslos, und Scheer nannte den frischgebackenen Kollegen noch dreißig Jahre später »meinen Schüler Willi Voltz«.
Das Exposé zum betreffenden Roman wurde erst nachträglich geschrieben. Scheer versah das fertige Manuskript, als die Durchschläge allen Mitarbeitern zugeschickt wurden, mit dem Hinweis: »Bei dem vorliegenden Roman handelt es sich um jenen Rhodan-Band, der von Willi Voltz anhand eines Separatexposés probehalber geschrieben wurde. Der Roman ist qualitativ gut, weshalb er auch vom Verlag angenommen wurde.« Aber das so genannte Separatexposé gab es überhaupt nicht. Der junge Voltz hatte den Roman anhand der Notizen geschrieben, die er während der Besprechungen in Friedrichsdorf gemacht hatte.
Der Roman erschien am 2. März 1963 als PERRY RHODAN-Band 74, »Das Grauen« – und seitdem gehörte William Voltz fest zum Autorenteam.
Kurzbiografie: William Voltz
Wilhelm Karl Voltz, genannt WiVo, wurde am 28. Januar 1938 in Offenbach bei Frankfurt am Main geboren. Die Mutter war Erzieherin und Kindergärtnerin, der Vater wirkte bei der Firma ATE unter anderem an der Entwicklung von Bremsanlagen mit und arbeitete als Dachdecker. Nach der Volksschule wechselte Voltz auf das Leibniz-Gymnasium in Offenbach, bevor die Familie vor dem Bombenhagel nach Hainhausen flüchtete. Dem Willen der Mutter zufolge, die 1952 an Brustkrebs starb, sollte er eigentlich Theologie studieren, begann aber zwei Jahre nach ihrem Tod, als der Vater erneut geheiratet hatte, eine Lehre als Stahlbauschlosser. Aus Widerwillen arbeitete er lieber als Vorzeichner und Kranführer. Für den Wehrdienst wurde er zwar wegen Farbenblindheit und eines falsch zusammengewachsenen Fußes für untauglich befunden, aber weil er den Dienst an der Waffe als überzeugter Pazifist aus ethischen Gründen ablehnte, beharrte er auf einer Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. Er gewann das erforderliche Verfahren und leistete Ersatzdienst als Sanitäter.
Bereits als Schüler war Voltz begeisterter Leser der von Darlton herausgegebenen UTOPIA-Heftreihen und wurde 1956 – ein Jahr nach der Gründung – eines der ersten Mitglieder des SFCD. Als im folgenden Jahr mit »Lockende Zukunft«, herausgegeben von Heinz Bingenheimer, die erste deutsche SF-Anthologie erschien, waren neun der 35 Beiträge von ihm. Im Sommer 1958 gründete er – mit K. H. Scheer als Präsident – die »Stellaris« Science Fiction Interessengemeinschaft, für die er die Chefredaktion des Fanzines STELLARIS übernahm. Sein erster Roman, im Herbst desselben Jahres als Leihbuch erschienen und 1959 als UTOPIA-Heft 200 nachgedruckt, wurde vom SFCD zwar zum schlechtesten Roman des Jahres gewählt, doch kurz darauf errang Voltz den ersten Preis des Kurzgeschichtenwettbewerbs der SSFI, und 1961 ehrte der SFCD ihn für seine Erzählungen als besten Autor des deutschsprachigen Fandoms.
Nach seinem Einstieg bei PERRY RHODAN mit Band 74, »Das Grauen«, etablierte er sich schnell als Stammautor, und ab 1969 war er auch an der Schwesterserie ATLAN beteiligt. Zunächst schrieb er parallel an beiden mit, später zeichnete er bei ATLAN »nur« noch für die Exposés verantwortlich. 1973 startete DRAGON, die erste deutsche Fantasy-Serie, mit einer Trilogie von ihm, und 1980 brachte er als Exposé-Redakteur den Nachfolger MYTHOR auf den Weg. Im September 1978 war der erste PERRY RHODAN SILBERBAND erschienen, für den er neunzehn Bände lang die Originalhefte bearbeitete – auch indem er sie von den gelegentlichen Tendenzen der Sechzigerjahre befreite. Damals erkrankte Voltz an einem Gewächs, das seine Bauch-Aorta umschloss, hielt dies aber geheim. Er konzipierte die Serie, deren Exposés er als offizieller Nachfolger von K. H. Scheer seit Band 648 schrieb, bis weit in die 1200er Bände hinein und baute Thomas Ziegler als Nachfolger auf, der gemeinsam mit Vlcek sein Erbe antrat. Sein letzter PERRY RHODAN-Roman war Heft 1165, »Einsteins Tränen«.
Voltz hat neben Scheer und Darlton die PERRY RHODAN-Serie als Person sicher am nachhaltigsten geprägt. Sein Tod am 24. März 1984 hätte fast das Ende der Serie bedeutet, und unermesslich war die menschliche Lücke, die er hinterließ.
Perry Rhodans Sohn
Die Leser mussten jedoch nicht auf den Erstlingsroman von William Voltz warten, um eine personelle Überraschung zu erleben, auch wenn sie vorerst inhaltlicher Natur war. In der Vorweihnachtszeit 1962 wurde in Heft 67, »Zwischenspiel auf Siliko V«, vermutlich auf Betreiben Kurt Brands Thomas Cardif vorgestellt, Perry Rhodans Sohn aus seiner Ehe mit Thora. Einundzwanzig Jahre lang war der junge Raumkadett des Solaren Imperiums in dem Glauben aufgewachsen, einen arkonidischen General zum Vater zu haben. Als er im Handlungsjahr 2041 anlässlich seiner Volljährigkeit die Wahrheit erfährt, wendet er sich hasserfüllt gegen Rhodan. In seiner Machtbesessenheit will er sich zum Herrscher von Arkon aufschwingen und wird schließlich im Interesse der Menschheit mit einem Hypnoseblock versehen, so dass er das Wissen um seine Vergangenheit wieder verliert.
Durch das Eingreifen der Antis erhält Cardif sein Wissen zurück und gibt sich vier Jahre später dem Geistwesen ES gegenüber als sein eigener Vater aus, um den Zellaktivator in Empfang zu nehmen. Dieser ist jedoch auf Rhodans Individualimpulse abgestimmt, und so quillt Cardif unförmig auf und wird fast zweieinhalb Meter groß. Bei der Konfrontation mit seinem Vater in Heft 116, »Duell unter der Doppelsonne«, geht der Zellaktivator schließlich auf diesen über – Rhodans Sohn stirbt.
Kurt Brand, der Cardif nach Scheers Exposé in die Serie einführte und ihn hauptsächlich schilderte, hatte andere Erwartungen in diese Figur gesetzt. Noch in den Achtzigerjahren erklärte er, dass er mit ihrer Entwicklung sehr unzufrieden gewesen sei. »Während ich im Urlaub war, hat man mir Rhodans ersten Sohn zum Verbrecher gemacht, das hat mir bis heute nicht geschmeckt, das sollte er nicht werden.«
Erinnerungen eines Autors: Wie ich zur Science Fiction kam – von William Voltz
Mein Interesse an der Science Fiction erwachte eigentlich durch eine ganz ähnliche Serie, wie PERRY RHODAN sie zu Beginn war, durch JIM PARKER. Sie war ein sehr schwacher Versuch gewesen, SF in Deutschland zu etablieren, mit Kriminalromanen, die im Weltraum spielten und nicht über den Bereich des Mondes hinausgingen. Ich las von diesen Romanen ein gutes Dutzend, verlor dann aber rasch das Interesse, weil ich feststellte, dass sie nach einem gewissen Schema geschrieben waren und der Phantasie deshalb nicht den Anreiz boten, den ich mir wünschte.
Dann kamen die ersten Übersetzungen angelsächsischer SF-Romane in Deutschland auf den Markt, und es wurde sehr deutlich, dass ein großer Niveauunterschied zwischen JIM PARKER und diesen Romanen bestand. Mein Interesse an der SF wurde damals neu geweckt, und ich trat einer Interessengemeinschaft bei. Die Leute, die dort Mitglied waren, trafen sich regelmäßig jede Woche, um über Probleme zu diskutieren, die im SF-Rahmen behandelt werden. Und es wurden Kurzgeschichtenwettbewerbe veranstaltet, an denen ich mich beteiligte, teilweise sogar mit recht gutem Erfolg, so dass eines Tages der Inhaber einer Buchgemeinschaft an mich herantrat und mich fragte, ob ich mich nicht an einem Roman versuchen wollte. Das habe ich dann auch getan. Der Roman – er hieß übrigens »Sternenkämpfer« – war erfolgreich, und so bin ich zur PERRY RHODAN-Serie gestoßen, zunächst als Autor. Die Serie hat sich dann weiterentwickelt, und so hat es sich ergeben, dass ich inzwischen für die Handlung oder den Handlungsverlauf verantwortlich bin. Das ist eine Arbeit, die mir sehr viel Spaß macht, aus dem einfachen Grund, weil ich dabei meine Phantasie voll ausleben kann.
(Aus einem Radio-Interview, das Jochen Maes
am 25.11.1977 mit William Voltz führte)
Krise der Unsterblichkeit
Die Handlungszeit schritt fort, und allmählich musste geklärt werden, was aus Rhodans arkonidischen Freunden werden sollte. Seine engsten Mitarbeiter erhielten genau wie Rhodan auf dem Planeten Wanderer regelmäßige Zellduschen, die für jeweils 62 Jahre den Alterungsprozess stoppten, und Atlan besaß schon seit 8980 v. Chr. ein eiförmiges Gerät namens Zellaktivator, das er als 40-Jähriger erhalten hatte. Doch Thora und Crest, denen Rhodan auf dem Erdmond begegnet war, unterlagen dem normalen Alterungsprozess – und ES verweigerte ihnen die Zelldusche.
Auch hier brillierte Kurt Brand mit seinen Ideen: In Heft 51, »Jagd nach dem Leben«, ruhte Rhodans ganze Hoffnung, auch seiner Frau die Unsterblichkeit zu ermöglichen, noch auf den Fähigkeiten der Aras oder Galaktischen Mediziner. Die Telepathen John Marshall und Laury Marten hatten den sechs Meter langen, schlangenähnlichen Froghs – die vermutlich den Froggs der 1966 gestarteten deutschen SF-Fernsehserie »Raumpatrouille Orion« den Namen liehen –, ein Serum zur Lebensverlängerung entrissen, das die Erwartungen jedoch nicht zu erfüllen schien. Erst in Heft 78, »Thoras Opfergang«, kam es zu einer spontanen Heilung, von der Rhodan allerdings nie erfuhr, da ein gefangener Ara seine Frau bei einem Verhör erschoss. Nach Thoras Tod reichte Rhodan ihrem gemeinsamen Sohn Thomas Cardif vergeblich die Hand zur Versöhnung – der Roman wurde zu einem Meilenstein in der PERRY RHODAN-Serie.
In Heft 99, »Ein Freund der Menschen«, sein drittes Werk und ein weiterer Meilenstein, beschrieb William Voltz, wie der alternde Crest sich auf einen einsamen Planeten zurückzieht, um dort ungestört sein Leben zu beschließen und im Kampf gegen Unither, die ihn als Repräsentanten des Robotregenten von Arkon betrachten, sein Leben lässt.
»Thoras Opfergang«, in dem die Arkonidin bei gerade einsetzender Verjüngung erschossen wird, ist noch in anderer Hinsicht bedeutsam für die PERRY RHODAN-Serie. Das Heft enthält den Anschnitt eines unterirdischen Stützpunkts der Arkoniden, gezeichnet von Johnny Bruck, der zusätzlich zu den Titelbildern auch die Innenillustrationen der Serie lieferte. Diese Skizze sollte in dem 15-jährigen Leser Bernhard Stoessel, der als gebürtiger Amerikaner seit 1961 in Deutschland arbeitete, den Wunsch wecken, ebenfalls solche Zeichnungen anzufertigen. Dabei kam ihm Rudolf Zengerle zuvor, der in Heft 192 die erste Risszeichnung veröffentlichte; aber ab Heft 432, das 1969 erschien, sollte Bernard Stoessel ihn unterstützen. So entstanden bis Band 1000, als er mit einem Poster des Fernraumschiffs SOL seinen Abschied nahm, mehr als sechzig Risszeichnungen.
Die Wirkung des Roten Universums
Am 8. Februar 1963, eine Woche nach dem Einstand von William Voltz bei der Serie, erschien mit Heft 75 ein kleiner Jubiläumstitel, der die Bedeutung des Handlungsfadens der Druuf herausstellt. Es ist das fünfte Atlan-Abenteuer, und K. H. Scheer schildert, dass der Arkonide bereits mit diesen Wesen zu tun hatte, denn im neunten Jahrtausend vor Christus erhielten sie durch ein Naturereignis schon einmal die Möglichkeit, eine Überlappungsfront mit dem Standarduniversum zu nutzen. Damals entführten sie arkonidische Siedler von der Venus und griffen die Erde an, was zum Untergang von Atlantis führte. Scheer hatte davon im vorangegangenen Atlan-Abenteuer berichtet …