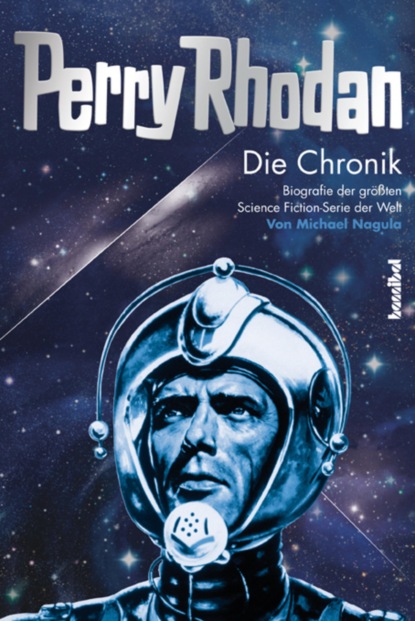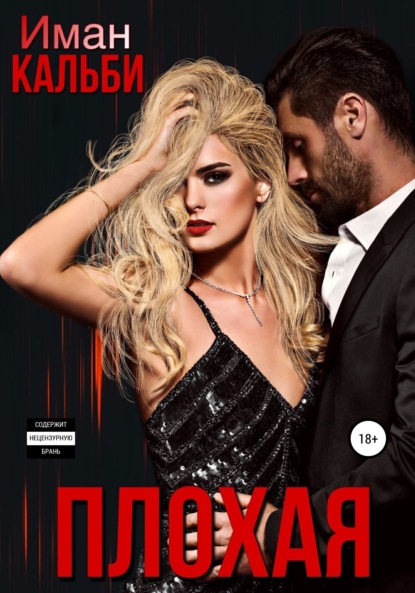- -
- 100%
- +
Und deshalb weiß Atlan auch, wie die Druuf aussehen – diese drei Meter großen, klobig wirkenden Wesen mit schwarzer Lederhaut ohne jede Behaarung. Ihr Kopf ist kugelförmig, hat vorne und hinten zwei Augen, die Beine sind säulenartig, die Hände haben fünf erstaunlich zartgliedrige Finger, und sie verständigen sich auf Ultraschallbasis. Sie glauben an einen kollektiven Lebenszyklus ihres Volkes, der sich über alle Zeiten erstreckt. Vergangenheit und Zukunft sind für sie deshalb nur irreale Gedankenkonstrukte.
Als sich in der Nähe des Myrtha-System eine Überlappungsfront bildet, wird für das Solare Imperium der Notstand ausgerufen. Atlan startet mit erheblichen Rachegelüsten an Bord des neuen 1500-Meter-Superschlachtschiffs KUBLAI KHAN und stellt fest, dass der Robotregent von Arkon bereits eine Flotte von 30.000 Schiffen entsandt hat, die sich eine erbitterte Schlacht mit dem unsichtbaren Gegner liefern. Perry Rhodan bemüht sich indessen, im Universum der Druuf einen Transmitter zu stationieren, um unbemerkt handeln zu können. Als das gelingt, wird die Einsatzgruppe aus Rhodan, Atlan und Fellmer Lloyd, der unter einer Darmerkankung leidet, von einer unbekannten Gegenstation eingefangen und sofort wieder mit einer Entschuldigung, die sie in ihren Köpfen vernehmen, zurückgeschickt. Wer ist der Unbekannte, der sie nach Druufon geholt und dann wieder abgestrahlt hat?
Die Antwort gibt der folgende Doppelroman von Clark Darlton. Mit Hilfe des Energiewesens Harno, das ferne Geschehnisse auf seine Oberfläche projizieren kann, begibt man sich erneut nach Druufon und vernimmt auch diesmal eine telepathische Stimme. Gucky ermittelt, dass sie dem Chefphysiker der Druuf namens Onot gehört, dessen Körper von einem Geistwesen bewohnt wird. Er arbeitet an einem geheimen Projekt, dem Zeiterstarrer, ein Wissen, das ihnen später hilft, in ihre Dimension zurückzukehren.
Im Folgeroman wird das Einsatzteam davon benachrichtigt, dass der einstige Teletemporarier Ernst Ellert in seinem Mausoleum auf Terra wieder zum Leben erwacht ist. Er teilt ihnen Geheimnisse mit, die er in Onots Geist gelesen hat – die Funktionsweise des Zeiterstarrers und des Linearantriebs der Druuf, der einen überlichtschnellen Raumflug »auf Sicht« zu einem Ziel ermöglicht. Durch diese Technik kann im so genannten Halbraum die kontinuierliche Orientierung anhand eines gewählten Zielsterns erfolgen, was in den nächsten Jahrhunderten den Raumflug der Terraner revolutionieren wird. Beide Erfindungen lässt Perry Rhodan sich auf Druufon von Onot-Ellert aushändigen.
In dem Doppelband 79/80 von Kurt Mahr beschließen Rhodan, Atlan, Fellmer Lloyd und Reginald Bull, den Robotregenten in einem Blitzangriff zu vernichten, werden aber gefangen genommen und auf ein Raumschiff der Ekhoniden überführt, Abkömmlingen arkonidischer Siedler, bis sie wiederum von den Druuf gefangen genommen und auf einen Ammoniak-Methan-Riesen gebracht werden. Im zweiten Heft führt Onot-Ellert das Einsatzsteam telepathisch zu dieser Gefängniswelt, wo alle vier von Ras Tschubai und Gucky geborgen werden.
In Heft 82, ebenfalls von Kurt Mahr, beschließt Rhodan, den Robotregenten zu täuschen. Daher reist Oberst Julian Tifflor zum Heimatplaneten der Druuf, um sie mit Ernst Ellerts Hilfe dazu zu bewegen, die arkonidischen Schiffe anzugreifen, aber die Druuf verlangen seine Unterstützung bei der Abwehr der arkonidischen Robotflotte. Kurz darauf, in Heft 91, schildert Clark Darlton die Anfänge des Zusammenbruchs der Zeitüberlappung. Onot wird auf Druufon verhaftet, und Ellert, der sich nicht mehr von ihm befreien kann, verhilft dem Wissenschaftler zur Flucht – gerade lange genug, bis Gucky seinen Geist wegteleportiert. Im Mausoleum auf Terra sind die Zerfallserscheinungen an Ellerts Körper dann so schlimm, dass der rechte Arm gegen eine Prothese mit Hypnostrahler ausgetauscht wird. In Heft 94 von Darlton schließt sich der Übergang ins Rote Universum langsam.
Die Handlung um Ernst Ellert mit den Druuf wurde eingerahmt von den ersten beiden Romanen von William Voltz, und mehr als fünfundvierzig Realjahre sollten vergehen, bis die Druuf in der Serie wieder eine Rolle spielten. Erst 2009/2010 startete im Heyne Verlag mit Wim Vandemaan alias Hartmut Kasper als Exposé-Autor die PERRY RHODAN-Trilogie »Das Rote Universum«, in der es um eine weitere Überlappungsfront geht, bei der Menschen nach Karwick umsiedeln, wie das Rote Universum nun heißt. Sie wollen den dortigen beschleunigten Zeitablauf nutzen, um genug Zeit zur Entwicklung wirksamer Waffen gegen TRAITOR zu haben, eine in mehreren Universen operierende dezentrale Organisation, die im »Negasphäre«-Zyklus der Serie gegen die Streitkräfte der Kosmokraten kämpft. Die Heyne-Trilogie konzipierte Vandemaan unter Mitwirkung seiner Kollegen Christian Montillon und Michael Marcus Thurner, die auch die ersten beiden Bände verfassten.
Übrigens gibt es neben der Risszeichnung eines Raumschiffs der Druuf in PERRY RHODAN 875, die Christoph Anczykowski anfertigte, auch ein von Hand nachbearbeitetes und patiniertes Zinnmodell, das der auf 145 Exemplare limitierten Vorzugsausgabe der SILBER EDITION von »Vorstoß nach Arkon« beilag. Es wiegt 375 Gramm, bei einer Höhe von zehn Zentimetern, und stammt von dem Figurendesigner Klaus Meyer. Die SILBER EDITION ist ein gigantisches Hörbuch-Projekt, in dem die SILBERBÄNDE auf jeweils zwölf oder dreizehn CDs von Josef Tratnik für Eins-A-Medien in Köln eingesprochen werden. Diese Hörbuchserie erscheint bereits seit 2002 und mittlerweile sogar viermal im Jahr als Normalversion und limitierte Vorzugsausgabe.
Und was machen die losen Fäden?
Perry Rhodans Absicht sollte natürlich glücken. Er will den Robotregenten, der nach Meinung der terranischen Spezialisten über eine Sicherheitsschaltung verfügen muss, ausschalten. Mit einer kleinen Schar Spezialisten, darunter auch Atlan, sickert er ins Zentrum von Arkons Macht ein – und der ursprüngliche Plan scheitert.
Aber dafür wird Atlan als nicht degenerierter Arkonide aus der Blütezeit des Imperiums anerkannt, und eine Sonderschaltung spricht an, die den Robotregenten wieder zur untergeordneten Maschine macht. Atlan übernimmt daraufhin als Imperator Gonozal VIII. die Herrschaft über das Große Imperium. Als es kurz darauf den Springern gelingt, die Position Terras herauszufinden, greift Arkons Flotte auf der Seite der Menschheit ein.
Gucky hingegen hat einen großen Verlust zu beklagen: Sein Heimatplanet Tramp wird in Zuge eines Experiments von insektoiden Aliens vernichtet, und der Mausbiber kann lediglich 28 seiner Artgenossen vor dem Untergang retten, darunter Iltu, seine spätere Frau. Die anschließende Suche nach den Mördern seines Volkes schilderte Clark Darlton in einem PLANETENROMAN, der sicher nicht zufällig die überlebende Anzahl seiner Artgenossen als Titelnummer trägt, nämlich 28. Der Roman heißt »Gucky und die Mordwespen«.
Rätsel und Zellaktivatoren
Ab Heft 50 war es in erster Linie um die Gründung des Solaren Imperiums gegangen, um die Auseinandersetzungen mit dem Robotregenten von Arkon und die Bedrohung durch die Druuf aus dem Roten Universum, die durch Zeitüberlappung ganze Planeten unter ihren Einfluss bringen. Jetzt, im August 1963, startete der dritte Zyklus der Serie: »Die Posbis«. Auch er umfasste wieder fünfzig Hefte. Die Handlungsebenen wechselten nicht mehr so oft, aber der neue Zyklus ließ sich glatt in der Mitte teilen – und K. H. Scheer begann mit dem Aufbau seiner so genannten Rätselstruktur.
Jubiläumsheft 100, »Der Zielstern«, signalisierte jedermann unübersehbar: PERRY RHODAN hat sich etabliert, ein Ende ist nicht in Sicht. Auf die Handlung übertragen hieß das: Professor Arno Kalup entschlüsselt das Überlichttriebwerk der Druuf. Rhodan macht sich mit der FANTASY, dem ersten Fernraumschiff der Terraner, das 200 Meter Durchmesser hat, auf den Weg zum Zentrum der Galaxis und begegnet auf dem Planeten Sphinx dem Volk der Akonen, direkten Vorfahren der Arkoniden, die eine beachtliche Transmittertechnik entwickelt haben. Doch sie sind nicht das erwartete Ursprungsvolk der Menschheit! Damit legt Scheer den Grundstein für spannende Fragestellungen, die weit in die Zukunft der Serie reichen und zugleich die früheste Vergangenheit der Terraner ausleuchten.
Einen humorigen Beitrag zur Rätselstruktur leistete übrigens – vielleicht ungewollt – auch diesmal wieder der ideenreiche Kurt Brand: In Heft 97, »Der Preis der Macht«, schildert er die von den Arkoniden abstammenden Soltener, die neben einer buckelförmigen Stirn eine starke Rückgratverkrümmung aufweisen. Die Männer dieses Volkes sind in der Galaxis als Lügner verschrien, weil sie auf fremden Welten stets die matriarchalische Gesellschaftsform ihrer Heimatwelt zu verschleiern versuchen! Einerseits ein rüder Scherz über Pantoffelhelden, der noch stark das Flair der Fünfzigerjahre atmet – andererseits ein Vorgeschmack auf die umweltangepassten Terraner späterer Jahre …
Neben der Rätselstruktur entwickelte Exposé-Autor Scheer noch eine weitere Handlungsebene. Cardif lässt sich von dem Geistwesen ES nämlich nicht nur Rhodans Zellaktivator geben, sondern gleich zwanzig weitere, in deren Besitz sich die schon seit mehr als zehntausend Jahren existierende, galaxisumspannende Sekte der Báalols bringt. Doch die Aktivatoren erfüllen ihren Zweck nicht, sondern führen zu seltsamen Phänomenen. Also wird die Abteilung III unter Leitung von Oberst Nike Quinto darauf angesetzt, eine Unterorganisation der Solaren Abwehr, die sich als Interkosmische Soziale Entwicklungshilfe tarnt. In fünf Romanen schildert Kurt Mahr, beginnend mit Heft 102, »Abteilung III greift ein«, bis zur Halbzeit des Zyklus ihre Einsätze gegen Aras, Springer und Antis.
Endgültige Aufklärung über das Schicksal der zwanzig Zellaktivatoren sollte allerdings erst fünfzehn Jahre später ein PERRY RHODAN PLANETENROMAN geben. In Band 179, »Unsterblichkeit x 20«, lässt der Autor Peter Terrid Staatsmarschall Reginald Bull ganze fünf Tage Zeit, um diese Frage auf einer lebenswichtigen Mission zu beantworten.





Wechselbad der Gefühle
Die Erfinder von PERRY RHODAN erlebten eine aufregende Zeit – die Romane blieben nicht ihre einzigen Kinder. Ende 1963, als die Scheers ein selbstgebautes Haus in Harheim, damals noch vor den Toren Frankfurts, bezogen, hatte Clark Darltons zweite Frau Uschi den gemeinsamen Sohn Robert geboren. Ein halbes Jahr später brachte Heidrun Scheer das Töchterchen Corinna zur Welt – und Vater Karl-Herbert schrieb mit sichtlichem Stolz an den Verleger Rolf Heyne: »Ich bin noch immer wie benommen von dem Wunder, das aus einer mikroskopisch kleinen Eizelle entstand und Mensch wurde. Gegen dieses älteste Phänomen der Weltgeschichte ist der phantasievollste utopische Roman ein brüchiges Machwerk, dem nicht einmal eine Spur dieses unfasslichen Schöpfungsaktes anhaften kann …«
Dafür starb am 17. August ein enger Freund aus Fanzeiten. Scheer und Darlton hatten sich schon Anfang der Sechzigerjahre, als ihre Schriftstellerkarriere Fahrt aufnahm, aus der Fanszene zurückgezogen, doch beide hatten weiter mit Heinz Bingenheimer Kontakt gehalten, der ganz in Scheers Nähe wohnte. Darlton hatte unter dem Namen seines Freundes sogar mehrere SF-Romane übersetzt. Der Goldmann Verlag hatte ihn als »Heftchen«-Autor nicht beschäftigen wollen, doch das »unbeschriebene Blatt« Bingenheimer wurde für »seine« übersetzerischen Leistungen vom Lektor ausdrücklich gelobt!
Jetzt gönnte Darlton sich wieder einmal das Vergnügen, einen Western zu schreiben – diesmal nicht als Tom Chester für Kelter, sondern als Frank Haller für Bastei –, und als Bingenheimer starb, beendete er als letzten Liebesdienst ein Romanfragment, das unter ihren beiden Pseudonymen erschien. Als Darlton 1965 sein Domizil in Salzburg aufschlug, dachte er »in der Fremde« oft an seinen Freund, der so unerwartet gestorben war.
Allerdings hatte er in William Voltz auch einen neuen guten Freund gefunden. Die erste gemeinsame Autorenkonferenz 1963 in einem Münchner Nobelhotel hatte darin gegipfelt, dass sie Dutzende zum Putzen vor die Türen gestellter Schuhe vertauschten … und im November 1964 gab es wieder eine Konferenz, bei der Willis Frau einen Schuh in einer Schneewehe verlor – er wurde erst im folgenden Frühjahr gefunden.
Kurzbiografie: Heinz Bingenheimer
Eine der einflussreichsten deutschen SF-Persönlichkeiten der Fünfzigerjahre war der 1923 in Köppern/Taunus geborene Heinz Bingenheimer. Nach dem Kriegsabitur und Dienst in der Marine war er von Kriegsende bis 1957 als selbständiger Handelsvertreter tätig. 1956 erschien unter dem Pseudonym Henry Bings sein Leihbuch »Welten in Brand«, in dem eine Rasse von Zentauren eine zweite Heimat auf der Venus findet, und im Folgejahr mit »Lockende Zukunft« die erste deutschsprachige SF-Anthologie, die Beiträge von Clark Darlton, K. H. Scheer, Willi Voltz, Wolfgang Jeschke, der später Schelwokats Nachfolger als SF-Herausgeber bei Heyne werden sollte, und Jay Grams alias Jürgen Grasmück enthielt, der als Dan Shocker den Gruselkrimi einführte. Als 1955 der Science Fiction Club Deutschland (SFCD) aus der Taufe gehoben wurde, übernahm Bingenheimer den angeschlossenen Buchclub. Im September 1957 gründete er die auf SF spezialisierte Buchgemeinschaft Transgalaxis. Durch sie nahm er Einfluss auf die Programmgestaltung der Leihbuchverlage und führte Autoren wie Stanislaw Lem und Philip K. Dick in Deutschland ein. Mit dem »Katalog der deutschsprachigen utopisch-phantastischen Literatur aus fünf Jahrhunderten 1460–1960« veröffentlichte er auch die erste deutsche SF-Bibliografie. Als er am 17. August 1964 einem Herzinfarkt erlag, hinterließ er das Fragment eines zweiten Romans, »Der Sprung ins Nichts«, den Clark Darlton nach den Vorstellungen seines Freundes fertig stellte.
Seid ihr wahres Leben?
Posbis, positronisch-biologische Roboter – sie waren die Helden der zweiten Hälfte des gleichnamigen dritten Zyklus. Als die Terraner der Spur einer galaktischen Seuche folgen, gelangen sie nach Mechanica, einem Planeten außerhalb der Galaxis. Vor 30.000 Jahren wurde dort die inzwischen ausgestorbene Echsenbevölkerung, geniale Robottechniker, von den Laurins gezwungen, hochwertige Roboter herzustellen. Als der Planet in einem Atombrand vergeht, entdecken die Terraner an Bord eines Fragmentraumers der Roboter eine Schaltung, die diese gegen alles organische Leben aufbringt. Perry Rhodan, Atlan und Fellmer Lloyd gelingt es auf der Hundertsonnenwelt, der Hauptwelt der Posbis, diese Hass-Schaltung zu neutralisieren. Die Posbis können die Laurins besiegen und fangen an, sich gegenseitig zu bekämpfen. Eine terranische Flotte beendet diese Kämpfe, und die lebenden Roboter werden zu treuen Verbündeten der Menschheit.
Die Posbis hatten ihren ersten Auftritt in Heft 128, »Mörder aus dem Hyperraum«, von William Voltz. Sie zählen zu den faszinierendsten Schöpfungen des Perryversums. Ihre Funkrufe »Seid ihr wahres Leben?« und der Aufschrei des Plasmas »Liebt das Innere, rettet das Innere!« appellieren an das Herz jedes Lesers.
Bisweilen wird auf die Ähnlichkeit der Posbis mit den Berserkern aus Fred Saberhagens gleichnamigem SF-Zyklus hingewiesen. Auch die Berserker sind Roboter, die Hinterlassenschaft einer oder mehrerer Rassen, die sie als Kriegsgeräte entwickelten. Sie funktionieren so gut, dass sie ihre Erbauer vernichteten und sich danach aufmachen, alles Leben auszulöschen. Doch »Goodlife«, die erste der mehr als dreißig Geschichten und drei Romane über die Berserker, erschien erstmals 1963 in den USA – nur wenige Monate vor der Niederschrift des entsprechenden PERRY RHODAN-Exposés. Ein alter Topos der Science Fiction lag anscheinend wieder in der Luft: das Frankenstein-Motiv von der Maschine, die sich gegen ihre Erbauer wendet, um schließlich alles Leben zu bedrohen.
Essay: Technobabbel bei PERRY RHODAN – von William Voltz
Es gibt eine spezielle Sprache, eine Fachsprache, in der Serie. Das hängt damit zusammen, dass die Schöpfer – das waren Herr Ernsting und Herr Scheer – von Anfang an einen eigenen Sprachgebrauch entwickelt haben, der sich vor allem auf technische Dinge bezieht. Wenn man innerhalb eines Romans ein Raumschiff schildert, dann wird es mit seinen Triebwerken, Antigrav-Projektoren, Computern und was auch immer sich an Bord befindet geschildert, und zwar im Detail. Da dieses Raumschiff in unserer heutigen Zeit natürlich nur eine fiktive technische Schöpfung sein kann, galt es, über die Beschreibung hinaus auch Begriffe zu finden für das, was da geschildert wird. Und da haben wir versucht, abgeleitet aus den klassischen Sprachen, Wortschöpfungen vorzunehmen, die den jeweiligen Gegenständen entsprechen. So hat sich im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, eine eigene PERRY RHODAN-Sprache herausgebildet.
Man sollte das natürlich nicht überbewerten. Diese Sprache bezieht sich ausschließlich auf die Technik in der Serie, und die macht ja nur einen Teil der Romane aus. Dennoch zeigt sich, dass Leser, die neu zu PERRY RHODAN stoßen, Schwierigkeiten haben, den einen oder anderen Begriff zu verstehen. Sie brauchen meistens mehrere Bände, um dann anhand von Vergleichen zu erkennen, was überhaupt gemeint ist. Und zu diesem Zweck gibt es ein Lexikon. In dem werden neben gängigen naturwissenschaftlichen Begriffen auch die Worte abgehandelt, die innerhalb der Serie entstanden sind.
Ein gutes Beispiel aus jüngster Zeit ist der Para-Null-Korridor. Das ist eine typische PERRY RHODAN-Wortschöpfung. Damit wird eine schlauchartige Verbindung zwischen unserem normalen Einstein-Universum, dem dreidimensionalen Kontinuum, zu einem übergelagerten Medium, dem so genannten Hyperraum, bezeichnet. Durch diesen Para-Null-Korridor kann eine fremde Zivilisation Energien aus dem Hyperraum anzapfen. Diese Energien werden dann durch den Korridor an Bord der Raumschiffe geleitet, wo sich Generatoren und Aggregate befinden, die sie aufnehmen und speichern.
Es gibt sogar Beispiele innerhalb der PERRY RHODAN-Serie, dass Schöpfungen, die wir uns ausgedacht haben, mittlerweile technisch realisiert wurden, oder zumindest wird versucht, sie zu realisieren. Da wäre etwa die SERT-Haube, auch ein typisches Wort aus der Serie. Die SERT-Haube ist eine Art Helm, der vom Piloten des Raumschiffs getragen wird. In diesem Helm befinden sich Sonden und Elektroden, die einen unmittelbaren Kontakt zum Gehirn des Menschen, zu seinem Bewusstsein, ermöglichen. Der Pilot ist dadurch in der Lage, das Raumschiff in Gedankenschnelle zu steuern und zu fliegen. Die Zeitverzögerung, die durch eine manuelle Bedienung gegeben ist, bis der Befehl vom Gehirn an die Hände geht, und auch die Zeit für den Arbeitsakt der Hand am Steuergerät wird dadurch erspart. Das Raumschiff ist spontan und direkt steuerbar. Uns ist bekannt, dass in England von Wissenschaftlern gerade eine ähnliche Methode erprobt wird und dass damit schon große Erfolge erzielt wurden.
Es gibt noch zahlreiche weitere PERRY RHODAN-Wortschöpfungen, die sich in erster Linie auf Raumschiffe und deren Triebwerke beziehen, etwa das NUGAS-Triebwerk. Darüber hinaus gibt es aber auch Schöpfungen im parapsychologischen Bereich. So haben wir eine Reihe von Menschen in unsere Romanhandlung eingebaut, die außergewöhnliche psychologische Fähigkeiten haben, für die es ebenfalls galt, neue Worte zu finden. Zum Beispiel gibt es eine Mutantin, Irmina Kotschistowa, die Metabio-Gruppiererin ist, das heißt, sie besitzt die Fähigkeit, kraft ihres Geistes zellmolekulare Strukturen umzuwandeln. Ein anderer Mutant, Ribald Corello, ist Telepsimat und in der Lage, Materie aus dem Nichts heraus zu schöpfen und sie geistig von einem Punkt an einen anderen zu transportieren. Solche Beispiele gibt es noch beliebig viele.
In diesen Bereichen erstreckt sich also das Vokabular der Serie.
(Aus einem Radio-Interview, das Jochen Maes
am 25.11.1977 mit William Voltz führte)
Die Taschenbücher kommen
Vielleicht hing es damit zusammen, dass die SF-Titel, die Günter M. Schelwokat im Heyne Taschenbuch Verlag herausgab, immer erfolgreicher wurden und dort mit K. H. Scheer schon ein Erfinder von PERRY RHODAN verlegt wurde. Vielleicht sah man auch voraus, dass der Leihbuchausgabe der Serie keine lange Zukunft beschieden sein würde, weil überall die Leihbüchereien schlossen, oder man suchte ganz einfach nach neuen Märkten … jedenfalls erschien im September 1964, fast auf den Tag genau drei Jahre nach dem Start der Heftserie, das erste PERRY RHODAN-Taschenbuch unter dem Reihentitel PLANETENROMAN.
Das Konzept reichte bis Ende 1962 zurück, als vermutlich Kurt Bernhardt die Idee zu einer monatlichen Taschenbuchreihe hatte. Es gab jede Menge Stoff. Zu kurz gekommene Themen, offene Fragen und interessante Nebenfiguren der Serie konnten aufgegriffen und die Zeitsprünge zwischen den einzelnen Zyklen »ausgepolstert« werden – auch als Testgebiet für neue Autoren, die man nicht gleich auf die Serie loslassen wollte, waren die Taschenbücher nicht zu verachten. Schon bald wurden Manuskripte angefordert. Das erste, »Planet der Mock« von Clark Darlton, soll im Frühjahr 1963 eingereicht worden sein, und Band 3, »Schatzkammer der Sterne«, Kurt Brands einziger PLANETENROMAN, wurde im Mai 1963 angenommen und bezahlt, also anderthalb Jahre vor Erscheinen.
Im Laufe der Zeit kristallisierten sich immer mehr Privatserien der Autoren innerhalb der Reihe heraus. So nahm sich Clark Darlton in Band 4, »Sturz in die Ewigkeit«, des körperlosen Zeitreisenden Ernst Ellert an, der im Taschenbuch insgesamt dreimal Geheimnisse um Raum und Zeit und den Ursprung der Menschheit lösen sollte, zuletzt sogar ein Rätsel, das die Serienleser schon seit Heft 19, »Der Unsterbliche«, beschäftigte … und während Kurt Mahr, der »Physiker vom Dienst«, sich in seinen PLANETENROMANEN eher Durchschnittsmenschen widmete wie der Abteilung III oder Julian Tifflor und Fellmer Lloyd, beschäftigte William Voltz sich in jeweils drei Abenteuern mit zwei exotischen Raumschiffkommandanten, die er in die Serie eingeführt hatte – dem hünenhaften Afrikaner Nome Tschato und Don Redhorse, dem »Letzten der Cheyenne« …
Das Konzept ging auf – 34 Jahre lang – bis 1998!
Essay: Die Aufgabe der Science Fiction – von William Voltz
Ich glaube, dass die Beschäftigung mit SF nur auf den ersten Blick den Verdacht aufkommen lässt, hier werde der Versuch unternommen, Probleme zu verdrängen, die auf der Erde vorhanden sind, sie in den Weltraum zu verlagern und dann zu sagen, wir brauchen also nur eine Raumfahrt zu entwickeln und schon sind wir aller Probleme ledig. Natürlich ist das Bedürfnis nach einer heilen Welt groß, und es wird immer wieder nach Nischen gesucht, die die Möglichkeit bieten, in einer solchen heilen Welt zu leben. Aber betrachten wir die Sache einmal von einer anderen Seite.
Jeder Mensch erlebt sein Leben subjektiv, das heißt jeder Mensch hat seine eigene Wirklichkeit. Und zunächst sollte man sich vielleicht überlegen, wie diese Wirklichkeit aussieht. Wie empfindet man diese Wirklichkeit, und was ist die Wirklichkeit? Ich bestreite nicht, dass das eben geschilderte Vorurteil bei einigen Lesern zu Beginn ihrer Beschäftigung mit SF gegeben sein wird. Aber es stellt sich immer wieder heraus, dass die längere Beschäftigung mit SF im Allgemeinen und PERRY RHODAN im Besonderen dazu führt, dass der Leser ganz klar erkennt: Die Problematik, die er hier auf der Erde vorfindet, erlischt im Weltraum nicht einfach. Der Leser erkennt ganz klar, dass mit jeder Ausweitung der Zivilisation, wohin auch immer, die Problematik wächst.
Das muss nicht im negativen Sinn verstanden werden – dieses Anwachsen der Problematik. Es ist auch ein Anwachsen der Verantwortung. Mit dem Anwachsen des Instrumentariums wächst die moralische Verpflichtung des Menschen. Und wenn der Leser jetzt in einem SF-Roman sieht, wie groß dieses technische Instrumentarium ist, dann wird ihm wenigstens unterschwellig bewusst, welche Gefahren daraus erwachsen können – neben denen der Technik etwa die Gefahren der Parapsychologie, die, falsch angewendet, mindestens zu ebenso großen Katastrophen führen können wie die falsche Anwendung der Technik. Darüber hinaus aber auch die Gefahr, dass überkommene und gefährliche Gesellschaftsformen in den Weltraum verlagert werden.