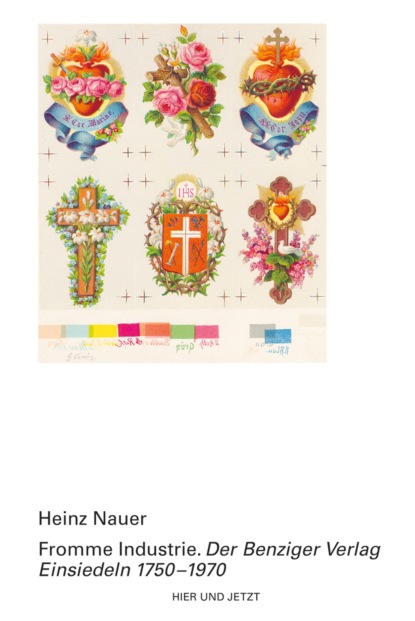- -
- 100%
- +
Es stellt sich hier die Frage, ob die Firma Benziger auch auf andere Branchen in der Region einwirkte und nachhaltige Innovationen auslöste. In den Quellen greifbar sind lediglich einige Hersteller mechanischer Werkzeuge sowie mit Maschinen ausgestattete Schreinereien, die sich rund um die Druckereibranche entwickelten und die Firma Benziger und die anderen Druckereien vor Ort belieferten. In einem grösseren Kontext lassen sich aber durchaus sogenannte Rückkoppelungseffekte auf die regionale Wirtschaft und Gesellschaft feststellen. Mitglieder der Verlegerfamilie waren als Initianten, Gönner, Financiers oder Inhaber öffentlicher Ämter an auffallend vielen wirtschaftlichen und sozialen Neuerungen in Einsiedeln massgeblich beteiligt. Ich sehe «Rückkoppelungseffekte» vor allem auf drei Ebenen: Erstens hat die Firma Benziger oder haben einzelne Mitglieder der Verlegerfamilie als «Privatleute» konkrete infrastrukturelle Projekte initiiert oder finanziell unterstützt (Gaswerk, Eisenbahn, Krankenhaus usw.). Eine zweite Ebene betrifft das Bildungswesen. Mehrere Familienmitglieder haben sich in verschiedenen Funktionen als Förderer einer guten Schulbildung betätigt. Die dritte Ebene ist eher psychologischer Natur. Die Firma Benziger hat den hohen Bekanntheitsgrad Einsiedelns als Wallfahrtsort massiv zu eigenen Werbezwecken eingesetzt und sich in die Geschichte und die Erscheinung des Orts eingeschrieben. Dieses «Labelling» hat der «Marke» Einsiedeln eine zusätzliche Sichtbarkeit verschafft und dürfte sich förderlich auf die Wallfahrt ausgewirkt haben.
Infrastrukturelle Investitionen
Anja Buschow und Werner Oechslin streichen die Bedeutung der Firma Benziger für die bauliche Entwicklung des Dorfs zwischen 1850 und 1914 heraus, als eine «Entwicklung vom Dorf zum sich städtisch gebenden Flecken» stattgefunden habe.189 Die Firmen Benziger und Eberle seien der «Motor des baulichen Aufschwungs» gewesen. Von der Bautätigkeit der Firma Benziger sei «die ganze Entwicklung der Architektur des Dorfs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts» ausgegangen.190 Doch reichte der Einfluss der Firma Benziger über die architektonische Entwicklung hinaus. So wurden die ersten Gasleitungen von Privathäusern Ende des 19. Jahrhunderts von der Firma Benziger errichtet und mit Gas aus dem eigenen Gaswerk gespiesen, das 1876 errichtet worden war.191 Das erste öffentliche Gaswerk errichtete der Bezirk erst in den Jahren 1909/10.192 Ab 1889 besass die Firma Benziger eine eigene Telefonanlage mit Anschlüssen in Einsiedeln, Euthal und Gross, die auch das Postbüro benutzte. Ein öffentliches Telefonbüro wurde in Einsiedeln erst 1895 eingerichtet.193
Auch bei einem 1893 in Einsiedeln errichteten und heute noch bestehenden Panorama («Kreuzigung Christi») stand die Firma Benziger am Ursprung. 1886 hatte ein Panoramagemälde der Kreuzigungsszene des Malers Bruno Piglhein in München für Aufsehen gesorgt. Die Firma Eckstein & Esenwein aus Backnang in Württemberg, die auf die Herstellung von Panoramen spezialisiert war, gelangte einige Jahre später an die Firma Benziger. Sie hoffte, in Einsiedeln eine Kopie des Panoramas von Piglhein zeigen zu können, und stiess beim Verlag auf offene Ohren. Benziger stellte das Bauland für das Panoramagebäude zur Verfügung, übernahm den Betrieb und die Verwaltung und sicherte sich vertraglich 15 Prozent der zu erwartenden Nettoeinnahmen. Im Sommer 1893 konnte das Panorama eröffnet werden und war ein grosser Erfolg. In den ersten Betriebsjahren wurden jeweils über 30 000 Besucher gezählt.194
Das wichtigste infrastrukturelle Projekt, an dem sich die Firma Benziger beteiligte, war aber die Eisenbahnlinie von Wädenswil am Zürichsee nach Einsiedeln. Zum zehnköpfigen Komitee, das die Bezirksversammlung 1870 wählte und das Projekt ausarbeiten sollte, gehörten auch Adelrich B.-Koch sowie Nikolaus B.-Benziger II. Nikolaus Benziger war zudem Verwaltungsrat der ein Jahr später gegründeten Aktiengesellschaft. Einsiedeln übernahm mit 250 000 Franken ein Drittel des Aktienkapitals, Wädenswil die übrigen zwei Drittel. Interessanterweise beteiligte sich auf der Einsiedler Seite das Kloster, das wohl auf günstige Auswirkungen des Eisenbahnanschlusses auf die Wallfahrt hoffte, mit 50 000 Franken am Aktienkapital, während der Bezirk lediglich 45 000 Franken beisteuerte.195 Beim Bau der Eisenbahnlinie traten schwerwiegende Probleme auf, sodass das Einsiedler Komitee 1875 gezwungen war, noch einmal 375 000 Franken einzuschiessen. Das Kloster beteiligte sich erneut mit 50 000 Franken, weiteres Kapital steuerten der Bezirk, der Kanton sowie Private bei. Eine schliesslich noch offene Finanzierungslücke von weiteren 50 000 Franken übernahm die Firma Benziger.196 Im April 1877 konnte die Wädenswil-Einsiedeln-Bahn eröffnet werden, zu einem Zeitpunkt notabene, als in Wädenswil noch kein Eisenbahnanschluss nach Zürich bestand und der Warentransport zwischen diesen Orten per Schiff auf dem Zürichsee erfolgte. Das Engagement der Firma Benziger beim Eisenbahnbau war nicht zufällig. Der Eisenbahnanschluss lag im eigenen Interesse. Einsiedeln ermangle «der nöthigen Lage an einer Eisenbahn», hatte die Verlagsleitung schon 1866 beklagt.197
Zu erwähnen sind zwei soziale Institutionen, die von der Familie Benziger gegründet wurden. Zum einen die Waisenanstalt Maria-End, die 1869 auf dem «Katzenstrick», einem Hügel wenige Kilometer ausserhalb des Dorfs, errichtet wurde. Gegründet wurde die Anstalt vom Einsiedler Konditor und späteren Regierungsrat Stephan Steinauer, der eine Tochter von Josef Karl B.-Meyer geheiratet hatte. Dem Verwaltungsrat der Stiftungsgesellschaft gehörten mit Martin B.-Dietschy und Nikolaus B.-Benziger II auch zwei Mitglieder der Familie Benziger an. Nach dem Tod des Gründers Steinauer-Benziger im Jahr 1878 setzte sich vor allem Nikolaus B.-Benziger II für die Weiterführung der Anstalt ein. 1884 musste die Waisenanstalt aus finanziellen Gründen geschlossen werden. Die Stiftungsgelder gingen später in die «Stiftungsgesellschaft zur Gründung eines Krankenhauses für den Bezirk Einsiedeln», eine weitere Gründung der Familie Benziger, über.198 Die Krankenhausstiftung wurde 1863 von Josef Karl B.-Meyer zum Andenken an seine zwei Jahre zuvor verstorbene Frau ins Leben gerufen. Zusammen mit seinen drei Söhnen stiftete er ein Anfangskapital von rund 15 000 Franken. Bis 1897 wuchs das Stiftungskapital durch weitere Schenkungen vor allem aus dem Umfeld der Familie Benziger auf über 300 000 Franken an. 1903, vierzig Jahre nach Stiftungsgründung, konnte das Spital Einsiedeln schliesslich eingeweiht werden.199
Die Familie Benziger als Förderer des Schulwesens
Als liberal denkende und handelnde Männer legten Josef Karl B.-Meyer und sein Bruder Nikolaus B.-Benziger I Wert auf eine Verbesserung der Volksschule.200 Josef Karl B.-Meyer veranlasste als Bezirksammann in den 1840er-Jahren den Bau von Schulhäusern in den Einsiedler Vierteln.201 Nikolaus B.-Benziger I setzte sich als Bezirksstatthalter und Mitglied der von seinem Bruder initiierten und 1834 gegründeten Schulkommission für die Volksschule ein und erteilte in den 1830er-Jahren vorübergehend selbst Unterricht in Zeichnen und Buchhaltung. Von 1848 bis 1849 wirkte er zudem als schwyzerischer Erziehungsrat.202 Sein Sohn gleichen Namens war von 1854 bis 1858 Schulratspräsident in Einsiedeln und später als Regierungsrat Vorsitzender des Erziehungsdepartements sowie Direktor des kantonalen Lehrerseminars und Präsident des Verwaltungsrats der schwyzerischen Lehreralterskasse.203
Die Schule war in den Jahrzehnten vor der Bundesstaatsgründung auch im Kanton Schwyz ein Feld der politischen Auseinandersetzung zwischen Liberalen und Konservativen. In Einsiedeln verlief die Konfliktlinie einmal mehr zwischen Kloster und Bezirksbehörde. Die Spannungen wurden in den 1840er-Jahren sichtbar, als ein neues Schulhaus gebaut werden sollte; zuvor waren die Kinder im Rathaus unterrichtet worden. Das Kloster sicherte dem Bezirksrat, der die Baukosten allein nicht aufbrachte, zu, ihm den Bauplatz kostenlos zu überlassen, sofern immer mindestens zwei Geistliche im Schulrat Einsitz hätten und das Pfarramt die Lehrmittel bestimmen könne. Für Verstimmung beim Kloster hatte zuvor bereits die Einführung des liberalen Geschichtswerks «Des Schweizerlands Geschichte für das Schweizervolk», erschienen 1822, von Heinrich Zschokke als Lehrmittel in der Realschule gesorgt.204 Josef Karl B.-Meyer, damals Bezirksammann, sprach sich 1843 gegen den Vorschlag des Klosters aus, da dieser gegen die Verfassung verstosse. Weiteren Unmut zog die Bezirksbehörde auf sich, als sie 1844 die Ordensfrauen aus der Kongregation der göttlichen Vorsehung als Leiterinnen der Mädchenschule entliess und durch weltliche Lehrerinnen ersetzte. Die Übernahme war von langer Hand geplant und höchstwahrscheinlich von den Gebrüdern Benziger eingefädelt worden. Bereits 1841 hatte Josef Karl B.-Meyer an Josephine Stadlin, die in Zürich ein Lehrerinnenseminar führte, geschrieben: Die «Schwestern dürfen hier kein Bleiben mehr haben; denn sie taugen nichts …».205
B.-Meyer und B.-Benziger I waren mit Josephine Stadlin freundschaftlich verbunden. Mehrere ihrer Töchter, für welche die Einsiedler Schule nicht genügen konnte, besuchten das stadlinsche Institut. Weitere Töchter wurden zur Ausbildung in andere Privatinstitute nach Solothurn oder in die Westschweiz gesandt. Den Primarschulunterricht für die Töchter erteilten Privatlehrer in Einsiedeln. Am Privatunterricht nahmen auch die Kinder anderer Familien der Einsiedler Elite teil, die dafür ein Schulgeld zu entrichten hatten.206
Die Familie Benziger unterstützte das Schulwesen auch durch grössere und kleinere finanzielle Zuwendungen. Das Vermächtnis von Nikolaus B.-Benziger I beispielsweise umfasste zahlreiche Legate. Neben Zuwendungen unter anderem an die Inländische Mission, die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft und den Bezirk Einsiedeln gehörte auch die Einrichtung von kleinen Bibliotheken von je rund hundert Bänden mit Jugendschriften in den Bezirksschulen in Einsiedeln sowie den sechs im Bezirk liegenden Vierteln dazu.207
Die Förderung des Schulwesens durch Josef Karl B.-Meyer und Nikolaus B.-Benziger, die auch die folgende Generation weiterführte, lässt sich zum einen als soziales Engagement aus liberaler Warte interpretieren. Man war sich letztlich aber auch bewusst, dass die Firma ihr Personal mehrheitlich in der Region rekrutierte und sich eine solide Volksschulbildung langfristig positiv auf das eigene Geschäft auswirken würde. Bezeichnenderweise galt ihnen mit dem Zeichenunterricht jenes Fach als besonders förderungswürdig, das im grafischen Gewerbe besonders wichtig war.208 In einem Bericht zur Schweizer Landessausstellung 1883 schrieb Adelrich B.-Koch: «Wie in fast allen Gewerben das Zeichnen eine wichtige Rolle spielt, so ganz besonders in den Zweigen, mit denen wir es zu thun haben. Ein Arbeiter, der nicht etwas zeichnen kann, ist in den meisten grafischen Fächern schlecht verwendbar; dagegen ist er in dem Verhältnis werthvoller, in welchem er im Zeichnen tüchtig ist. Diese Bemerkung gilt selbst für jeden einfachen Drucker.»209 Zeitweise bestanden gar Pläne, in Einsiedeln eine Zeichnungs- und Kunstgewerbeschule einzurichten.210
Verlagswerbung – Einsiedeln als «Label»
Die Firma Benziger investierte viel in die Bewerbung der eigenen Verlagsprodukte. Um das 1866 gegründete Unterhaltungsblatt «Alte und Neue Welt» bekannt zu machen, druckte sie nicht weniger als 250 000 Prospekte, die zusammen mit «tausende[n] von Noten, Circularen, köstliche[n] Inseraten in die Welt» geschickt wurden.211 In der «Alten und Neuen Welt» sowie im auflagenstarken «Einsiedler Kalender» wurden regelmässig und umfangreich übrige Verlagsprodukte beworben. Im Januar 1866 schrieb Adelrich B.-Koch in die USA, man müsse unbedingt die eigenen «Zeitungen besser benützen zu öfteren Anzeigen uns. Bücher» und diese «stark, gross u. oft» bewerben.212
Fast immer dazu gehörte eine Abbildung des Klosters Einsiedeln. Einsiedeln und das Kloster waren zwei Begriffe, die zusammengehörten. Die emblematische Darstellung der Klosterfassade, die für viele Katholiken einen hohen Wiedererkennungswert besass, und der Name Einsiedeln, der in den Köpfen der Menschen Bilder von Wallfahrt und Frömmigkeit evoziert haben dürfte, wurden von der Firma Benziger als «Label» verwendet.
Die Firma Benziger war bestrebt, sich in die Geschichte und das Erscheinungsbild Einsiedelns einzuschreiben. Zeitgenössische Werbevignetten beispielsweise inszenierten nicht selten eine Art Beziehungsdreieck zwischen Einsiedeln, dem Kloster und dem Namen Benziger.213 Für einige Zeit evozierte der Name Einsiedeln genauso den Namen Benziger, wie er Bilder des Klosters hervorrief. 1888 erschien in der «New York Times» die Beschreibung einer Reise, die der amerikanische Minister John F. Lang im selben Jahr durch Bayern und die Schweiz gemacht hatte. Von München führte die Reise via Lindau und den Bodensee bis nach Romanshorn, von wo er mit der Eisenbahn nach Zürich fuhr. «At Zurich we waited to change cars without any visit about the city», schrieb Lang. Er bevorzugte es, anstatt die Zwinglistadt zu besichtigen, noch am selben Tag nach Einsiedeln zu reisen, wo er abends um neun Uhr eintraf. Von Einsiedeln schienen ihm in seinem kurzen Bericht drei Dinge erwähnenswert, erstens – und noch vor dem Kloster – die Firma Benziger und ihr «immense business», das Lang wahrscheinlich von den amerikanischen Filialen her bereits vor seiner Reise bekannt gewesen war, zweitens das Kloster und die Mönche, die er als eine «handsome class of gentlemen» beschrieb, und drittens die Wallfahrt und insbesondere die zahlreichen Pilgerhotels, die so gut ausgerüstet seien «as many in large cities».214
Über Inserate und Verlagsprodukte machte die Firma Benziger den Namen Einsiedeln und die Einsiedler Wallfahrt auch bei Menschen bekannt, die noch nie eine Wallfahrt dahin unternommen hatten, und trug Bilder der Einsiedler Klosterfassade in Gegenden, die ausserhalb der traditionellen Einzugsgebiete der Wallfahrt lagen. Die Firma Benziger dürfte so gesehen einerseits vom «Label» Einsiedeln profitiert haben, dieses «Label» aber noch weiterverbreitet und so ihrerseits die Wallfahrt gefördert haben.
Zwei Schlussbemerkungen
Die Familie Benziger als kapitalstarke Elite hat die Modernisierung Einsiedelns als Geschäftsbesitzerin, politischer Entscheidungsträgerin und private Gönnerin in vielfältiger Weise gefördert. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es kaum ein grösseres Projekt, an dem die Familie Benziger nicht beteiligt war. Mit zwei Bemerkungen möchte ich dieses Kapitel abschliessen. Erstens gilt es festzuhalten, dass sich die verschiedenen Funktionen, in denen Familienmitglieder als Akteure auftraten, nicht scharf voneinander trennen lassen. Sie waren nicht tagsüber Unternehmer, abends Privatleute und zwischendurch Politiker. Sie förderten als Bezirks-, Kantons- und Regierungsräte und als Schulpräsidenten die Volksschule und waren als Arbeitgeber auf solid geschulte Arbeitskräfte angewiesen, sie unterstützten die Einrichtung einer Waisenanstalt für Knaben und zogen diese zum Kolorieren von Andachtsbildern in ihrer Firma heran, sie ermöglichten die Errichtung eines Panoramas, förderten so die Attraktivität Einsiedelns für Pilger und Touristen, die gleichzeitig die Konsumenten ihrer Verlagserzeugnisse waren. Martin B.-Dietschy besuchte 1862 die Weltausstellung in London. Da er nicht nur Leiter der technischen Abteilung des Verlagsgeschäfts, sondern auch Feuerwehrkommandant war, interessierten ihn nicht nur Neuerungen im Druckerwesen, sondern auch eine neuartige, auf beweglichen Rädern angebrachte Feuerspritze, die er dort ausgestellt sah. Im März 1863 erkundigte er sich in Cincinnati, wo die Feuerspritzen offenbar hergestellt wurden, im eigenen Filialgeschäft nach Musterzeichnungen und Katalogen derselben und wollte eine für die Ortsfeuerwehr anschaffen lassen.215
Die zweite Bemerkung betrifft die geografische Ausdehnung der beschriebenen Rückkoppelungseffekte. Die Familie Benziger pflegte einerseits weit verzweigte Kontakte. Nikolaus B.-Benziger II beispielsweise, der von 1883 bis 1905 im Nationalrat und ab 1905 bis zu seinem Tod 1908 im Ständerat und daneben Mitglied in zahlreichen regionalen und nationalen katholischen Vereinen und Vereinigungen war, betätigte sich in fortgeschrittenem Alter als Mäzen mit weit verzweigtem Korrespondentennetz. Zuwendungen erhielten neben nah und weniger nah verwandten Personen etwa der Abt des Klosters in Disentis, das Seraphische Liebeswerk, zahlreiche Geistliche im In- und Ausland, die Direktionen des Vereins der Glaubensverbreitung und des Vereins der heiligen Kindheit, die Oberin der Menzinger Schwestern, das Töchterinstitut Heilig Kreuz in Cham oder der Schweizer Piusverein.216 Andererseits tätigte man ausserhalb Einsiedelns kaum jemals grössere Investitionen. Immer wieder bestanden zwar Pläne dazu, etwa 1877, als man daran dachte, eine Papierfabrik im Kanton Nidwalden zu kaufen217, oder 1882, als Adelrich B.-Koch die Pension Jütz, ein altes Kurgasthaus, in Seewen SZ kaufte und an dieser Stelle ein vom Orden der «Englischen Fräulein»218 geleitetes Töchterinstitut errichten lassen wollte.219 Pläne, die grössere Investitionen ausserhalb der Region Einsiedeln vorsahen, wurden letztlich aber nie realisiert. Das direkte Umfeld in und um Einsiedeln blieb im 19. Jahrhundert stets der wichtigste Bezugsraum.
Expansion: Von Einsiedeln nach New York
Regionale Netzwerke, Verwandtschaftsbeziehungen und die kommunale Politik waren ein wichtiger in die Firmengeschichte «integrierter Anker».220 Dem stand andererseits die dezidiert internationale Ausrichtung des Unternehmens gegenüber. Internationale Handelsbeziehungen, vor allem in den süddeutschen Raum – mit Städten wie Stuttgart, Augsburg, Nürnberg – und ins Elsass, waren bereits im ausgehenden 18. Jahrhundert ein fester Teil des Geschäfts. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vergrösserte sich der Absatzmarkt punkto Intensität und Ausdehnung. In der zweiten Jahrhunderthälfte beschleunigte sich die Expansion. Dies lässt sich nicht zuletzt an diversen Niederlassungen ablesen, welche die Firma Benziger ab den 1850er-Jahren in den USA (New York, 1853; Cincinnati, 1860; St. Louis, 1875; Chicago, 1887), in Deutschland (Waldshut, 1887; Köln, 1894), in Frankreich (Paris, 1899; Strassburg, 1912) sowie vorübergehend in Mexiko (Mexiko-Stadt, 1912) errichtete. In Lyon und London unterhielt die Firma zeitweise eigene Kommissionäre. Über London bediente der Verlag im ausgehenden 19. Jahrhundert auch die «asiatischen, afrikanischen und amerikanischen Missionen».221 Auf dem Höhepunkt ihrer internationalen Geschäftstätigkeit war die Firma Benziger ein global tätiger katholischer Medienkonzern. Diese bemerkenswerte Expansion und die zahlreichen Herausforderungen für das Unternehmen gilt es in diesem Kapitel zu beschreiben und zu reflektieren. Im Folgenden wird immer wieder von «Raum» und «Markt» die Rede sein. Um besser zu verstehen, was diese Konzepte in ihren jeweiligen Kontexten bedeuten und wie sie hier verwendet werden, sind zwei kurze Vorbemerkungen nötig.
Die erste Vorbemerkung betrifft verschiedene zur Anwendung gelangende Raumkonzeptionen. Die historische Forschung hat sich in den letzten ungefähr zwanzig Jahren vermehrt darum bemüht, den geografischen Raum als kulturelle Grösse wieder stärker wahrzunehmen und ihn der Zeit als zusätzliche Dimension zur Seite zu stellen. Relevant in der Debatte des «spatial turn» scheint mir die grundlegende Unterscheidung zwischen geografischen Räumen, die physisch durchschritten werden können, und sozialen Räumen, die durch menschliche Interaktionen und Vorstellungen konstruiert werden.222 In unserem Fall müssen wir also einerseits fragen, was es für ein Unternehmen konkret bedeutet, wenn es immer neue Absatzmärkte erschliesst und so eine immer grössere Distanz zwischen ihm und den Käufern seiner Ware entsteht. Andererseits sollten wir auch überlegen, wie und entlang welchen sozialen Netzwerken sich die Expansion des Unternehmens vollzieht. Wir haben im vorangehenden Kapitel bereits festgestellt, dass sich im selben geografischen Raum verschiedene Raumkonzeptionen überschneiden und überlagern können. Einsiedeln war im 19. Jahrhundert eine geografisch, politisch und wirtschaftlich periphere Region, auf der mentalen Landkarte vieler Katholiken allerdings eindeutig ein Zentrum. In Bezug auf die Expansion des Unternehmens scheint es also sinnvoll, auch solche mentalen Raumkonzeptionen im Blick zu behalten.
Die zweite Vorbemerkung schliesst direkt an diese erste an. Neuere Unternehmensgeschichten haben verschiedentlich betont, dass auch Märkte als soziale Räume verstanden werden können. Sie gehen häufig von handlungstheoretischen Ansätzen aus, die besagen, dass Märkte nicht automatisch durch Angebot und Nachfrage entstehen, wie dies die neoklassische ökonomische Theorie nahelegt, sondern, dass es ökonomische Akteure braucht, welche die Märkte schaffen: indem sie produzierende Unternehmen und Verkäufer auf der einen und räumlich getrennte Käufer auf der anderen Seite miteinander in Beziehung bringen. Märkte sind so gesehen nichts anderes als das Resultat einer Ansammlung zahlreicher, von Personen durchgeführten und sich über die Zeit verdichtenden ökonomischen Tauschakten, oder anders ausgedrückt: soziale Räume, in denen Käufer und Verkäufer miteinander in Beziehung treten.223 In diesem Kapitel sollen deshalb die Akteure, die mit Tausenden von Briefen, unzähligen Geschäftsreisen und persönlichen Treffen an neuen Absatzmärkten woben und die Expansion des Unternehmens vorantrieben, besonders im Fokus stehen.
Internationalisierung des Geschäfts
Wir haben bereits einige Indikatoren wie Verlagsgebäude, technische Innovationen, Zahl der Angestellten angesprochen, die das Wachstum der Firma Benziger ab 1850 verdeutlichen. Im Folgenden soll zunächst die Expansion des Geschäfts anhand weiterer Indikatoren dargestellt werden, die stärker auf die Internationalisierung der Unternehmenstätigkeit abzielen.
In wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive lassen sich vier verschiedene Wachstumsstrategien von Unternehmen unterscheiden: horizontale Integration, indem andere Unternehmen aufgekauft werden; vertikale Integration, indem einzelne Produktionsstufen ins eigene Unternehmen integriert werden; Diversifizierung, indem die Bandbreite der eigenen Produkte erweitert wird; und geografische Erschliessung neuer Absatzmärkte.224 In der Geschichte der Firma Benziger treffen wir, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, alle vier Strategien an. Die Verlegerfamilie kaufte in einer frühen Phase verschiedene kleinere Konkurrenzfirmen in Einsiedeln auf. Sie integrierte eine fabrikmässige Buchbinderei, ab den 1830er-Jahren eine Druckerei und später zahlreiche weitere technische Betriebe in ihr Unternehmen, weil es für den Verlag zunehmend günstiger und praktikabler war, seine Bücher und Bilder selbst zu drucken und zu binden, als die Aufträge an externe Personen und Firmen zu vergeben. Zudem schuf sich der Verlag mit dem Bilder- und dem Zeitschriftenverlag sowie dem Paramenten- und Kirchenornamentenhandel weitere Standbeine neben dem Gebetbuchverlag. Am besten lässt sich die Expansion der Firma Benziger aber an der geografischen Erweiterung der unternehmerischen Tätigkeiten ablesen.
Topografie der Verlagstätigkeit
Einen Einblick in die Topografie der Geschäftstätigkeit ermöglichen die zahlreich überlieferten Korrespondenzbücher des Verlags. Exemplarisch soll im Folgenden die Korrespondenz anhand eines dieser Bücher ausgewertet werden. Es handelt sich um den Band «Allgemeine Correspondenz», der Abschriften von insgesamt 1154 Briefen enthält, die zwischen November 1876 und April 1877 verfasst wurden (Karte 1, S. 367).225
Die internationale Ausrichtung der Firma wird schnell sichtbar. Zwar korrespondierte sie im genannten Zeitraum auch regelmässig mit Personen im lokalen Umfeld sowie in Zürich und – etwas weniger intensiv – an anderen Orten der Deutschschweiz wie Basel und St.Gallen, der Schweizer Binnenraum als Ganzes spielte für die Firma aber eine untergeordnete Rolle. Weniger als ein Viertel aller Briefe im gewählten Zeitraum gelangte an Adressaten in der Deutschschweiz (275), eine vernachlässigbar kleine Zahl von Briefen ging in die französisch- und italienischsprachigen Schweiz (11).226