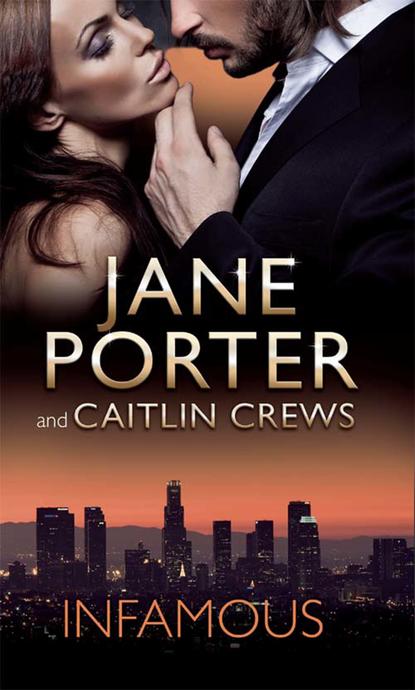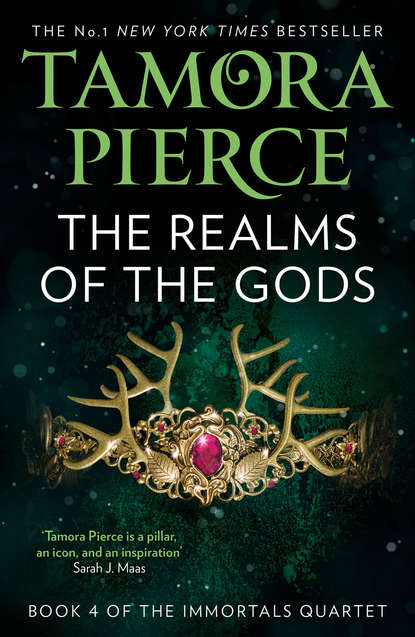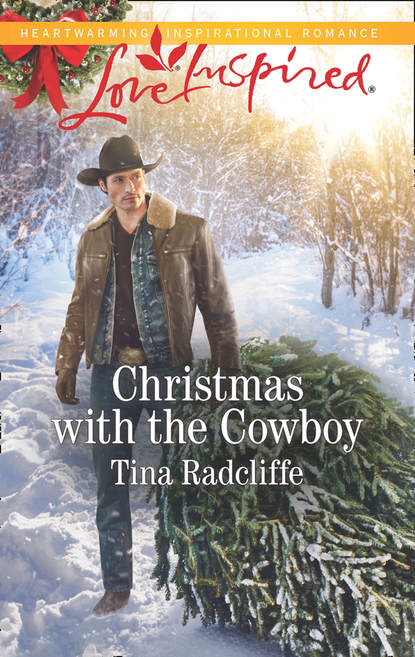- -
- 100%
- +
Während Gerlinde am Mainufer entlang in Richtung Frankfurt hastete, spürte sie die ganze Zeit einen Kloß im Hals. Am liebsten hätte sie sich in ein stilles, schattiges Eckchen am malerischen Mainufer zurückgezogen und sich ihrer Traurigkeit hingegeben. Nicht nur der Abschied von den Söhnen schmerzte sie in der Seele, sondern auch der Anblick der zahlreichen glücklichen Paare, die, einander untergehakt und mit ihren fröhlichen Kindern an den Händen, bei dem schönen Wetter einen Sommerspaziergang machten. Nur sie war auf sich gestellt und musste sich, anstatt bei ihren geliebten Buben bleiben zu dürfen, nun wieder mit einem wildfremden Mannsbild einlassen, vor dem es sie schon jetzt grauste. Aber sie brauchte das Geld, also musste sie sich zusammennehmen und durfte sich ihre Schwermut auf keinen Fall anmerken lassen. Sie schluckte ihre Tränen herunter und dachte wie so oft über ihren Plan nach, den sie vor einigen Monaten gefasst hatte: Sie würde sich weiterhin so gut es ging Geld zurücklegen, um sich in zwei, drei Jahren vielleicht eine Existenz als Putzmacherin aufzubauen. Sie wollte klein anfangen, in der Schneiderwerkstatt ihrer Tante, die ihr Stoffe und Dekorationen zuliefern könnte, und vielleicht würde sie es eines Tages sogar zu einem gut gehenden Laden mit Angestellten bringen, der sie alle ernährte, sodass sie nicht länger Dienstmagd sein müsste und ihren verhassten Nebenerwerb endlich loswürde. Und vor allem könnte sie dann wieder mit ihren Buben zusammenwohnen. Wäre das schön!
In solche Tagträume versunken, überquerte Gerlinde die Mainbrücke und ging durch die lange Fahrgasse, bis sie auf die Zeil stieß. Sie bog rechts in die Stelzengasse ab, lief an der nächsten Straßenecke links und erreichte rechter Hand endlich das Klapperfeld mit seinen vielen Gartenlokalen, die an dem herrlichen Wochenende voll gutgelaunter Gäste waren. Auch der Weingarten des Herrn Adam war gut besucht. Der Wein war eher mäßig, dafür aber billig, und an den Wochenenden wurde zum Tanz aufgespielt. Die einfachen Leute aus der Nachbarschaft nutzten den Garten als Stammlokal, und auch viele Dienstmädchen und Handwerksburschen verkehrten hier an ihren arbeitsfreien Tagen. Gerlinde hatte kürzlich mit einer jungen Frau namens Irmgard ein Glas Wein hier getrunken. Wie es der Zufall wollte, saß Irmgard mit einer Gruppe anderer Dienstmägde an einem Tisch und winkte Gerlinde zu. Die Frauen begrüßten sich, und Gerlinde wurde von Irmgard eingeladen, sich zu ihnen zu gesellen, was sie mit der Erklärung, sie habe gleich eine Verabredung, bedauernd ablehnte. Die Absage wurde von Gerlindes Bekanntschaft ohne großes Aufhebens akzeptiert. Irmgard war ebenfalls Gelegenheitsprostituierte und über Gerlindes Nebenerwerb im Bilde. Die beiden hatten sich an Nellys Blumenstand kennengelernt und bald darauf hier wiedergetroffen.
Gerlinde fand am Rande des Weingartens noch einen freien Tisch, an dem sie Platz nahm. Sie bestellte ein Glas säuerlichen Frankfurter Wein und hörte, dass es vom benachbarten Uhrtürmchen an der Friedberger Anlage vier Uhr schlug. Angespannt blickte sie sich um. Der kleine Tanzboden war voller Paare. Junge Gesindemägde und Wäscherinnen in geblümten Sommerkleidern tanzten mit Schneidergesellen oder Friseurgehilfen. Überall sah man verliebte Pärchen beim Turteln. Zuweilen zogen sich die Liebesleute in den verwinkelten Garten zurück, um sich im Schutz des Dickichts dem Liebesspiel hinzugeben. Viele der jungen Leute kannten sich untereinander und waren befreundet, das knappe Zehrgeld wurde zusammengelegt, und man machte sich einen vergnügten Nachmittag. Nicht wenige der Gäste waren bereits in angetrunkener Stimmung. Einzelne Frauen waren auffällig herausgeputzt. Sie trugen modische Kleider und ausgefallene Hüte wie Damen der besseren Gesellschaft. Gerlinde vermutete, dass es sich bei ihnen entweder um Mägde handelte, die wie sie der Gelegenheitsprostitution nachgingen, oder um die heimlichen Geliebten wohlhabender Herren, denn vornehme Damen, da war sie sich sicher, würden sich hier nicht aufhalten. Bessergestellte Herren hingegen schon. Auch heute sah sie wieder einige gutbetuchte Herren, die es nach einem amourösen Abenteuer mit einem einfachen Mädchen gelüstete, nicht zuletzt, weil sie dieses Vergnügen nicht viel kostete. Gerlinde erkannte an einem der Tische einen korpulenten älteren Herrn, vor dem Irmgard sie das letzte Mal gewarnt hatte. Es handele sich bei ihm um einen gewissen Herrn von Uhland und er sei sehr reich. Regelmäßig verbringe er die Wochenenden hier und halte Ausschau nach hübschen jungen Dingern. Gerlinde solle bloß die Finger von ihm lassen und ihm einen Korb geben, falls er ihr einen Antrag machen würde. Der alte Knabe sei nämlich die Knickrigkeit in Person. Sie habe einmal den Fehler gemacht und war auf ihn hereingefallen. Er habe nur den billigsten Wein bestellt und um jeden Kreuzer mit ihr gefeilscht. Im Weingarten habe er deswegen auch längst seinen Ruf weg. Hier hieße er bei allen nur noch der ›Batzemann‹3, weil er, obgleich sehr wohlhabend, niemals mehr als sechs Kreuzer für ein Schäferstündchen auszugeben bereit war. Was an sich schon eine Zumutung, bei einem so unansehnlichen alten Zausel aber ohnehin die reinste Heimsuchung sei. Gerlinde erinnerte sich, wie sie mit Irmgard darüber gescherzt hatte, und musste auch jetzt schmunzeln, als sie den alten Geizhals sah. Ein Fehler, wie sich herausstellte, denn der ›Batzemann‹ erhob sich von seinem Platz und steuerte zielstrebig auf Gerlinde zu. Auch das noch!, dachte sie verärgert, als in nächster Minute ein ganz anderer Herr vor ihrem Tisch stand und sie mit gedämpfter Stimme ansprach: »Verzeihung, die Dame! Habe ich das Vergnügen mit Fräulein Gerlinde?«
»Ja, das bin ich«, erwiderte Gerlinde erschrocken und fühlte, wie sie rot wurde. Sie hatte den Mann überhaupt nicht kommen sehen. Wie ein Geist war er plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und füllte nun ihr Blickfeld mit seiner großen, hageren Gestalt aus. Er verbeugte sich und erkundigte sich höflich, ob er Platz nehmen dürfe. Während er sich gegenüber von Gerlinde niederließ, brachte der Kellner den Wein. Der Mann nestelte sofort nach seiner Brieftasche und beglich die Rechnung. Gerlinde beobachtete ihn verstohlen. Er schien noch jung zu sein, vielleicht in ihrem Alter, was jedoch schwer zu bestimmen war, denn er hatte einen dichten Backenbart, und seine Augen waren von einer dunkel getönten Brille verdeckt. Er war sehr elegant gekleidet und trug einen sandfarbenen leinenen Gehrock. Der lange, schmale Hals war bis zum Kinn von einem Vatermörderkragen umschlossen und mit einer kunstvoll geknoteten Krawatte verschnürt, die auf seine geblümte Seidenweste farblich abgestimmt war. Trotz der Hitze hatte er Handschuhe an und trug den Zylinder aus beigefarbenem Filz tief in die Stirn gezogen.
Ein feiner Pinkel, genau, wie Nelly gesagt hat, ging es Gerlinde durch den Sinn. Für eine Weile herrschte betretenes Schweigen und Gerlinde nippte verlegen an ihrem Wein. Dann räusperte sich der Mann, zückte eine goldene Taschenuhr und warf einen kurzen Blick darauf.
»Meine Liebe, was halten Sie davon, wenn wir in Bälde aufbrechen? Heute ist fürwahr ein herrlicher Tag, und wir könnten doch eine kleine Ausflugsfahrt unternehmen. Vielleicht über Bornheim bis zum Lorberg hin und dort den schönen Ausblick genießen. Und auf der Rückfahrt könnten wir noch irgendwo nachtmahlen. Sie haben doch hoffentlich genügend Zeit mitgebracht?«
»Um halb sieben muss ich wieder in Frankfurt sein, mein Herr!«
»Das sollte uns genügen. Nun denn, erheben Sie sich!«, drängte er zum Aufbruch. Gerlinde ließ ihr halbvolles Weinglas stehen und folgte dem Herrn nach draußen.
Der hat es aber eilig! Man hätte sich ja erst mal ein bisschen in Stimmung trinken können. Ein komischer Heiliger ist das. So rappeldürr und eine Stimme wie eine Frau. Die reinsten Steckenbeine hat der!
Gerlinde betrachtete die langen, dünnen Beine ihres Begleiters in den enggeschnittenen, hellgrauen Bügelhosen, die unter den Schuhen befestigt waren. Beim Hinausgehen tauschte sie noch einen vielsagenden Blick mit Irmgard, die ihr aufmunternd zunickte. Schweigend gingen sie zum nahe gelegenen Friedberger Tor, wo vor den Eingängen der Promenaden mehrere Kutschen und Droschken bereitstanden.
»Meine Liebe, wären Sie vielleicht so freundlich, schon eine Kutsche für unsere Zwecke anzumieten? Sagen Sie dem Kutscher, dass er uns zum Lorberg fahren möge und dass wir unterwegs nicht gestört zu werden wünschen. Sie wissen, was ich meine. Bezahlen Sie am besten im Voraus. Hier, das dürfte wohl genügen.« Der Mann gab Gerlinde einige Münzen und erklärte, er halte sich so lange im Hintergrund, und wenn sie alles erledigt habe, solle sie ihm einen Wink geben, er würde dann zusteigen. Als Gerlinde sich den Kutschen näherte, wurde sie von einem der Kutscher, der auf einem Kutschbock saß, mit anzüglichem Grinsen gefragt, ob sie denn wieder eine ›Porzellankutsche‹ benötige. Gerlinde kannte den Mann. Schon mehrfach hatte sie seine Kutsche für ein Rendezvous genutzt, ein in galanten Kreisen weitverbreiteter Brauch. Häufig standen Droschkenkutscher mit Kupplern und Prostituierten in Geschäftsverbindung. Gegen ein entsprechendes Trinkgeld stellten sie bereitwillig ihre Kutsche für ein Stelldichein von Hure und Freier zur Verfügung. Die Wagen waren eigens für solche Zwecke mit blickdichten Gardinen versehen, die man zuziehen konnte, und die Sitze waren besonders weich gepolstert. Auf Wunsch fuhren die Kutscher so langsam und sachte, als hätten sie zerbrechliches Porzellan geladen, weswegen eine solche Fahrt im Volksmund auch als ›Porzellanfuhre‹ bezeichnet wurde. Gerlinde trat an den Kutscher heran, bezahlte ihn und erteilte Anweisung, wohin es gehen sollte. Dann gab sie dem im Schatten eines Baumes wartenden Herrn ein Zeichen, dieser eilte herbei, und beide stiegen ein.
Gleich darauf setzte sich die Droschke in Bewegung, und der vornehme Herr zog sofort die Gardinen vor die Fenster. Im gedämpften Tageslicht saßen sich Gerlinde und ihr Freier im Kutscheninnern gegenüber. Die Stimmung war angespannt. Da zog der Mann ein kleines Päckchen aus seinem Gehrock und reichte es Gerlinde mit den Worten: »Ein kleines Präsent für Sie. Ich hoffe, Sie mögen Pralinen?«
»Vielen Dank, der Herr! Sehr freundlich. Ja, ich nasche für mein Leben gern«, bedankte sie sich artig und bewunderte die kleine Bonbonniere, die in Seidenpapier mit der Aufschrift der feinen Konditorei Krantz eingeschlagen war. Gerlinde freute sich tatsächlich über das nette Mitbringsel. Eine solche Freundlichkeit seitens eines Freiers hatte sie bisher noch nicht erlebt. Deshalb mochte sie ihm nun auch ein wenig entgegenkommen und setzte sich neben ihn. Sie schmiegte sich an ihn und erkundigte sich flüsternd nach seinen Wünschen. Der Mann zuckte zusammen und rückte zur Seite, als wäre ihm die Berührung unangenehm.
»Begebe sie sich doch bitte wieder auf Ihren Platz!«, maßregelte er Gerlinde in kaltem Tonfall, sie in der dritten Person ansprechend, wie man es Domestiken gegenüber für angemessen erachtete und fuhr, ein wenig milder werdend, fort: »Nichts für ungut, aber wir haben ja schließlich noch Zeit genug, und mit Verlaub, ich habe es auch nicht so eilig. Vielleicht können wir uns ja ein wenig unterhalten und, meine Liebe, Sie können doch einstweilen schon einmal von dem Konfekt kosten«, forderte er Gerlinde auf und lächelte sie zum ersten Mal an. Gerlinde erwiderte sein Lächeln und nickte zustimmend.
Was für ein Stockfisch! Dem muss man Zeit lassen. Das wird ein schweres Stück Arbeit werden!
Sie gelangte immer mehr zu der Überzeugung, dass es sich bei ihrem Begleiter um einen sehr schüchternen jungen Mann handeln müsse, der wahrscheinlich noch nie intimen Kontakt zu einer Frau hatte. Andererseits kam er ihr aber auch recht sonderbar vor, und es wurde ihr ganz mulmig in seiner Gegenwart. Mit dem lapidaren Gedanken, dass sie halt an ein verstocktes Söhnlein aus gutem Hause geraten war, rief sie sich wieder zur Räson und öffnete ihr Geschenk. Drei herzförmige Pralinen der Geschmacksrichtungen Nugat, Vollmilch und Zartbitter waren in der mit Spitzenpapier ausgelegten Schachtel angeordnet wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Auf einem rosafarbenen Deckblatt aus Seidenpapier befand sich in schwungvollen, goldenen Buchstaben die Aufschrift: ›Viel Glück!‹
Gerlinde war gerührt. »Das kann ich brauchen. Wie schön! Fast zu schade zum Aufessen«, bemerkte sie lächelnd und hielt ihrem Begleiter, bevor sie zugriff, die geöffnete Bonbonniere hin. Der junge Mann lehnte höflich ab. Er mache sich nicht viel aus Süßigkeiten. Gerlinde hatte sich für die helle Nugatpraline entschieden. Während sie die Süßigkeit genüsslich auf der Zunge zergehen ließ, musste sie plötzlich an ihre Buben denken. Sie wird die restlichen Pralinen für die beiden aufheben und sie ihnen das nächste Mal mitbringen. Aber so gut schmeckt die Praline gar nicht, sie schmeckt irgendwie bitter, dachte sie dann bei sich.
Gerlinde spürte auf einmal ein unangenehmes Brennen und Kribbeln am ganzen Körper, und es wurde ihr so kalt, dass sie zu schlottern anfing. Mit klappernden Zähnen wollte sie ihren Begleiter um Hilfe bitten, doch sie brachte keinen Ton hervor. Sie kriegte kaum noch Luft und hatte das Gefühl zu ersticken. In wilder Panik wollte sie die Kutschentür öffnen, doch sie konnte sich nicht mehr rühren.
Gerlindes Todeskampf dauerte zehn Minuten. Bei vollem Bewusstsein durchlebte sie die schlimmsten Todesqualen. Sah mit schreckgeweiteten Augen, die ihre Pein nur allzu deutlich widerspiegelten, wie ihr Begleiter sie die ganze Zeit mit regem Interesse beobachtete, dass er einen Schreibblock gezückt hatte, auf dem er sich eifrig Notizen machte.
Das Letzte, was sie vor ihrem Tod wahrnahm, war die grausame Kälte, die von ihm ausging, und viel zu spät erkannte sie, dass es kein Mensch war, der mit ihr in der Kutsche saß, sondern eine Bestie. Eine Bestie ohne jegliches Mitgefühl.
3 ›Batzen‹ = umgangssprachlich für Münzen von geringem Wert.
2
Das Dienstmädchen, Gerlinde Dietz, wurde von dem Droschkenkutscher Heinrich Schuch am Samstagabend gegen halb sechs tot in der Kutsche aufgefunden. Der aufgeregte Mann entschied sich, die Polizei zu verständigen, und fuhr mit der Ermordeten in der Kutsche vom Lorberg zurück nach Frankfurt. Der Beamte, der an diesem Sommerabend in der Amtsstube der Hauptwache Dienst tat, reagierte unwillig auf Schuchs Anliegen: »Für Mord und Totschlag bin ich net zuständig«, erklärte er dem Droschkenkutscher bärbeißig.
»Und wer ist dafür zuständig?«, erkundigte sich Schuch.
»Der Herr Oberinspektor Brand, der ist aber momentan net da.«
»Und wo ist der Herr Oberinspektor? Hätten Sie vielleicht die Güte, ihn herzuholen? Ich hab nämlich da draußen eine Leiche in der Kutsche, und keine Lust, die noch ewig spazieren zu fahren!«, entgegnete der Droschkenkutscher aufgebracht.
»Der ist beim Nachtmahlen drüben im ›Gesegneten Häuschen‹ am Römer. Ei, ich kann aber jetzt net fort, den holen gehen. Die Wache muss ja besetzt bleiben. Da müssen Sie halt warten, bis der wiederkommt. Des kann aber noch ein bisschen dauern, denn der ist grad erst vor einer Viertelstunde fortgegangen.«
»Also, das geht doch werklich net! Was seid ihr dann für Schlafmütze hier! Da werd ich mich beim Bürgermeister beschweren. Ich hab meine Zeit ja auch net gestohlen.«
»Ei, jetzt halte Sie aber mal die Füße still! Ich geh mal gucken, ob ich draußen einer von de Graumänner4 rummachen seh.«
Nachdem dieser Vorstoß tatsächlich von Erfolg gekrönt und ein Mann der freiwilligen Bürgerwehr unterwegs war, um den Inspektor zu benachrichtigen, dauerte es noch eine gute halbe Stunde, bis dieser endlich in der Hauptwache eintraf.
Oberinspektor Klaus Brand wirkte weniger wie eine Amtsperson, sondern eher wie ein in die Jahre gekommener Lebemann. Seine Kleidung war von nachlässiger Eleganz, und Schuch fiel auf, dass er nach Wein roch. Offenkundig verärgert darüber, bei seiner Vesper gestört worden zu sein, war sein Ton gegenüber Schuch gereizt. Er forderte ihn auf, zunächst einmal zu beschreiben, wie sich alles zugetragen hatte, und stopfte sich in aller Ruhe eine Tabakspfeife.
Der Droschkenkutscher berichtete, dass die junge Frau um kurz vor halb fünf bei ihm eine Kutsche angemietet und im Voraus bezahlt habe. Als Fahrtziel habe sie den Lorberg oberhalb des Dörfchens Bornheim angegeben. Kurz vor der Abfahrt sei dann noch ein Mann zugestiegen.
»Können Sie den beschreiben?«, erkundigte sich Brand.
»Dazu kann ich nicht viel sagen. Ich hab doch vorne auf dem Kutschbock gesessen und der kam von hinten. Ich hab von oben eigentlich nur gesehen, dass er einen hellen Zylinderhut aufhatte, und dann ist er auch schon in der Kutsche verschwunden.«
»Das ist ja mehr als dürftig«, erwiderte der Inspektor vorwurfsvoll.
Schuch zuckte mit den Achseln und brummelte, dass er es nicht ändern könne. Der Inspektor befahl ihm, weiter zu berichten.
»Dann war weiter nix mehr, und als wir auf dem Lorberg angekommen sind, hab ich von oben an die Kutsche geklopft und laut gerufen, dass wir da sind. Doch da hat sich nix gerührt. Da hab ich einen Augenblick gewartet und noch mal gerufen. Und als sich dann immer noch nix gerührt hat, bin ich vom Kutschbock gestiegen und hab nachgeguckt, und da hab ich die Frau drinnen liegen sehen. Das war kein schöner Anblick, das kann ich Ihnen sagen. Die hat so verkrümmt dagelegen und ihr Gesicht war furchtbar aufgedunsen! Ganz furchtbar! Und da hab ich mir gleich gedacht, dass da was net stimmen kann, und bin hierhergefahren.«
»Haben Sie den Mann noch gesehen?«
»Nein, der war längst über alle Berge. Ist bestimmt während der Fahrt ausgestiegen. Davon hab ich aber nichts mitgekriegt.«
»Gut, dann gehen wir jetzt zur Kutsche, damit ich mir die Tote ansehen kann. Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen, das von Belang sein könnte?«
»Ich weiß ja nicht, ob das wichtig ist, aber ich hab die Frau schon öfter gefahren. Die war immer in Herrenbegleitung, und manchmal ging es da drinnen in der Kutsche auch ein bisschen galant zu, wenn Sie wissen, was ich meine.« Schuch senkte verschämt den Blick.
»Nein, das weiß ich nicht!«, entgegnete der Inspektor barsch und ersuchte den Kutscher um eine genauere Aussage.
»Ei ja, wenn Sie’s genau wissen wollen, die war’n da drinnen halt am Pimpern.«
»Und war das immer der gleiche Mann, der mit der Frau in die Kutsche gestiegen ist, oder waren das verschiedene Männer?«
»Das waren, soweit ich mich erinnern kann, immer verschiedene Männer.«
»Also handelt es sich bei der da draußen um ein liederliches Frauenzimmer. Ich guck mir die jetzt mal an. Vielleicht ist die ja gar nicht tot, sondern hat einfach nur zu viel Branntwein gesoffen. Das wär ja nicht das erste Mal, bei solchen Weibern!« Brand erhob sich widerwillig von seinem Schreibtischstuhl.
Nach einer kurzen Begutachtung der Toten ließ der Inspektor das anatomische Institut des Senckenbergianums verständigen, um die Leiche abzuholen und zu sezieren. Die Handtasche, ein violetter Pompadourbeutel aus Satin, die neben der Leiche auf der Kutschenbank lag, hatte Brand an sich genommen. Darin befanden sich ein Fläschchen Rosenöl, ein Taschentuch, eine Geldbörse mit 25 Kreuzern, ein Hornkamm sowie ein Schlüsselbund. Sonstige Dinge, die Hinweise auf die Identität der Toten hätten liefern können, waren nicht vorhanden.
Am Montagmorgen erstattete der Städtische Leicheninspektor, Heinrich Hoffmann, Bericht, demzufolge die Tote an einer Atemlähmung gestorben war, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem toxischen Stoff verursacht worden war. Da sich allerdings keinerlei Rückstände im Blut und den Organen nachweisen ließen, mutmaßte der Leichenbeschauer, es müsse sich um ein Gift mit sehr kurzer Zerfallszeit handeln. Diesbezüglich mochte sich Doktor Hoffmann jedoch noch nicht genauer festlegen. Es gäbe mehrere Möglichkeiten, die er aber erst genauer prüfen müsse.
Nachdem eine natürliche Todesursache bei der gesunden jungen Frau laut Doktor Hoffmann eindeutig auszuschließen war, stellte sich für den ermittelnden Polizeiinspektor die Frage, ob es sich hier um eine Selbst- oder Fremdtötung handelte.
Bereits am Tag darauf klärte sich für den Inspektor glücklicherweise auf, wer die Tote war. Ihre Herrschaft, das Ehepaar Saltzwedel, hatte, nachdem ihr Dienstmädchen bereits den zweiten Tag abgängig war, eine Vermisstenmeldung eingereicht. Die Identifizierung der Leiche durch den Herrn Apotheker Ottmar Saltzwedel erwies, dass es sich bei der jungen Frau tatsächlich um die Kammerjungfer Gerlinde Dietz handelte.
Aufgrund der Befragung ihrer Herrschaften und ihrer Tante Emilie Dietz aus Offenbach, die übereinstimmend aussagten, dass die Tote weder jemals Selbsttötungsgedanken geäußert habe, noch in ihren Lebensumständen ein plausibler Grund für eine solche Tat vorhanden sei, musste im Fall der jungen Frau von einem Mord ausgegangen werden. Bezüglich Täter und Motiv tappte die Polizei im Dunkeln. Von dem liederlichen Nebenerwerb der jungen Frau, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit neben ihrer Tätigkeit als Dienerin als Prostituierte betätigte, wussten weder ihre Herrschaften noch ihre Tante und zeigten sich darüber sehr betroffen.
In den Augen Inspektor Brands gewann der Fall dennoch an Klarheit: Gerlinde Dietz war Mutter von zwei unehelichen Kindern und führte zudem noch einen höchst unsoliden Lebenswandel, indem sie neben ihrer Tätigkeit als Dienstmagd der Prostitution nachging. In einem solchen Milieu seien ja Mord und Totschlag an der Tagesordnung, erklärte der Inspektor der Journaille gegenüber. Man müsse hier vermutlich von Mord aus niederen Beweggründen wie etwa Eifersucht oder Neid ausgehen.
Im Frankfurter Konversationsblatt war zu lesen, dass es sich bei dem ermordeten Dienstmädchen, Gerlinde Dietz, um die gestrauchelte Tochter anständiger Frankfurter Bürger gehandelt habe, die nichts unversucht gelassen hätten, die Widerspenstige wieder auf den rechten Weg zu führen. Doch leider hätten sie dafür nur Undank geerntet. Die braven Leute wären über das schlimme Ende von Gerlinde untröstlich, obgleich sie, nach den Bekundungen der Mutter, so etwas schon immer hätten kommen sehen. Gerlinde Dietz war, wie der renommierte Zeitungsschreiber Schirrmann dank sorgfältiger Recherche und Befragung im Umfeld der Toten herausfand, eine leichtlebige, verantwortungslose Person, der einzig die Ausschweifung etwas bedeutet hatte. Um ihrem Lotterleben ungezügelter frönen zu können, hatte sie ihre beiden Kinder zu einer alten Tante abgeschoben und sich kaum mehr um die armen Würmchen gekümmert. Gottlob war die Städtische Fürsorge durch den schrecklichen Vorfall auf das Elend der Kinder aufmerksam geworden und hatte sie in ein Waisenhaus eingewiesen.
Inspektor Brand, der den Mörder im Prostituierten-Milieu vermutete, ließ in den folgenden Wochen verstärkt Razzien in den Bezirken der Straßenprostitution vornehmen, die bekanntlich auch von Gelegenheitsprostituierten aufgesucht wurden. Mehrere Huren, überwiegend heruntergekommene Straßendirnen, wurden in Arrest genommen und verhört. Keine von ihnen war jedoch auch nur annähernd in der Lage, stichhaltige Hinweise zur Aufklärung des Giftmordes zu liefern. Alle Frauen erklärten übereinstimmend, die Ermordete weder persönlich gekannt noch jemals in den Gegenden des Straßenstrichs gesehen zu haben.
Als sich in der folgenden Zeit ein Großteil des Frankfurter Gendarmerie-Korps und der freiwilligen Bürgerwehr zu nachtschlafender Zeit in den stillen Winkeln des Rossmarkts und der Mainzergasse herumdrückte, sich am Leonhards Tor und an der Rückseite des Römer-Rathauses gegenseitig auf die Füße trat, und die versteckten Winkel der Wall-Anlagen ebenso durchstreifte wie das gesamte Klapperfeld, blieben die Huren und ihre Kundschaft allmählich weg. Die Gassendirnen verfluchten die Allgegenwart der Ordnungshüter, die ihnen das Geschäft ruinierten, und waren schon dabei, sich neue Schlupfwinkel auszusuchen, als die für sie so lästigen Streifzüge endlich ein Ende fanden.
Schließlich sah Oberinspektor Brand ein, dass derartige Ermittlungen ihn nicht weiterbrachten. Überdies gelangte er mehr und mehr zur Überzeugung, dass weitere Nachforschungen im Falle Dietz vergebliche Liebesmüh waren, und die Aufklärung des Giftmordes verlief im Sande. Bald schwieg auch die Tagespresse und kaum ein Frankfurter zerbrach sich noch den Kopf über das vergiftete Dienstmädchen Gerlinde Dietz, die ja, wie jedermann inzwischen wusste, ein schlimmes Frauenzimmer war, und da brauchte man sich über ein ebensolches Ende nicht zu wundern.