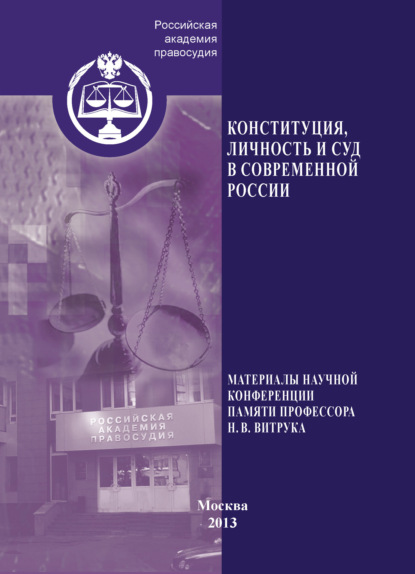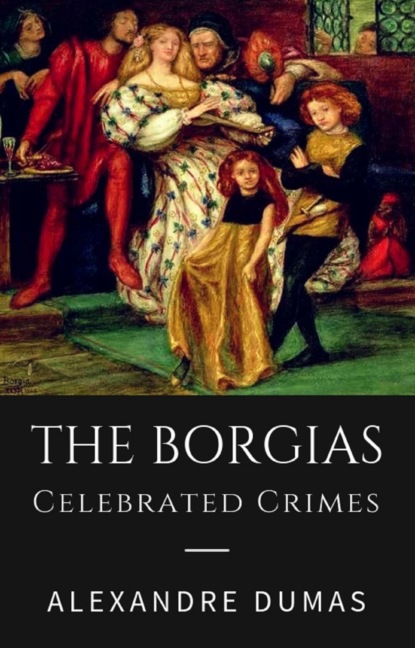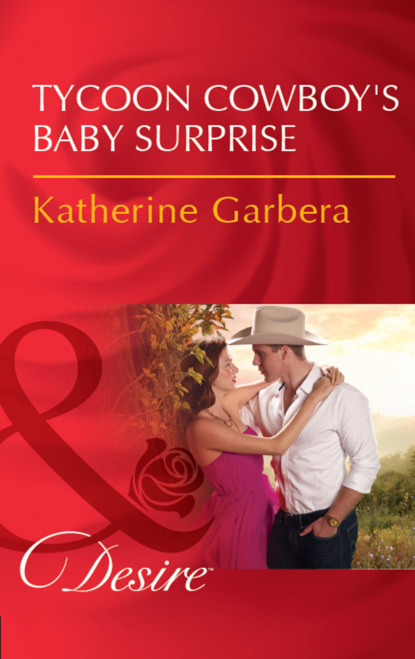- -
- 100%
- +
»Vor einem Dreivierteljahr sind wir einmal in der Stadt beinahe zusammengestoßen. Sie war auf dem Weg zur Arbeit, und ich meinte, ich käme die Tage einmal in ihrem Copy-Shop vorbei. Aber dann kam etwas dazwischen und …« Scheiße.
»Sie hat immer von dir geschwärmt, Nina«, sagt Anne. »Hat jeden Artikel über dich ausgeschnitten. Das Bild von dir bei der Polizeiprüfung und dann, als du im Heidenheimer Blatt warst als Kripobeamtin.«
Ich nicke. Was soll ich auch sonst tun?
»Hatte sie einen Freund? Von Johannes hat sie sich ja getrennt.« Weiß gar nicht, woher mir das bekannt ist.
Anne schüttelt den Kopf. »Nicht sie hat sich getrennt, er.«
»Ach. Okay.«
Ihre Schultern fallen noch tiefer hinab. »Guck doch mal, dass du endlich ’nen gescheiten Mann kriegst, Nina.«
»Wie bitte?«, frage ich.
»Das war das Letzte, was ich meiner Katrin gesagt hab.« Sie sieht mich an, die Tränen rinnen ihr über das Gesicht, und sie wiederholt es. »›Guck doch mal, dass du endlich ’nen gescheiten Mann kriegst.‹ Sie lachte nur und meinte: ›Och Mama. Ich bin doch noch jung.‹ Dabei wird sie bald 33.«
Pause. Lange Pause; und noch immer kein Schnaps. Realisiere, dass ich schon wieder an meinem Fingerstummel spiele.
»Und mit der Bande war alles gut, den Societas? Gab es da Probleme? Machtkämpfe?«
Katrins Mutter schüttelt den Kopf. »Sie hat darüber nicht viel erzählt. Weil sie wusste, der Vater mag es nicht hören. Erfuhren immer mehr von den Nachbarn oder so. Aber soweit ich weiß, waren die in letzter Zeit richtig angesehen bei den Fans. Integriert in alles. Es lief ja gut. Bei der Mannschaft und bei den Fans.«
»Weißt du, warum Johannes sich von ihr trennte?«
»Weil er sie aufgegeben hat!«, brüllt Vater Benzeler, fällt aber sofort wieder zurück in Lethargie.
Anne schüttelt den Kopf. »Er hat ihr vor zwei Jahren einen Antrag gemacht. Aber Katrin hat ihn abgelehnt.«
»Echt?« Ich kann es kaum glauben: Der einst wichtigste Spieler der Mannschaft macht ihr einen Antrag, und sie lässt ihn abblitzen. Aua.
»Hab ich ihr auch gesagt: Der Johannes hat eine Zukunft. Aber sie konnte sich nie gut entscheiden. War immer ihr Problem. Wollte sich nicht festlegen.«
»Es gab aber keinen anderen?«
Mutter Benzeler blickt mich an, ihre Augen sind rot und ertrinken. »Nina. Sie hat dich immer vermisst, weißt du.«
Ich starre sie an. Ich kann nicht wegsehen.
»Das hat sie oft zu mir gesagt: Es sei einfach nicht mehr dasselbe ohne dich.«
Dann stehen wir irgendwann draußen. Rauchend glotze ich die Alles-in-Ordnung-Allee hinab. »Ich sollte hierbleiben. Sollte ihnen …« Aber ich kann nicht, spiele mit meinem Therapie-Gummiband am Handgelenk, will meine Atmung beruhigen. Und mein Hirn.
Schröter versucht zu retten, was zu retten ist. »Den Schnaps hättest du rein nach Vorschrift nicht trinken dürfen.«
Habe ich?! Anscheinend. Ich weiß echt nichts mehr. »Ich brauch ein Bier.«
»Wir müssen in ihre Wohnung.«
»Ich habe keinen Bock!«
Er zieht die Augenbrauen nach oben wie mein Religionslehrer damals.
Ich bin hier die Vorgesetzte, verdammt! Auf Professionalität darf nur ich mich berufen.
»Verstehe, wer das Opfer war, und du erkennst, wie dein Täter ist.«
»Wo du immer diesen Mist hernimmst, Schröter.«
Kontrolliertes Chaos
Einsam liegt ein einziger Füßling auf dem Teppich in der Mitte des Wohnzimmers. Wie Katrins Leiche oben auf dem Schlossberg.
Kleine Wohnung, 60 Quadratmeter, schätze ich. Eckcouch, ein bisschen zerschlissen. Fernseher. Esstisch für vier Personen. Klamotten hier und Schuhe da, alles ziemlich chaotisch. Als sei sie gestern noch hier gewesen. War sie ja auch. Aber unter der Schlamperei – bei mir sieht’s um einiges schlimmer aus – alles auch irgendwie adrett, um nicht zu sagen spießig. Und in jedem Zimmer mindestens fünf Kätzchenabbildungen oder süße Katzenfigürchen. Frage mich, warum sie sich keine angeschafft hat. An der Wand ein Bild der aktuellen FCH-Mannschaft, bestimmt zwei auf einen Meter.
»Wären die vielen Miezen nicht, könnte es die Wohnung eines Junggesellen sein«, meint Schröter.
»Und der da.« Ich zeige mit der Nasenspitze auf das Söckchen.
Intimschnüffelei. So gar nicht mein Ding. Ich fühle mich immer schlecht, wenn wir in Wohnungen fremder Leute herumschleichen, mit Gummihandschuhen Gegenstände befummeln, zu denen die Eigentümer eine ganz persönliche Beziehung hatten, die nur sie kannten. Für uns sind es einfach Dinge, für die Personen Geschichten. Reliquien ihres Lebens.
Es ist wie mit den Leichen auch: Sie sind Arbeitsmaterial. Wie für den Tatort-Paparazzo heute Morgen. Zurückhaltung ist da fehl am Platz. Es geht darum, Beweise zu sichern, und nicht darum, dem Opfer gegenüber Abstand und Anstand zu wahren. Oder bei einem Verdächtigen. Oder Angehörigen. Wir schnüffeln in alle Winkel und Ritzen eines Lebens hinein, graben die liebevoll gehegten Geheimnisse einer Person ebenso aus wie die hässlichen, zerren sie ans Tageslicht. Das ist unser Job. Pietätlosigkeit mit Lupe und hochauflösender Kamera.
Arbeitszimmer mit Stapeln von Akten. Kleiner Schreibtisch, Notebook. »Das nehmen wir mit«, bestimme ich.
»Sollen wir die Spurensicherung reinschicken?«, fragt Schröter, und ich zucke mit den Schultern.
Schlafzimmer. Zerknülltes Laken. Hübsche Farbe. Handschellen mit Plüschbezug am Gitterrost.
Dann entdecke ich das Bild an der Wand: Cat, Arm in Arm mit ihrem Ex Johannes und einer Frau, die aussieht wie ich, nur jünger, und mit meinem Leo. Meinem Ex-Leo. Alle in den Farben der Osttribüne, der Heimat der FCH-Ultras, lachend. Bier in der Hand. Das Opfer und eine Person, die ich nicht mehr bin. Das ist fast zehn Jahre her, ich hatte weniger Falten und definitiv viel, viel weniger Ringe unter den Augen. War ich wirklich einmal so? Was für ein Weg führt von dieser Frau da zu der Person, die ich heute bin?
Schröters Handy klingelt im Nebenraum, und er geht ran. Klingt nach der Forensik.
Ich komme nicht los von dem Bild. Warum habe ich den Kontakt nicht gehalten? Warum sie nicht ab und zu angerufen? Wäre nichts dabei gewesen. Ich ertappe mich beim Stummeln, reiße mich los von dem Bild und schnüffle weiter herum. Finde nichts Spezielles. Da liegt noch ein Bild. Ein Foto. Auf dem Nachttisch. Ein junger Kerl, sehr attraktiv. Dunkler Teint, schwarze Locken. Irgendwoher kenne ich den.
»Das war die Gerichtsmedizin«, holt mich Schröter zurück, der im Türrahmen steht. »Wie vermutet. Todesursache die drei Stiche direkt ins Herz.« Mir wird schlecht. Wut steigt in mir auf. Zu wem hast du hochgeblickt, Katrin? Welches Dreckschwein hast du als Letztes angesehen in deinem kurzen Leben?
Schröter scheint zu ahnen, was ich denke. Er sieht mich wieder mit seinem Religionslehrerblick an, und ich werde noch wütender. »Was?!«
Er schüttelt den Kopf. »Nichts.« Es brodelt.
»Wurde sie vergewaltigt?«, fahre ich ihn an.
»Wissen sie noch nicht genau. Erster schneller Befund: vermutlich nicht.« Schröter zieht Augenbrauen und Schultern nach oben.
Irgendwann halte ich seinen Blick nicht mehr aus. Ich betrachte erneut das Foto von Cat und mir und bin froh, dass er nicht näherkommt. Ich will nicht, dass er mich so sieht. Dann nehme ich den Rahmen von der Wand. Scheiße. Fröhlicher. Viel, viel fröhlicher. Die Nina Schätzle von damals. Was ist passiert? Wo habe ich das gelassen, verdammter Mist?
Im Moment bin ich froh über den kleinen Dachschaden, den ich habe. Der macht, glaube ich, vieles leichter.
»Ruf Berti an. Er soll hier alles auseinandernehmen. Alles!«
»Ich dachte …«
»Ist mir egal, was du dachtest!«
Wann bin ich eigentlich in diese beschissene Abseitsfalle geraten? Wenn ich dieses Schwein erwische.
Tinder oder die Götterkomödie
Tinder-Date am vorigen Sonntag.
Ich denke mir, was soll’s, muss auch mal abschalten, und sage zu.
Und da sitze ich nun. 09:30 Uhr. Eigentlich eine unmögliche Zeit für so ein Treffen. War sein Vorschlag. Aber ich wollte eh mittags noch einmal die aktuellen Fälle durchgehen und dann einen kleinen Spaziergang über den Hochberg machen. Das hilft mir, mich zu ordnen.
09:40 Uhr kommt er endlich. Ich musste schon zweimal den Kellner vertrösten und bin bereits genervt. In der Realität sieht er weniger gut aus als auf den Fotos. So ist es ja immer.
Jetzt kommt der Kellner natürlich nicht mehr. Klar. Ich würde es genauso machen. Der Typ grinst über beide Ohren, und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zunächst bin ich froh, dass er mich nicht erkennt. Ich war die letzten Jahre häufig in der Presse, das macht das Privatleben nicht leichter. Und haben die Jungs erst einmal mitgekriegt, dass ich ein Bulle bin, dann klemmt ihr Schwanz in der Regel schon so eng zwischen den Schenkeln, dass man nicht weiß, ob man sich noch mit einem Kerl unterhält oder mit einer Pussy.
Wir bestellen. »Einen großen Kaffee, bitte, schwarz.«
»Eine Halbe Bier.«
Wie bitte? Sein breites Grinsen verrät nicht: War das ein Scherz, oder meint er es so? Die lange Pause dagegen offenbart die Gedanken des Kellners, der darauf wartet, dass die Aussage revidiert wird. Wird sie aber nicht.
Der Kellner mustert den Typ, dann blickt er mitleidig zu mir, notiert die zwei Dinge, als ob er sich die nicht merken könnte, vor allem das zweite, blickt erneut zu mir auf und ich sehe genau, dass er sich hinter seinem professionellen Gesichtsausdruck totlacht. Der kriegt sich nicht mehr ein. Dreht sich um und geht. Schnell. Wahrscheinlich kämpft er darum, nicht lauthals loszulachen.
Ich blicke zu meinem Date und frage mich, warum ich meinen Kaffee nicht gleich storniert habe. Aber irgendwie kriegte ich es in diesem Moment nicht hin. Und jetzt? Jetzt sehe ich meinen ersten freien Sonntagvormittag seit sechs Wochen durch die Bierlatrine rinnen, schaffe es aber nicht, einfach aufzustehen und zu gehen.
Erneutes Aufblitzen seiner Zähne. Na gut. Dann nehme ich es als Übung für Sozialkompetenz. Vielleicht stellt sich im Gespräch heraus, er hat im Lotto gewonnen und möchte feiern oder ihm wurden gestern die Scheidungspapiere zugestellt, er hat seinen Führerschein zurückerhalten oder ist Vater geworden.
Nein. Nichts dergleichen. Er findet es schlicht normal. Und hat definitiv nur wenig Kerzen im Kronleuchter. »Du weißt, dass zu viel Kaffee ungesund ist.«, »Alter. Das Gequatsche über Emanzipation macht mich fertig. Haben echt andere Probleme.«, »Was ist mit deinem kleinen Finger passiert?« Und so fort.
Der Typ hatte im Chat in geraden Sätzen geschrieben. Jetzt aber redet er nur gequirlte Kacke. Und: Er verbessert mich ständig. Schüttelt bei jedem zweiten Satz von mir den Kopf, heftig, störrisch, wie meine Mutter als ich 15 war, mich für Umweltpolitik begeisterte und ihr so manchen jugendlich-verblendeten Vortrag gehalten habe.
»Ne, das ist nicht richtig«, erwidert er ständig. »Das ist nicht richtig«, eigentlich bei jedem Thema. Er geht bei allem in Opposition. Lenke ich nicht ein, fabuliert er immer heftiger, seine flache Hand tätschelt dabei die Tischplatte. Eine ziemliche Herausforderung für meine eh viel zu kurze Zündschnur. Aber gutes Antiaggressionstraining für meinen Dachschaden.
»Fußball? Fußball ist doch was für Deppen. Die haben nichts in der Birne. Nicht die Kicker und die Fans noch viel weniger. Das ist doch gar kein richtiger Sport.«
»Und was ist ein richtiger Sport?« … »Kickboxen? Aha. Okay.« Ich sehe ihn an. Sage lieber nichts. Irgendwann dann doch.
»Das ist nicht richtig. Mädel. Du hast doch keine Ahnung. Das hat etwas mit dem Chi zu tun. Mit geistiger Klarheit, innerer Reinheit in einer Kampfsituation. Sich in den andern hineinversetzen, weißte, was er als Nächstes vorhat und so. Verstehste? Und Umleitung von Energie, die auf mich zukommt.«
Chi? Ne, verstehe ich nicht. Und innere Reinheit noch viel weniger. Die dreschen doch nur aufeinander ein.
»Kampf- und Geisteskunst in einem ist das. Ich meditiere vor jedem Fight eine halbe Stunde.«
Mein Blick scheint ihn ebenso zu nerven wie das, was ich sage oder eben nicht. Er redet sich immer mehr in Rage und wird dabei zunehmend lauter und bissiger im Ton. Was will der von mir, frag ich mich die ganze Zeit. Soll ich jetzt ernsthaft in den Staub fallen, weil er wochenends nach Stuttgart oder Ulm fährt, sich dort in einer kleinen, schweißmiefenden Turnhalle aufs Linoleum setzt, ein paar Chi spricht und dann auf irgendeinen Typen eindrischt?
Ich zucke zusammen, als er wieder auf die Tischplatte schlägt. Die Leute sehen schon her, will ich sagen.
Und so geht’s weiter.
Sozialkompetenz, Nina. Gewaltfreie Kommunikation. »Ich nehme da eine gewisse Aggression wahr … Das macht mich irgendwie … Es wäre mir lieber, wenn wir das Thema …«
Kommt nicht an bei ihm.
Irgendwann nehme ich es als Menschenstudie, blicke von oben auf die skurrile Szene hinab, fasse nicht, was der armen Frau Oberkommissarin da gerade widerfährt. Das Leben ist ein einziger Witz; aus der Götterperspektive betrachtet. Warum gibt es eigentlich so wenige Abbildungen von schmutzig und schallend lachenden Göttern? Die machen sich doch einen Spaß daraus, ausgerechnet mich mit meiner speziellen Behinderung in eine solche Lage zu bringen.
Währenddessen schütte ich den Kaffee in mich hinein. Warum habe ich nur einen großen bestellt?! Wahrscheinlich, weil mein Schmutzengel es mir im Auftrag der Götter ins Ohr gesäuselt hat. Damit sie noch länger was zu lachen haben.
»Ein Kollege in der Nachtschicht«, brüllt er nun fast, »der ist bei den Ultras vom FCH. Uwe Boltz. Was für ein Typ. Selbst total unsportlich, aber jeden Sonntag aufm Platz. Und immer schlaue Sprüche, als sei er die rechte Hand des Trainers. Lässt sich aber von so Mädels im Block auf der Nase rumtanzen.«
Der sitzt. Aber ich habe mich im Griff. Ommm.
Wider alle Vernunft, auch trotz der Wut, die immer mehr in mir hochkocht, starte ich einen letzten Versuch, das Gespräch zu lenken. Führt nur dazu, die Aufmerksamkeit weiterer Leute zu erregen. Als die Tasse endlich leer ist, eröffne ich ihm höflich, ich hätte heute noch einiges zu erledigen und … Er glotzt mich an wie eine frisch geklopfte Frikadelle. »Nee. Wir sind doch verabredet, wir zwei.«
»Ja. Es war auch nett.« Ich sag’s ja: Götterkomödie.
»Nett? War? Aber wir verbringen den Sonntag miteinander.«
»Wie jetzt?«
»Na, wir sind verabredet, also verbringen wir den Sonntag zusammen. Ich hab heute nichts mehr vor.«
»Ich schon.«
Ungläubiges Glotzen.
»Du, wie gesagt: Ich muss noch arbeiten. Wir haben uns einen ersten Eindruck verschafft, und das lassen wir beide nun sacken und schreiben uns wieder.«
»Was bist du denn für eine?« Sein Blick wird richtig fies. Fehlt nur noch, dass er wieder auf den Tisch haut.
»Dein Ton gefällt mir nicht.« Jetzt tut er’s. Und ich zucke zusammen. Langsam stehe ich auf. Dass das halbe Café mittlerweile zusieht, ist mir egal. »Ich geh dann mal.«
Und nun fängt er an zu brüllen. »So eine bist du also!« Alle Gäste und das gesamte Personal starren erschrocken zu uns herüber, und ich spüre, wie ich rot werde. Hinten in der Ecke der grinsende Kellner, der sich kaum einkriegt vor Schadenfreude.
»So eine bist du! So gehst du mit Menschen um!« Mit jedem Wort wird er noch lauter.
»Das ist wohl nicht die richtige Form, um mich zum Bleiben oder zu einem zweiten Date zu bewegen.« Formechte gewaltfreie Kommunikation. Zwei Seminare hatte ich dazu.
»Ein Luder bist du! Ein dreckiges Luder«, krächzt er, und die Bierspucke rinnt ihm aus den Mundwinkeln und am Kinn hinab.
»Hör mal. Ich war echt höflich, aber wenn du nicht …«
»Drecksfotze. So springt man nicht mit Menschen um!«
Ich gehe in Habachtstellung, bevor der mich noch anfällt. Aber meine Körperhaltung provoziert ihn wahrscheinlich zusätzlich. Zugegeben: Das lernt man anders im Deeskalationsseminar. Er ist außer sich, und ich weiche vorsichtig zurück, ihn immer im Blick behaltend. Und kein Kellner eilt der Dame endlich zu Hilfe. Was ist das hier für eine verfluchte, abgekartete Komödie?
»Also, mein Lieber. Ich wünsche dir jedenfalls einen schönen Sonntag, eine traumhafte Woche und weiterhin ein bewegtes Leben.« Ich drehe mich in genügend Entfernung um und will gehen. Dann springt er doch auf mich los. Na ja. Eigentlich packt er mich nur unsanft von hinten an der Schulter. »Du kannst mich nicht einfach stehen lassen, ich …« Weiter kommt er nicht. Ihn zu überwältigen ist einfach. Obwohl er eineinhalb Köpfe größer ist als ich. Er erwartet keine Nahkampf-Ausbildung, unser Kickboxer. Und ich weiß wieder, warum ich meinen Beruf nicht preisgebe bei Tinder-Dates. Schon liegt er mit der Fresse auf dem Boden, einen Arm verdreht in die Höhe und meinen Schuh im Nacken. Und winselt wie ein Welpe.
Zugegeben: Definitiv keine gewaltfreie Kommunikation mehr.
Und endlich setzt sich auch der Grinsekellner in Bewegung, macht große Augen und fragt, ob er die Polizei rufen soll. »Ne, die ist schon da.« Den Satz wollte ich schon immer einmal sagen. Ich zeige ihm meinen Ausweis, beuge mich langsam zu dem Hündchen hinab und flüstere ihm ins Ohr: »Ich sehe von einer Anzeige ab. Aber ganz ehrlich: Du solltest an deiner Flirttechnik arbeiten.« Mit diesen Worten lasse ich ihn liegen.
Ich sag’s ja: eine einzige Götterkomödie.
Die Musik der Kurve: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel
Schröter lacht noch immer über die Geschichte mit meinem Tinder-Date. Mit Abstand und genügend Alkohol ist sie ja auch durchaus witzig.
»Scheiße, war der Tag bitter.« Ich bin müde und angeschlagen.
Wir sitzen im König Wilhelm. Die einzige Kneipe, die nahezu alles hat, was meine Seele für ein bisschen Entspannung benötigt: abgewetztes Mobiliar, aufrechte Drinks ohne Hipster-Schnickschnack, Raucherlaubnis. Mein persönliches Feng-Shui; zerschundene Umgebung für eine wunde Seele. Und heute ist sie besonders wund.
Das erste Bier habe ich beinahe in einem Zug geleert. Ich habe mich wieder einigermaßen im Griff. Auch deshalb, weil ich gedanklich ein wenig weg war von unserem »Fall«. Ich will Cats Tod eigentlich nicht so nennen.
»Du warst also mal FCH-Fan.«
»Bin. Nur nicht mehr aktiv.«
»Aha.«
Schröter nippt an seinem Bier. Ja, er nippt. Sonst ist er in Ordnung. Aber saufen kann man nicht mit ihm. Und von Fußball hat er keinen blassen Schimmer.
»Warum verbringst du deine Sonntage dann nicht mehr im Stadion, sondern zu Hause auf der Couch und chattest mit fremden Männern?«
»Was ich mit fremden Typen tue, geht dich gar nichts an, Schröter. Du hattest deine Chance in der vierten Arbeitswoche. Und ins Stadion gehe ich nicht mehr, weil ich mit dem Thema durch bin.«
»Aha.«
»Weil ich es nicht mehr will.«
»Aha.«
Der geht mir auf die Nerven! »Herrgott. Ist ’ne längere Geschichte.«
Er nippt wieder. Meine Güte!
»Ich war in jungen Jahren bei den Societas.«
»Du warst mal jung?«
»Haha. Vorderste Front. Unser Banner hängt am Zaun auf der Ost direkt neben dem der Fanatico Boys.«
»Das ist vermutlich das männliche Pendant der Ultras.«
»Genau. Pendant. Du bist ein Kombinationsgenie, Alter. Wirst es noch weit bringen bei der Kripo.« Ich trinke mit einem kräftigen Zug mein Bier aus und bestelle zwei neue. Auch wenn Schröters noch nicht einmal halb leer ist. Die nächste Kippe.
Ja, gut. Ich habe Schröter in seiner vierten Arbeitswoche angegraben. Ich finde ihn durchaus attraktiv. Und im großen Ganzen ist er auch so weit okay. Und wer kann schon wirklich wissen, wie es bei den Leuten zu Hause gerade läuft.
»Und was tut man da so? Als Ultra?«
»Was Fans eben so tun. Sich treffen, gemeinsam zum Spiel gehen, anfeuern, zu Auswärtsspielen fahren, die Mannschaft unterstützen, eskalieren. Die spielten damals noch in der dritten Liga; aber schon richtig gut. Und wir haben sie angepeitscht und gebrüllt, bis das Rachenzäpfchen wund war.«
»Was ist das Fanprojekt, von dem die Mutter des Opfers sprach?«
»So etwas gibt es in mehreren Städten, fast überall, wo große Vereine sind. Fanprojekte funktionieren als Netzwerke unter den Anhängern, vermitteln zwischen Vereinen und Fangruppen. Das Ganze wird unabhängig von den Clubs unterstützt: vom DFB, vom Land und von sozialen Einrichtungen. Hier in Heidenheim sind zwei Sozialpädagogen beim Fanprojekt angestellt. Damals gab es solche Einrichtungen noch nicht. Vielleicht sollten wir uns mal mit denen unterhalten. Die fahren bei den Spielen mit, nehmen sogar an den Sicherheitsbesprechungen davor teil, weil sie nah an den Fans dran sind und einschätzen können, wie die Stimmungslage ist.«
»Okay.«
»Seit die Fans da eine Plattform und ein Forum finden, trifft sich die Szene dort vor dem Spiel, und dann geht es geschlossen hoch zum Albstadion. Nach dem Spiel ist dort meistens noch Halligalli.«
»Diesen Rummel kann ich ja nicht nachvollziehen.«
Ist mir klar.
»Die Emotionen. Warum diese Aufregung wegen eines Spiels?«
»Da geht’s nicht um ein Spiel, Schröter. Da geht’s um Identität. Die Bande, die Societas, das war wie eine Familie. Die ganze Fantribüne. Du hast doch Kinder. Wenn die in der Schule gut sind oder im Sport irgendwas reißen, macht dich das stolz. Weil sie zu dir gehören.«
»Natürlich bin ich dann stolz.«
»Mein Vater war aus der Wunder-von-Bern-Generation. Einer derjenigen, die das Glück hatten, zu jung zu sein für den Nazikrieg. Zu Hause mit Muttern, nichts zu futtern. Und danach Besatzung, wieder nix zu fressen. Und dazu die Scham des Verlierers, die wachsende Erkenntnis der Deutschen, dass sie nicht einfach Opfer dieses kleinen Ösis waren, der ein unschuldiges Volk verführte, sondern dass sie das wirklich alles mit durchgezogen, dabei Europa verwüstet und Millionen Menschen den Tod gebracht haben. Als Kind nimmst du es nur unbewusst wahr, aber du kriegst es mit, und du kannst es noch viel weniger einordnen oder von dir fernhalten. Die Schuld, die Offenlegung der Grausamkeiten, all diese Scheiße.« Interessiertes Nippen. Solche Gespräche mag der Schröter. »Aufgewachsen in dem Bewusstsein, die größte Schuld der Welt auf seinen Schultern zu tragen. Ein Wunder, dass man da überhaupt wächst. Und dann kam diese Fußball-Weltmeisterschaft. Bei der Deutschland ein absoluter Außenseiter war, ein Verlierer, der Dreck unter den Fingernägeln der Welt. Und gewinnt überraschend, wird Weltmeister. Das war eine Offenbarung für das Land, für die Menschen. Ob sie das nun verdient hatten oder nicht.«
»Schon klar. Die Deutschen waren wieder wer. Aber die Welt tickt heute anders.«
»Tatsächlich? – Ich weiß noch genau, wie meine Schwester und ich an seinem Totenbett saßen und er uns vorschwärmte, wie der Teil der Familie, der den Krieg überlebt hatte, damals gebannt vor dem Radio hing und die letzten Momente des Endspiels mitzitterte. ›Tooor! Tooor! Deutschland ist Weltmeister!‹ Genauso wie sie zehn Jahre zuvor bei den Propaganda-Sendungen der Nazis saßen und dann bei den Berichterstattungen über die Prozesse. Und mit einem Mal hat das Land das Gefühl, wieder irgendwas Positives getan zu haben. Etwas Gutes geleistet. Wenigstens ein weißer Fleck auf dem kriegbeschmierten Hemd. Wie er immer von den Helden von Bern schwärmte, von Fritz Walter, von Kaiserslautern. Die halbe Nationalmannschaft bestand damals aus Spielern vom Betze. Wie heute von Bayern München.«
Ich muss lachen. Ich glaube, es wäre schwierig für meinen Vater geworden, hätte er den Aufstieg der Heidenheimer in die zweite Liga noch erlebt und der FCH wäre gegen die Lauterer auf dem Betzenberg angetreten. Na ja. Nicht wirklich. Aber ein wenig schizophren. Er fand die Heidenheimer klasse, aber Kaiserslautern war für ihn der Olymp. Das Unantastbare.
»Woran ist er gestorben?«
»Leukämie. Ernährte sich sein Leben lang supergesund, rauchte nie, trieb Sport. Spielte damals mit Benzeler zusammen in der ersten Mannschaft des FCH-Vorgängers VFL Heidenheim, später war er Jugendtrainer. Und mit 50, als das nicht mehr so ging, begann er damit, Marathon zu laufen. Und dann rafft ihn der Blutkrebs innerhalb eines halben Jahres weg. Der Benzeler hat’s nicht glauben wollen, mein Vater auch nicht. Ich weiß noch, wie ich nach der zweiten Chemo mit Papa beim Arzt sitze und nicht anders kann, als zu fragen: ›Von wie lange sprechen wir? Reden Sie mal Tacheles.‹ Und der sagt: ›Fünf, sechs Monate.‹ Ich glaube, Papa wollte das gar nicht wissen. Und was antwortet er? ›Pffff. Ich schaffe mehr.‹«