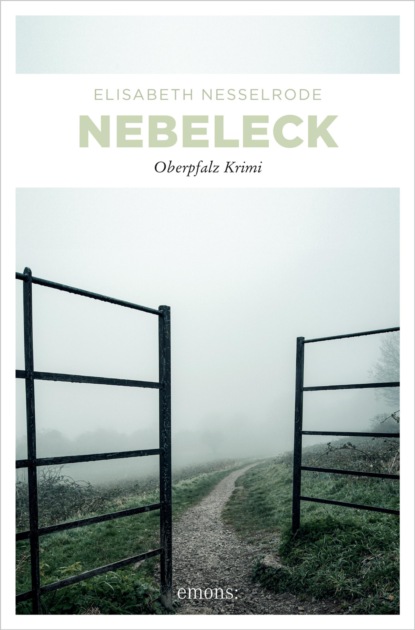- -
- 100%
- +
»Keine beste Freundin? Keine enge Vertraute?«
»Eine engere Freundin ist, laut den Mitschülerinnen, Jennifer Hellwig. Wohnhaft in Nürnberg. Ich habe sie bisher noch nicht erreicht. Da bleibe ich dran.«
Ulrike betrachtete die Kopie des Passfotos, das sie von Tanjas Mutter erhalten hatte. Tanja war keine typische Schönheit. Und dennoch lag etwas in ihrem Blick, das einen fesselte und zweimal hinschauen ließ. Das braune, glatte Haar hing über ihrer Schulter, die Augen waren mandelförmig und groß, sie hatte auffallend hohe Wangenknochen und schmale Lippen, auf denen ein seltsames Lächeln lag.
Wo bist du?, dachte Ulrike und ließ alle möglichen Szenarien in ihrem Kopf wie einen Schnellfilm ablaufen: nichts ahnend, untergetaucht, entführt, tot. Selbst wenn sie in Nebeleck gewesen war, es gab keine Spur, sie hatte nichts zurückgelassen. Tanja war ein Phantom. Ulrike stellte sich das geisterhafte Wesen auf dem verlassenen Hof vor und hatte für einen Augenblick den absurden Gedanken, dass sie immer noch dort war, in einer Ecke stehend, auf einem Stuhl sitzend und sich über all den Trubel wundernd. Vielleicht hatte man sie einfach übersehen.
»Ich möchte, dass heute noch eine Fahndung herausgegeben wird. Wir müssen sie so schnell wie möglich finden.«
»Ich kümmere mich darum«, sagte Yusuf und machte eilig eine Notiz auf seinem Block.
»Und in Schwanghaus ist auch nichts herausgekommen?« Ulrike blätterte durch den Bericht, den Yusuf ihr gestern übergeben hatte. »Wer hat die Befragungen durchgeführt?«
Die beiden anderen Beamten, die neben Franka und Yusuf im Raum saßen, hoben simultan die Hände, der eine räusperte sich. Sein Name war Stefan Brunner. Ulrike hatte sich das markante Gesicht schon eingeprägt, seine Augen hatten unterschiedliche Farben, das eine tiefbraun, das andere eisblau.
»Wir haben immer nur dasselbe gehört«, berichtete Brunner. »Berger war ein Perverser, ein Trinker, Kauz aus der Stadt. Anscheinend konnte keiner was mit ihm anfangen oder wollte was mit ihm zu tun haben.«
»Man muss dazu sagen, dass viel davon der übliche Klatsch war«, sagte der zweite Polizist, ein etwas untersetzter Blonder mit rotem Gesicht. »Irgendeine Sau wird ja immer durchs Dorf getrieben.«
»Ich frage mich, woher dieser Unmut kommt«, überlegte Ulrike laut. »Wenn keiner was mit ihm zu tun haben wollte, woher stammen dann all diese Geschichten?«
»Das haben wir auch gefragt. Und auch das wusste niemand so genau«, sagte der Untersetzte, dessen Namen Ulrike vergessen hatte.
»Es kann natürlich auch sein, dass sie sich dazu einfach nicht äußern wollten«, fügte Stefan Brunner hinzu.
Ulrike schaute zu Franka. »Deine Cousine, die hat auf diese Frage ganz ähnlich reagiert. Sie hat auch gesagt, dass sie nichts über den Ursprung dieser Gerüchte wüsste.«
Franka schien nachzudenken und nickte dann vorsichtig. »Das stimmt«, gab sie leise zurück.
Es wurde still, Ulrike seufzte. »Wir kommen nicht weiter, solange Tanja Grass verschwunden bleibt. Wir müssen sie finden. So schnell wie möglich!«, wiederholte sie und erklärte damit die Besprechung für beendet. Stühle wurden verschoben, Zettel raschelnd zusammengelegt. Die Tür wurde geöffnet, und bald war Ulrike ganz allein. Der Geruch von frisch aufgebrühtem Kaffee drang ihr in die Nase. In Gedanken versunken drückte sie auf dem Knopf ihres Kugelschreibers herum und legte die Stirn in Falten. Sie hatte das Gefühl, ihr würde die Zeit davonlaufen. Tag drei, und sie hatten nichts außer einem ausgebüxten Teenager und ein paar fiesen Gerüchten. Sie atmete tief durch, dann schlug sie ihren Block auf, blickte auf die erste Seite und die großen schwarzen Buchstaben. SCHWANGHAUS.
Jemand klopfte am Türrahmen. »Frau Kork?«, vernahm sie die Stimme von Stefan Brunner, der vorsichtig in den Raum linste.
»Ulrike«, erinnerte sie ihn freundlich an das vor der Besprechung angebotene Du. »Komm rein.«
Er räusperte sich. »Ich weiß nicht, ob mein Gefühl mich trügt, aber es gab da etwas, das mir aufgefallen ist. Vielleicht ist es nicht wichtig, aber ich wollte es trotzdem loswerden.«
»Was?«, fragte Ulrike ungeduldig.
»Wir waren im Drosselweg 28, wo Matthias König wohnt. Ich hatte einmal mit ihm zu tun, deswegen war er mir gegenüber recht freundlich und auch aufgeschlossen. Hat mich wie einen alten Bekannten behandelt.«
»Die Schlägerei auf dem Stadtfest?«
Stefan nickte. »Ja, auch wenn er natürlich der volle Prolet ist, haben wir uns damals ganz gut verstanden. Gestern, als wir da waren, da stand er im Garten und hat gearbeitet. Wir haben nach Herrn Berger gefragt, und er hat das Gleiche erzählt, was alle gesagt haben: Kennt er nicht, weiß er nichts von, hat nur gehört, dass der wohl ein Perverser ist, das Übliche.«
»Und was dann?«
»Wir haben uns nach Tanja erkundigt, und da …« Stefan Brunner zögerte für einen Augenblick. »Als wir den Namen gesagt haben, da hatte ich das Gefühl, da ist ihm ganz kurz seine Mimik entglitten. Nur für einen Moment.«
»Du meinst, dass er etwas wissen könnte?«
»Ich meine gar nichts«, sagte Brunner. »Ich hab es nur registriert. Das kam mir komisch vor.«
Ulrike nickte. »Danke. Gut beobachtet.«
Stefan Brunner verließ den Raum, und Ulrike sah wieder auf ihren Zettel. Gedankenverloren kritzelte sie Tanjas Namen auf das Papier. »Wo bist du, in Gottes Namen?«, wisperte sie.
***
Sie stand am Rande der Lichtung, völlig bewegungslos, und hielt den Atem an, während sie das einzigartige Naturschauspiel betrachtete, das sich ihr bot. Sie wusste nicht, wie oft sie schon Zeugin dieses Phänomens geworden war, aber es war ein Ritual gewesen. Fast jeden Morgen, wenn die Bedingungen stimmten, war sie aufgestanden, hatte sich einen Tee gemacht, war durch das hohe, feuchte Gras hier an genau diese Stelle gelaufen und hatte beobachtet, wie der Hof langsam hinter dem dampfenden Nebel verschwand.
Wenn die Sonne durch die Baumwipfel drang, legte sich der Nebel, und die feinen Tropfen in der Luft und auf dem Gras und den Ästen reflektierten das Licht und glitzerten in der kühlen Morgensonne. Es gab immer diesen kurzen Augenblick, den sie besonders liebte, wenn der Nebel gerade über dem Gras war und in dunstigen Schwaden nach oben stieg. Dann sah es so aus, als befände sie sich auf einer Wolke. Der Hof war von Sümpfen umgeben, hatte Leonard ihr am Anfang mal erklärt, als er noch mitgekommen war. Damals, als alles noch gut gewesen war.
»Du bist nicht wie die anderen, Elfe«, hatte er früher oft gesagt, »du lässt mich nie allein, richtig, Elfe?«
Sie hatte den Kopf geschüttelt und sich dann ganz tief zwischen seinen warmen Armen vergraben. Sie hatte gelogen.
Jetzt war alles anders. Der Nebel, der einst so mystisch um das Haus gekrochen war, wirkte an diesem Morgen bedrohlich, wie eine schwere Decke, unter der alles begraben lag. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Sie dachte an Leonard, seinen verkrümmten Körper, all das Blut. Sie war zurückgekehrt an jenem Morgen, aber es war zu spät gewesen. Sie hatte Theo im Zwinger gesehen, Leonard hätte ihn normalerweise um diese Uhrzeit schon rausgelassen und gefüttert gehabt. Tief in ihrem Inneren hatte sie da schon gewusst, dass sie zu spät gekommen war, und gleichzeitig nicht ganz aufgehört zu hoffen, dass es doch noch eine Chance gab, ihn zu retten.
Es war alles ihre Schuld gewesen, sie hätte nur etwas geduldiger mit ihm sein müssen, sie hätte warten müssen, bis sich alles wieder beruhigte, so wie Leonard es ihr immer gesagt hatte. Aber es war alles immer schlimmer geworden, und sie hatte Angst gehabt.
Sie schluchzte auf, ließ sich auf den feuchten Boden sinken und steckte den Kopf zwischen die Knie. Nein, es war nicht allein ihre Schuld gewesen, dachte sie dann.
»Elfe, geh nicht ins Dorf«, hatte er einmal zu ihr gesagt. Er war tief in der Nacht nach Hause gekommen, seine Stimme war brüchig vom Alkohol. »Das sind Schlangen im Dorf. Und wenn du nicht aufpasst, dann schnappen sie zu, und dann fressen sie dich auf mit Haut und Haaren.«
8
Es war nach sieben, und Ulrike saß wieder an ihrem Schreibtisch am Fenster, von dem sie auf die Kreuzung blicken konnte. Der Untersetzte, sein Name war Dominik Stöckl, steckte gerade seine Brotzeitbox in seine Tasche und war auf dem Weg nach draußen. »Schönen Feierabend«, sagte er, und Ulrike winkte ihm kurz zu, ohne aufzublicken.
Franka Brandl saß ihr mit müden Augen gegenüber. Es hatte viel zu lang gedauert, von der Telefongesellschaft die Liste der von Bergers Handy und seinem Festnetzanschluss aus- und eingegangenen Anrufe zu erhalten. Franka arbeitete sich chronologisch von vorn nach hinten durch, markierte bekannte und unbekannte Nummern und ordnete die nicht bekannten Nummern Telefonanschlüssen zu. So würde sich nicht nur ein ganzheitliches Bild der Personen ergeben, mit denen Berger in den letzten Monaten Kontakt gehabt hatte, man könnte vielleicht sogar per Ausschlussverfahren Tanja ausfindig machen. Bislang war es nicht möglich gewesen, sie zu lokalisieren. Weder die Nummer, die sie von der Schule bekommen hatten, noch eine aktuellere, die Tanjas Vater durchgegeben hatte, waren noch auf sie angemeldet. Entweder hatte sie mittlerweile einen neuen Vertrag mit neuer Nummer oder ein Prepaid-Handy. Es schien so, als wollte sie nicht gefunden werden.
Franka stöhnte auf. Ulrike wusste, dass es eine nervenzehrende Arbeit war, die viel Geduld und Konzentration erforderte. »Kaffee?«, fragte sie, und Franka nickte erschöpft.
Ulrike stand von ihrem Stapel Papier auf. Man hatte bereits angefangen, Bergers Dokumente zu sortieren und sich einen Überblick zu verschaffen, womit er sich in den letzten, einsamen Monaten seines Lebens beschäftigt hatte. Der überwältigende Teil seiner beeindruckenden Sammlung war nichtssagend, Rechnungen lagen zwischen Kaufverträgen und Quittungen, Einkaufslisten und Zetteln, auf die Namen, Nummern, Skizzen oder kurze Notizen gekritzelt und die dann aus einem Spiralblock ausgerissen worden waren. Viele Briefe, in erster Linie Rechnungen, waren über Monate nicht geöffnet worden. Bislang schien alles bedeutungslos für die Ermittlung. All der Wust, die völlige Unwilligkeit, wichtige Papiere zu sortieren, und gleichzeitig seine Angewohnheit, jede noch so gewöhnliche Notiz aufzuheben, verfestigten in Ulrike die Vorstellung von Leonard Berger als einem Mann, der die Kontrolle über sein Leben verloren hatte und diesen Kontrollverlust beinah zur Schau stellte.
Das Horten von Papierkram schien ein Prozess gewesen zu sein, der sich in kurzer Zeit verschlimmert hatte. Anfangs hatte Berger die Sachen noch gelocht und in Ordner eingeheftet, auch da jedoch ohne Logik oder Organisation. Die beschrifteten Ordner quollen irgendwann über, und so gab er offenbar sein zweifelhaftes System auf und warf alles einfach so in die Kartons, die neben seinem Schreibtisch gestanden hatten.
Nachdem Ulrike mit zwei vollen Tassen Kaffee zurückgekehrt war und wieder an ihrem Platz saß, drehte sie einen karierten Zettel um, der achtlos aus einem Block ausgerissen war. Es war einer der Zettel, auf denen Leonard Berger mit dem Kugelschreiber herumgekritzelt hatte. Eine seltsame Zeichnung, wie manche sie anfertigten, während sie telefonierten oder gelangweilt herumsaßen – davon gab es zahllose.
»Zum Verrücktwerden«, sagte sie und hob den Zettel hoch, sodass Franka das Gekritzel betrachten konnte. »Was soll das sein, eine Fee oder eine Elfe?«
Franka schüttelte den Kopf. »Ich hab keine Ahnung.«
Ulrike musste ganz plötzlich an Anneliese Meier denken, eine Frau, die sie vor ein paar Jahren tot in ihrer Wohnung aufgefunden hatten. Die alte Dame hatte alles aufgehoben, was ihr zwischen die Finger gekommen war. Anders als bei den Messie-Haushalten, die man aus dem Fernsehen kannte, hatte ihr Chaos jedoch ein beeindruckendes System gehabt. Deckel von Flaschen lagen in einem riesigen Korb in der Küche, nach Farbe und Größe sortiert, Puppen im Wohnzimmer reihten sich akkurat an alte Kuscheltiere auf dem Sofa, Teller, Tassen, kaputte Elektrogeräte, Bücher, Hefte, Taschen und Kleidung, alles hatte seinen Platz, alles war aufgeräumt. Die Gänge, die durch die zugestellten Räume führten, waren schmal und von Zeitungsstapeln gesäumt.
Und zwischen all diesem Müll, all ihren Schätzen, saß Anneliese Meier in einem Schaukelstuhl, halb skelettiert, friedlich entschlafen, hinter den dicken Mauern ihrer dunklen Erdgeschosswohnung mitten im Universitätsviertel in Schwabing. Niemand hatte etwas geahnt, die Nachbarn hatten sie als freundliche ältere Dame wahrgenommen, und doch war keinem aufgefallen, dass sie plötzlich nicht mehr da war. Sammeln gegen die Einsamkeit, so hatte man es sich damals erklärt. Es machte Sinn, dass man sich vergrub, wenn man das Gefühl, allein zu sein, nicht mehr ertragen konnte.
Als Ulrike hier nun vor dem Papierchaos von Leonard Berger saß, kam es ihr hingegen plötzlich so vor, als hätte er sein Leben dokumentieren wollen. Als hätte er Zeugnis ablegen wollen, dass er existiert hatte, hier auf all diesen Zetteln. Vielleicht hatte auch Anneliese Meier gesammelt, um nicht in Vergessenheit zu geraten und um sich nicht selbst zu vergessen.
Zwischen all den Belanglosigkeiten fiel Ulrike plötzlich der mehrere Seiten lange, abgegriffene Kaufvertrag für den Hof in die Hände. Der Kauf war durch eine Immobilienverwaltung in Nürnberg abgewickelt worden, nachdem Berger online auf das Objekt aufmerksam geworden war. Den Namen des ehemaligen Besitzers von Nebeleck las Ulrike gerade das erste Mal. Sie stockte.
»Peter König«, murmelte sie. Dann tippte sie den Namen in die Suchmaschine ein. Es bedurfte keiner langen Recherche, um den in Schwanghaus lebenden Peter König ausfindig zu machen. Zahlreiche Zeitungsartikel mit seinem Namen ließen sich online finden. Peter König war der Arzt im Ort, hatte seit letztem Jahr einen Sitz im Gemeinderat und darüber hinaus offenbar eine ganz generelle Freude daran, sein Gesicht in eine Zeitungskamera zu halten. »Gemeinderat eröffnet lokale Fußballsaison«, war der Titel eines Artikels, den ein Foto Königs zierte. Er trug einen Janker, hatte dunkles, grau meliertes Haar, ein strahlendes Lächeln und grüne Augen. Ein nicht unattraktiver Mann um die fünfzig, der freundlich, engagiert und offenherzig wirkte.
Es war nicht unwahrscheinlich, dass Peter König mit Matthias König verwandt war, dem neugierigen Nachbarn mit dem renovierten Holzhaus im Drosselweg, der schon wegen der Schlägerei auf dem Stadtfest im letzten Jahr zu unrühmlicher Prominenz gelangt war. Eine weitere Recherche im Online-Telefonbuch bestätigte: In Schwanghaus gab es mehrere Königs. Ulrike kritzelte den Namen und die Adresse auf einen Block und blätterte ein weiteres Mal den Kaufvertrag durch, als ihr eine kleine Notiz ins Auge fiel. Das Wort »Gutachten«, mit einem Fragezeichen versehen, stand in einer unteren Ecke.
»Was hast du eben gesagt?«, fragte Franka Brandl plötzlich.
»Wann?«
»Eben. Da hast du einen Namen gesagt. König?«
»Peter König. Was ist mit ihm?«, fragte Ulrike.
»Berger hat ihn einige Male angerufen in den letzten Wochen. So wie es aussieht, vor allem nachts.«
Es war eine spontane Entscheidung gewesen, nach Schwanghaus zu fahren, das Gefühl, ihr würde die Zeit davonlaufen, ließ Ulrike nicht los. Sie hatten zu wenige Hinweise, zu wenige Spuren, zu wenige Ressourcen und viel zu wenig Personal. Es war jetzt zehn Uhr abends, und statt Müdigkeit verspürte Ulrike den Drang, irgendwie weiterzukommen, egal wie. Die Rastlosigkeit, die seit Beginn der Ermittlungen ihr ständiger Begleiter gewesen war, trieb sie auch dieses Mal unerbittlich an. Gleichzeitig war sie mittlerweile fest überzeugt, dass sie den Faden hier aufnehmen musste, hier in Schwanghaus.
Franka Brandl war nach Hause gefahren, und da Ulrike sich nach wie vor weigerte, die einstündige Fahrt nach Regensburg auf sich zu nehmen, um in ihre leere Wohnung zurückzukehren, sah es ohnehin nach einer Nacht im Auto oder auf der schwarzen Couch in Yusufs Büro aus. Sie hatte es nicht eilig, ins Bett zu kommen. Und so führte ihre nächtliche Spazierfahrt sie als Erstes zum Haus von Peter König, das sich in einem etwas abgelegeneren Ortsteil von Schwanghaus an einem bewaldeten Hang befand.
Als ihr Wagen davor zum Stehen kam, staunte sie nicht schlecht. Ein Neubaupalast baute sich in der Dunkelheit vor ihr auf. Gläserne Fronten, weiß verputzte Wände, ein gepflegter Vorgarten, gestutzte Buchsbäume. Irgendwo brannte noch Licht in dem gläsernen Gebäude. Durch die riesige Fensterfront im Erdgeschoss konnte Ulrike die Silhouette einer Frau erkennen, die sich langsam durch die Wohnung bewegte. Sie blieb für einige Augenblicke am Fenster stehen, dann drehte sie sich ruckartig um. Das Licht ging aus. Jetzt war es völlig dunkel.
Ulrike legte den Rückwärtsgang ein und fuhr über die Hangstraße zurück in den Ort. Hinter verschlossenen Gardinen brannte Licht, irgendwo wurde krachend ein Rollladen heruntergelassen. Es war totenstill, der Ortskern war wie ausgestorben. In Schrittgeschwindigkeit fuhr sie die Hauptstraße entlang und parkte schließlich auf dem bekiesten Hof des Gasthauses. Der Einfall kam plötzlich, völlig unvermittelt. »Zum Boschuoster« stand in riesigen Lettern über der Tür. Unter dem leuchtenden Gansbräu-Schild hing ein zweites, das leicht im Ostwind hin und her baumelte: »Zimmer frei«. Auch im Inneren brannte noch Licht.
Als sie ausstieg, hörte sie leise Musik und Stimmen. Hinter den bräunlich-grünen Bleiglasfenstern waren einige Gestalten auszumachen, die an der Bar am Tresen lehnten. Sie öffnete die Tür und trat in den verrauchten Gastraum. Zehn Gesichter drehten sich simultan zu ihr um. Aus den Lautsprechern tönte leiser akustischer Blues. »Wir haben schon geschlossen!«, rief ihr jemand schroff entgegen. Der blaue Zigarettennebel raubte ihr den Atem, und erst als sie sich durch den Rauch weiter zur Bar vorgearbeitet hatte, konnte sie die Gesichter der Männer erkennen, die sie schweigend beobachteten. Matthias König stand am äußersten Ende der Bar, eine Zigarette in der Hand. Peter König war auch mit von der Partie.
Ulrike stellte sich neben sie, winkte dem Barkeeper hinter dem Tresen zu und versuchte sich währenddessen ihre Nervosität nicht anmerken zu lassen. Sie zückte ihren Dienstausweis und hielt ihn gut sichtbar nach oben.
»Kripo Regensburg, Ulrike Kork. Auch wenn schon geschlossen ist, ich hätt gern ’nen Willi«, sagte sie. »Und das freie Zimmer.«
Als der Schnaps vor ihr stand, hob sie das Glas und nickte den immer noch schweigenden Männern zu. »Prost, die Herren.«
9
Als die ersten Sonnenstrahlen durch die halb geschlossenen Jalousien in das kleine Zimmer fielen, öffnete Ulrike die Augen. Sie brauchte einen Moment, um sich darüber klar zu werden, wo sie sich befand und was passiert war. Trotz der brettharten Matratze fühlte sie sich ausgeruht. Das erste Mal in drei Tagen hatte sie wieder in einem richtigen Bett geschlafen. Sie blickte auf ihr Handy. Es war sechs Uhr siebenundzwanzig. In drei Minuten hätte ihr Wecker geklingelt.
Sie öffnete eine Textnachricht ihrer Schwester, die vor wenigen Minuten abgesendet worden war: KANNST DU DICH MAL BITTE ENDLICH MELDEN?????? Sie sah Silke fast vor sich, wie sie ungehalten auf ihrem Handy herumtippte und den dunklen Lockenkopf verärgert schüttelte. Ulrike war fast versucht, die Nachricht zu löschen, stattdessen gab sie eine schnelle Antwort ein: Melde mich im Laufe der Woche, alles gut. Viel zu tun. Grüße. Nicht jetzt, nicht heute, dachte sie, legte das Gerät zurück auf den Nachtschrank, zog die Jalousien nach oben und öffnete das Fenster. Ein paar Autos rauschten in der Morgensonne durch das Dorf, auf der anderen Straßenseite sah sie einen älteren Herrn, der mit seinem Hund spazieren ging. Ulrike ließ sich zurück auf die Bettkante sinken und rieb sich den Schlaf aus den Augen.
Das Zimmer war klein, es hatte kaum fünfzehn Quadratmeter. Neben dem schmalen Bett, einem Nachtkästchen mit einer Bibel und einem Sessel stand noch ein etwas in die Jahre gekommener Schrank aus billigem Furnier in der Ecke. Es roch muffig, es musste Monate her sein, seit das letzte Mal jemand hier drin übernachtet hatte. Der Barkeeper mit den Ohrringen, der sich als Besitzer des Gasthauses herausgestellt hatte, hatte seine Schwester anrufen müssen, damit sie das Zimmer herrichtete. Wortlos hatte Ulrike dann beobachtet, wie die dicke Frau mit den blond gefärbten Haaren und dem dunkelbraunen Ansatz das Bett bezogen hatte. »Sie hain ja a Bscheid gem kinna«, hatte sie irgendwann in breitem Dialekt gebellt, während sie sich schnaufend vorlehnte, um die Matratze mit dem Spannbettlaken zu überziehen.
»Ja, das hätte ich natürlich«, hatte Ulrike kühl erwidert und sich im nächsten Moment schlagartig an etwas erinnert gefühlt, was Harry einmal zu ihr gesagt hatte, ihr zweiter Mann: »Du wirst irgendwann persönlich, Ulli. Das ist deine größte Schwäche als Polizistin.«
Ulrike hatte mit Harry zusammengearbeitet, er war ein Kollege, ein Mentor gewesen, und dann irgendwann mehr. Heute dachte Ulrike, dass sie wohl Bewunderung mit Zuneigung verwechselt hatte und Freundschaft mit Liebe. Die Ehe war zum Scheitern verurteilt, da hatte sie noch nicht einmal begonnen. Als sie nun an Harrys Worte dachte, wünschte sie sich, sie hätte es nie so weit kommen lassen. Vielleicht könnte sie ihn dann jetzt anrufen und ihn fragen, was er tun würde. Doch das war so oder so unmöglich.
Es war nicht das erste Mal, dass sie es vermisste, ihn nach seiner Meinung fragen zu können. Er kannte sie wie niemand sonst, und er hatte recht. Sie war persönlich geworden, nicht nur der Dicken mit den schlecht gefärbten Haaren, sondern dem ganzen Dorf gegenüber. Indem sie hierhergekommen war, hatte sie sich in einem Maße persönlich eingebracht, das man durchaus als unprofessionell bezeichnen konnte. Gleichzeitig war sie immer noch der festen Überzeugung, dass der Schritt gerechtfertigt gewesen war. Berger schien zwar ein Einzelgänger gewesen zu sein, doch er war dennoch im Dorf seltsam präsent, ein unbeliebter Außenseiter, zu dem jeder eine feste Meinung hatte. Ein Dorf, eine Gemeinschaft wie diese, hatte etwas Undurchdringbares. Nun war sie mittendrin, gleich hier im Gasthaus, im zentralen Nervensystem von Schwanghaus.
Ulrike ging über eine knarzende Holztreppe nach unten, sie hörte Musik aus dem Gastraum.
»Morgen«, begrüßte sie der Wirt mit den Ohrringen freundlich und lächelte sie an. Er hatte die Fenster geöffnet und war nun dabei, die Tische mit einem feuchten Lappen abzuwischen. »Ich war so frei«, sagte er dann und deutete auf einen Tisch in der Ecke, auf dem ein kleines Frühstück angerichtet war. Wurst, Käse, ein paar Essiggurken, ein kleines Plastikschälchen Honig, etwas Butter und drei Scheiben Graubrot. »Wie trinken Sie Ihren Kaffee?«
»Schwarz«, antwortete Ulrike geistesabwesend.
»Gut geschlafen?«, fragte er, nachdem er an den Tisch zurückgekehrt war, und füllte die weiße Tasse vor ihr aus einem Filterkaffeekännchen.
»Ja«, antwortete sie.
»Das freut mich. Hatten lang keinen Gast mehr hier im Zimmer.« Er lachte scheppernd. »Wenn Sie was brauchen, melden Sie sich«, fügte er dann hinzu und zog sich vom Tisch zurück. Wie er so sprach, gelang es Ulrike zum ersten Mal, den leichten Einschlag in seinem Dialekt zuzuordnen, der ihr in den letzten Tagen schon häufig aufgefallen war.
»Sie fränkeln hier auch alle ein bisschen, oder?«, rief sie ihm grinsend hinterher.
»Sagen Sie das mal nicht zu laut, Sie sind hier immer noch in der Oberpfalz«, gab er gespielt verärgert zurück und ging vor die Tür, um sich eine Kippe anzustecken.
Ulrike beobachtete ihn durch das geöffnete Fenster. Er hatte genau wie seine Schwester blond gefärbtes Haar, das etwas zu lang war und ihm struppig über die beringten Ohren hing, und trug ebenfalls einen beachtlichen Bauch vor sich her, der sich unter einem orangefarbenen T-Shirt mit weißem Aufdruck wölbte. Ulrike schätzte, dass er um die vierzig Jahre alt sein musste. Vor der Tür führte er immer wieder die Zigarette an die Lippen, über denen ein borstiger, leicht gelblich verfärbter Schnurrbart thronte. Er ging langsam auf und ab, bemerkte Ulrikes Blick, lächelte sie an und drehte sich wieder zurück, um erneut an der heruntergebrannten Zigarette zu ziehen, bevor er sie in dem kleinen Aschenbecher neben der Tür ausdrückte.