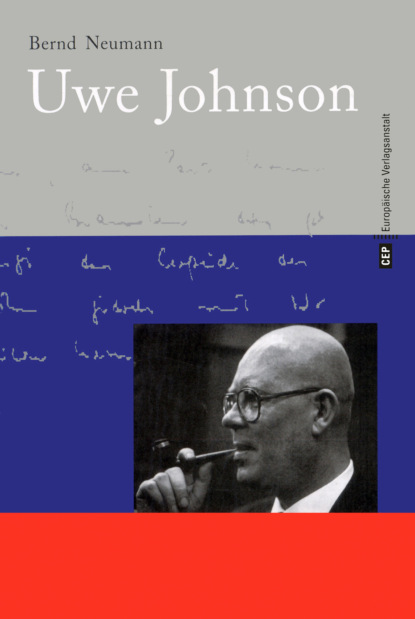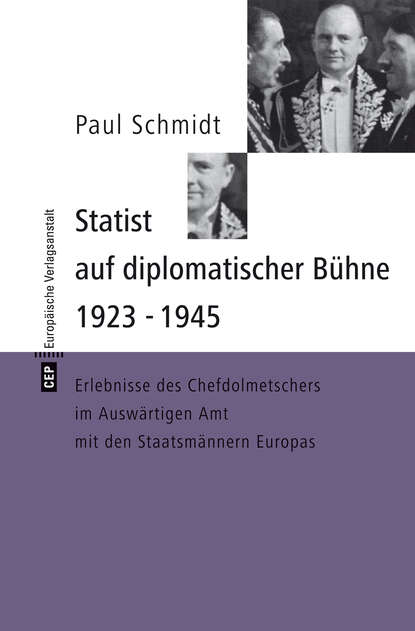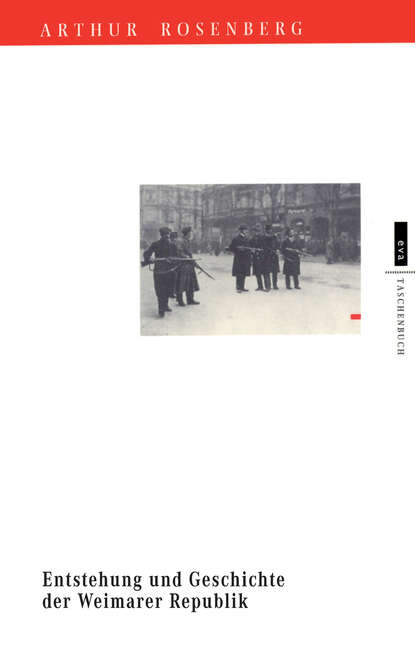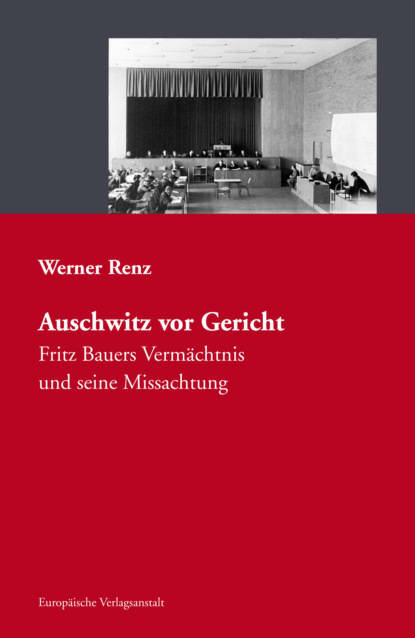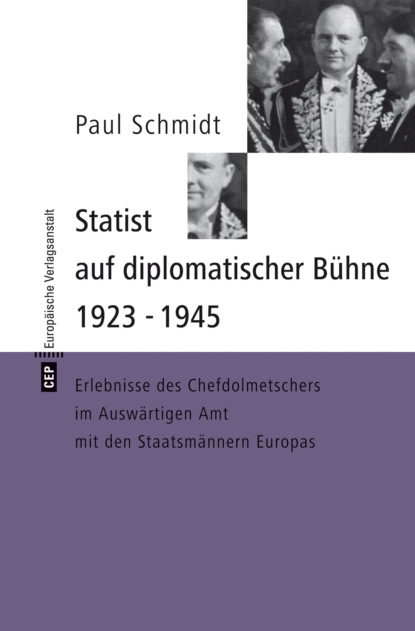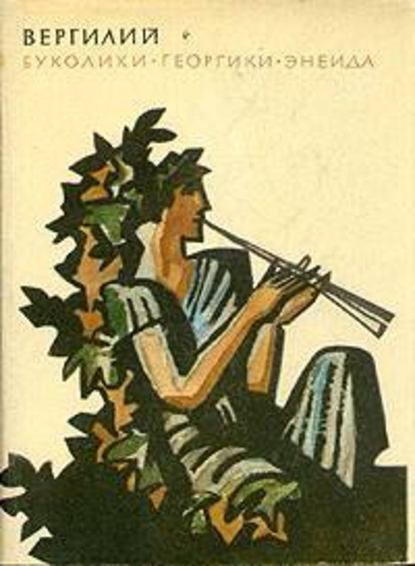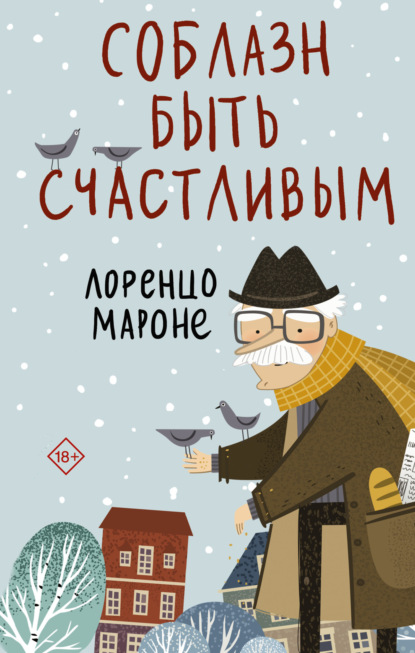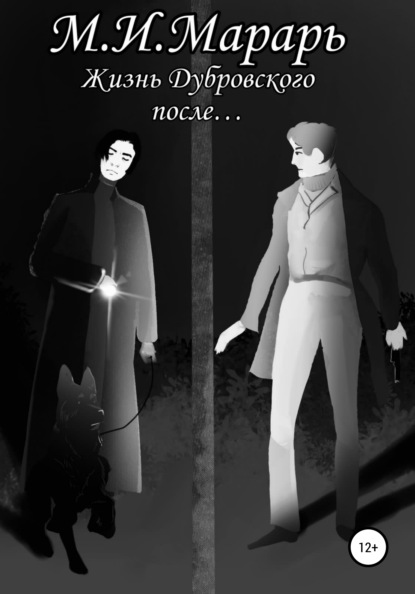- -
- 100%
- +
Wie Klaus und Ingrid in der Babendererde werden auch Johnson und das »Waldgesicht« ihre Flirtrituale gehabt haben:
Klaus liess sich vor dem Mädchen nieder auf seine Beine, und während er das Leinen verschnürte an Ingrids Füssen, waren seine Mienen die eines nachsichtigen aber ungeduldigen Vaters, der seiner jüngeren Tochter beim Anziehen hilft. Das Mädchen sah ihm zu mit schüchternen und ängstlichen Mundwinkeln, und als er die letzte Schleife verknotet hatte, sprach das Kind mit kindlichem Nicken und damenhaft obenhin: Danke. Wollen Sie mir, bitte, beim Aufstehn behilflich sein? [...] –
Ik hew all dacht du keemst nich: sagte das braune Gesicht vor ihm mit der herzstockenden Ingridschönheit; es ist unglaublich anzuhören wie sie das gesagt hat aus ihrer Kehle, diese Göre, dies Frauenzimmer, dessen Arme er um seine Schultern fühlte, dem er nun vorsichtig an den Augen entlangstrich mit seinem ungeschlachten Zeigefinger, dessen Kopf er in seiner Hand hielt, während der Wind seine Finger streichelte, mit diesen Haaren. (Babendererde, S. 40)
Ingrid Babendererde erweist sich als ein Schülerroman auch darin, daß das Buch wesentlich als ein Wunscherfüllungstext geschrieben wurde. Unverbrüchlich gehört Ingrid zu Klaus, wobei sich allerdings nicht Klaus, sondern Jürgen als die realbiographische Spielfigur des Autors erweist. Jürgen fungiert als der FDJ-Funktionär, der Johnson auch in Rostock am Anfang noch immer war.
Ein Tatbestand, der eine erhebliche Rolle spielte in beider Beziehung. Uwe Johnson zeigte dem »Waldgesicht« seine Werbung mit Blicken. Daneben wählte er die Form eher ungeschickter Tanzstunden-Höflichkeiten, wie das obligate In-den-Mantel-Helfen oder das Angebot gemeinsamer Arbeit fürs Studium. Nie aber konnten die beiden so intim zusammensein, wie Uwe Johnson sich das von Anfang an gewünscht haben muß. Was er in der Hinterhand-Skizze für die etwas spätere Leipziger Zeit aufgeschrieben hat, galt es bereits in Rostock? Der junge Intellektuelle mit dem Erfahrungshunger des Künstlers und mit seinen damals noch nicht wesentlich gebrochenen sozialistischen Aufbauhoffnungen stellte sich die Liebe nach dem bekannten bohemischen Künstler- und Studentenmuster vor. Das wiederum gestattete die »uneheliche Hochzeit« (so Johnson und Bierwisch in ihren Briefen aneinander) mit der Freundin nicht nur, es prämiierte sie geradezu. Hier mögen sich gar noch die Vorstellungen von den bolschewistischen Berufsrevolutionären des beginnenden 20. Jahrhunderts hineingemischt haben, denen die Ehe als eine politische Aufgabe und Sex als ein Schluck erfrischendes Wasser gegolten haben soll. Ein Vorstellungskomplex, der durchaus das Element von »Erziehung« der Frau durch den politisch bewußteren Mann enthält. Dagegen stand auf seiten des »Waldgesichts« eine ungebrochene »Bürgerlichkeit«. Diese Ingrid meinte, was sie sagte. Nicht zuletzt zelebriert die Ingrid der Babendererde beim Abschied von Klaus die genau entgegengesetzte Geste zu jener der Mrs. Hinterhand aus der Skizze. Beide Armbewegungen erscheinen an der bekannten Geste der Ottilie aus den Wahlverwandtschaften orientiert, die wiederum laut Walter Benjamin dem »sprachlosen Trieb« entspricht. Ingrid aber ist der verpflichtenden Sprache durchaus mächtig. Das »Waldgesicht« wußte, was es wollte. Hielt auch, was es sagte. Leider ging ihr Wille in eine ziemlich andere Richtung als der des Freundes Uwe Johnson.
Dessen Wissen imponierte dem »Waldgesicht«. Doch seine körperliche Nähe mochte sie eigentlich von Anfang an nicht. Der Student hat das lange nicht realisieren können. Nach Art von erotisch eher unsicheren Jünglingen schrieb der 19jährige auf einer Postkarte vom 12. Mai 1954 an den Schulfreund Heinz Lehmbäcker, der seine »feste Beziehung« bereits gefunden hatte:
Im Liegestuhl neben mir dehnt sich die Göre, arbeitet für Zwischenprüfung, schläfrig in Vormittagssonne, wird unaufhörlich braun, legt Buch weg, schläft einfach ein. Sonne scheint gewichtig; [...] Amselpaar macht Lärm, der ganzen Garten ausfüllt.
Das klingt verlockend-vielversprechend. Doch bereits am 6. Mai 1954 deutete sich die Zurückweisung an: »Auf dem Fensterbrett Kaktus, in Vase Blumen, dies geschenkt. – Kleines Mädchen hat Angst vor mir, sagt dazu Liebe, ganz verrückte.« Abneigung und Angst vor dem Unbekannten mögen sich die Waage gehalten haben. Noch im 1955 einsetzenden Briefwechsel zwischen Uwe Johnson und Manfred Bierwisch spielt die junge Frau eine Rolle. Bierwisch fragte den Freund schon einmal, ob das »Waldgesicht« denn nun »frei« sei, freilich ohne eine Antwort darauf zu erhalten. In ruhiger Überzeugtheit vom eigenen Aussehen blickte das »Waldgesicht« in diesen Rostocker und Leipziger Tagen in die Linse der Photographierenden. Johnson dagegen grimassierte noch immer bei solcher Gelegenheit. Das schöne »Waldgesicht« geriet für ihn immer mehr zu einer zweiten Ingeborg Holm. Den Tonio Kröger hatte Uwe Johnson zum damaligen Zeitpunkt schon längst für sich entdeckt; bereits 1951 war ihm der zu einem Anstoß für die Babendererde-Novelle geworden.
Zunächst einmal trug Uwe Johnson seinem »Deerie« mehr oder minder die Ehe an. Sprach jedenfalls ihr und ihrer Mutter gegenüber von möglicher Heirat. Diese »bürgerlichen« Pläne erschienen zumindest so konkret, daß er der Freundin schon einmal versichern konnte, sein Augenfehler würde sich nicht auf beider Kinder vererben. Auch gehörte die Freundin, neben einigen Schulfreunden und der Hochschullehrerin Hildegard Emmel, zu den wenigen, die damals wußten, daß Uwe Johnson schrieb. Sie erinnert sich:
Uwe hat in Rostock schon immer geschrieben, vorgelesen hat er erst in Leipzig. Er hat meines Erachtens von Anfang an seinen Weg als Schriftsteller klar vor sich gesehen. Ich habe eigentlich nicht daran teilgenommen, außer vielleicht insofern, als ich ihm menschliche Erlebnisse vermittelte.
Zurückhaltung bestimmte ihr Verhalten gegenüber dem jungen Dichter. Zur Attraktivität Johnsons indes trug in den Augen des »Waldgesichts« die Tatsache, daß er schrieb, nur wenig bei.
Dennoch gab Uwe Johnson nicht auf. Der pädagogische Geist sollte richten, wozu die Neigung von sich aus nicht in der Lage war. Der Student Johnson war damals noch daran gewöhnt, aus seiner FDJ-Funktion heraus in Kategorien der politischen Erziehung zu denken. In der Skizze eines Verunglückten schreibt er später:
Marxistisch gesonnenen Freunden an der Universität habe er folgen können in ihrer Theorie, auch in der moralischen, jedoch jeweils gezögert an dem Punkt, da sie KALININ zitierten: Die Ehe ist eine politische Aufgabe. (Skizze eines Verunglückten, S. 20 f.)
Ein Wort, das im Fortgang der Beziehung zwischen den beiden Rostocker Studenten gleichsam seine ironische Erfüllung finden sollte. Denn die nähere, von ihm als intensiver empfundene Bekanntschaft mit dem »Waldgesicht« machte Johnson im unmittelbaren Gefolge einer FDJ-Sitzung, die sich im zweiten Studienjahr, also im Herbst 1953, ereignet haben muß. Dabei ging es zunächst einmal zu wie bei jedem Skat- oder Schachverein. Posten mußten besetzt werden. Und ausgerechnet das »Waldgesicht« – sie war mit Sicherheit lediglich erschienen, um nicht aufzufallen – sollte zur Vorsitzenden der FDJ-Gruppe Germanistik an der Universität Rostock gemacht werden. Es entspann sich eine Diskussion, in deren Verlauf auch Uwe Johnson das Wort ergriff. Alle Einwände des »Waldgesichts«, wie man sie imaginieren kann: Zeitmangel; Unerfahrenheit; eine Frau auf diesem Posten, der einen ganzen Mann erforderte; mangelnde Lust und Eignung – nichts verfing.
Auch Uwe Johnson, der ihr sonst immer tanzstundenartig den Mantel hielt, argumentierte jetzt nicht mehr für sie. Sie sollte nun partout Vorsitzende werden. Das ging allein schon deshalb nicht, weil sie es ihrer Mutter nie würde mitteilen können. Der lange Dialektiker aus Güstrow aber sah ihrer Argumentationsnot ganz und gar ungerührt zu. Was mochte in ihm vorgehen? Hatte er doch die Stirn gehabt, ihre aus vorübergehendem Selbstzweifel geborene Bemerkung: Am besten sei es wohl, sie breche das Studium ab und werde Sekretärin, mit dem allzu nüchternen Bemerken zu kommentieren, daß er solches nicht ungern sähe? Das in die Enge getriebene, verwirrte »Waldgesicht« verfiel schließlich darauf, ganz einfach die Wahrheit zu sagen: »Dieses Amt ist mit meiner politischen Überzeugung nicht zu vereinbaren.« Im Anschluß an diesen Satz verließ sie den Raum. Das Schweigen der anderen muß in der Stille, die nach dem Zuschlagen der Tür einsetzte, sehr hörbar gewesen sein. Was tun? Man entschloß sich dazu, ausgerechnet den »Jugendfreund« Johnson zu ihrem Erzieher zu ernennen. Daß wiederum Uwe Johnson selbst sich zum »Erziehungsleiter« der unbotmäßigen Kommilitonin bestimmen ließ, mochte durchaus dem Schutz dieses Bürgerkindes dienen, das sich in den revolutionären Umbruchszeiten so gefährlich unberaten aufgeführt hatte.
Uwe Johnson hat seine Studenten-Liebe unmittelbar nach Schluß der Sitzung aufgesucht, sich für den Verlauf der Sitzung entschuldigt und ihr gleichzeitig eröffnet, durch welche Funktion er nun der Angebeteten auch organisatorisch verbunden sei. (In der Babendererde ist es Jürgen, der den Diskussionsstil der FDJ mißbilligt, ohne sich zugleich von der gesamten Organisation zu trennen. Der aber, notabene, auf Überzeugen statt auf Terrorisieren des Andersdenkenden setzt.) Mit diesem späten Besuch Johnsons an besagtem 12. November 1953 beginnt die engere Bekanntschaft zwischen den beiden. Danach ließ der zum »Erziehungsleiter« bestimmte Verehrer den erwähnten Armreif schmieden.
Im Sommer 1954, am Ende des 2. Studienjahrs und kurz vor beider Wechsel nach Leipzig, schrieb Uwe Johnson, jetzt Praktikant beim Reclam Verlag, dem »Waldgesicht« Briefe von dort. Beider Beziehung lief nun bereits auf ihr Ende zu. Bei aller Liebe und Fürsorge, bei allen Einfällen und aller literarischen Produktivität: Er ist ihr nie näher gekommen als bis zu jener Zone, die sein erstes Werk als das Gebiet der besonderen, verzichtbestimmten, heiter-resignativen Fern-Liebe zwischen Ingrid Babendererde und Jürgen Petersen beschreibt:
Auch war niemals Hoffnung gewesen in seiner Liebe und niemals Zuversicht; es genügte übrigens vollständig zu wissen dass er den Spiegel in der Tat nicht zerbrochen hatte. (Babendererde, S. 183)
Auch bei Uwe Johnson ging kein Spiegel in Scherben.
Sie waren sich einig in einem gutwilligen gleich wieder verleugneten Lächeln. [...] Ingrid hatte Lust Jürgen zu küssen. Ja warum: für sein angestrengtes Reden und Dahocken, für die Jürgensche schwierige Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit? Nein, für nichts und wieder nichts, eben überhaupt. Das lässt sich nun nur machen ohne Vorbereitung und Umstände, Jürgen aber sass sehr entfernt von ihr; so ungeschickt ist dieses Leben. Als sie aufsah, war es vorüber, dafür stand die leidig vernünftige Einsicht: besser blieb es für Jürgen bei dem Vorhandenen. (Babendererde, S. 107)
Früher Verzicht hat auf diese Weise eine früh vollendete Literatur hervorgebracht. Im Grunde wußte der Verliebte bereits am Anfang der Beziehung, daß nicht alle seine Träume in Erfüllung gehen würden. Nachdem er die Begehrte mit einer verlockend saftigen Birne verglichen hatte, fuhr Johnson in dem erwähnten Brief an Frau Luthe (30. August 1952) fort:
Das Komische daran ist, daß die Sache nach platonischem Vorbild begann und sinnlich konkrete Veränderungen dieser Entwicklungshöhe sich bisher nicht ergeben haben und sich auch nicht ergeben werden. Erfreulich und bedauerlich.
Bedauerlich vor allem. Denn der Verfasser dieser Zeilen wollte sich in der Realität noch immer nicht in den Verzicht finden. Johnson hätte, mit seiner »schwierigen Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit«, doch allzu gern der »leidig vernünftigen Einsicht« seiner Freundin abgeholfen. Jürgen indes vermag in der Babendererde auf Ingrids Liebe zu verzichten. Er hat sein Alter ego Klaus neben sich, dem er die Geliebte zusprechen kann. Der Johnson der Rostocker Studentenjahre aber stand allein. Für den Sommer 1954 wünschte er sich, was später erst der junge Schriftsteller als Erfüllungserlebnis in Marthas Ferien hat aufschreiben können: Wasserfahrt und – implizit – »uneheliche Hochzeit«. Johnsons Rostocker »Jugendliebe« orientierte sich zudem an Arne Mattssons frühem Film Sie tanzte nur einen Sommer, den der Student just in diesen Tagen gesehen hatte und den er für die »Geschichte einer Liebe, erzählt in [...] wunderbarer Reinheit und realistischer Echtheit« befand. (Brief an Frau Luthe)
Auf der Höhe ist euer Zelt versteckt in einer Lichtung inmitten verflochtenen Laubgesträuchs und Nadelholzes. Nur nach Osten ist eine Schneise offen, abgesenkt, aber der See muss ganz frei gewesen sein von Fischerbooten, und auf der Insel seid ihr allein. (Marthas Ferien, S. 45)
Das »Waldgesicht« hatte glatt »Nein« gesagt zum Alleinsein mit Uwe Johnson. Wollte statt der Wasserfahrt lieber ihre Verwandten in Kassel besuchen. Worauf in dem enttäuschten jungen Mann dann doch der »Erziehungsleiter« erwachte, der der Schutzbefohlenen erregt vorwarf, dem »kapitalistischen Westen« nachzulaufen. So entstand, im Sommer 1954, ein quälender Bruch, von dem sich ihre Beziehung nie wieder erholen sollte. Nach dem entscheidenden Gespräch machte der Student sein Fahrrad unendlich langsam fahrbereit. Keine Tür öffnete sich mehr. Das »Waldgesicht« reiste statt dessen ins Hessische ab. Uwe Johnson aber sandte ihr, die sich ihm solcherart entzog, statt sich von ihm erziehen zu lassen, ein Telegramm in den kapitalistischen Westen nach. Das lautete: »Sofort zurückkommen, gez. Uwe Johnson« – und erfüllte seine Wirkung schon deshalb nicht, weil die Mutter es ihrem Kind gar nicht erst aushändigte. »Das Hin und Her unserer Trennung muß auch ihn ziemlich zermürbt haben, und er sagte einmal: ›Mach das nicht wieder!‹« Wozu es allerdings keine Veranlassung mehr geben sollte. Die Liebesaffäre mit »Gertie«, dem »Waldgesicht«, erkaltete zunehmend in diesem Sommer 1954. Zwar ging man noch zusammen nach Leipzig. Hier aber lernte, und das ist eine andere, die nächste Geschichte, Uwe Johnson Elisabeth Schmidt kennen. Und das »Waldgesicht« wird, nachdem nunmehr Uwe sich getrennt hatte, unter seinen Freunden das »Asphaltgesicht« heißen.
Die Trennung war endgültig. Was noch zu erzählen bleibt, ist die damalige Rückwirkung auf die Konzeption der Ingrid Babendererde. Die Briefe zwischen Manfred Bierwisch und Uwe Johnson, deren erste 1955 gewechselt wurden, kreisen auch um die erotischen Erfüllungswünsche ihrer Verfasser. Ohne Antwort war des Freundes Bierwisch direkte Erkundigung vom 6. Juni 1955 geblieben: »Ist G. Deine Geliebte?« »Ossian« (so Johnsons studentischer Übername in Leipzig) erwog zu dieser Zeit bereits, spätestens aber im September 1955, seine Ingrid Babendererde – ertrinken zu lassen. Ein Gedanke übrigens, der angesichts der Andeutung über »Ossians« nunmehrigen erotischen Erfolg bei der Nachfolgerin des »Waldgesichts«, Elisabeth Schmidt, auftrat. Bierwisch erwarb sich Meriten um die deutsche Literatur, indem er den Freund von solch mörderischem Ende seines Romanerstlings per Postkarte vom 4. Oktober 1956 abbrachte. »Lass Ingrid nicht zugrunde gehen!« So kam es dann auch. Ingrid mußte ihrem Vater nicht ins nasse Grab nachfolgen. Ihr Tod, unmotiviert, wie er nur hätte ausfallen können, würde die Qualität des Buches ernsthaft beeinträchtigt haben.
Die Liebesgeschichte war beendet. Nicht aber die Geschichte ihrer Bekanntschaft, ein biographisches Nachspiel, das literarische Erlebnisgrundlage werden sollte: Das »Waldgesicht« reiste gern, und das nicht nur nach Kassel. Sie war, damals bereits, in Schweden gewesen und kannte auch einen in der DDR arbeitenden schwedischen Journalisten. Eines Tages bekam die junge Frau Besuch vom Staatssicherheitsdienst. Ein deutscher und ein russischer Mitarbeiter der »Firma« standen vor ihrer Tür. Die beiden erklärten: Das »Waldgesicht« solle Kommilitonen, daneben auch skandinavische Besucher bespitzeln, bekam dafür Reisemöglichkeiten in Aussicht gestellt. Von niemand anderem als dem »Waldgesicht« ist die Rede, wenn es heißt:
Eine Studentin erzählte von ihrer Arbeit auf der leipziger Messe und deren Folgen. Sie betreute einen skandinavischen Stand. Als die Nordleute abgereist waren, bekam sie Besuch von drei schweren, höflichen Herren, die sprachen Deutsch mit russischem Akzent und boten an: gutes Geld für brauchbare Nachrichten über Skandinavien. [...] was ihr Fall einlud, war die Erwägung, dass eine weniger resolute Person, eine ältere Frau zumal, auf der Stelle davon gelaufen wäre, nach Westberlin, über die Grenze, so rasch wie möglich. (Begleitumstände, S. 120)
Die Erfahrung des »Waldgesichtes« wurde zum Vorbild für das, was in den Mutmassungen dann der Flucht der Frau Abs vorausgehen wird. Später, beide wohnten bereits in Westberlin, sah man sich noch zuweilen. Johnson fragte, entspannt, seine ehemalige Wunschfreundin, ob sie denn glücklich sei. Der Kontakt zwischen dem Dichter, seit 1959 war er berühmt, und seiner ersten unerreichbaren Liebe riß auch später nicht ab. Uwe Johnson fragte den Architekten-Ehemann des »Waldgesichts« schon einmal, ob der nicht eifersüchtig sei – wozu indes dieser keinen Grund sehen konnte, wie auch immer regelmäßig man sich sah. Bei einer Einladung in die Westberliner Stierstraße, das muß dann schon nach 1962 gewesen sein, wurde das Ehepaar sogar Zeuge, wie Johnson einen seiner Geheimdienstanrufe empfing: Statt einer Stimme nur das Röcheln gespielten Erstickens in der Leitung. Bis wenige Jahre vor Johnsons Tod gaben die beiden ein treues Besucherpaar bei Johnsons Lesungen ab. 1978, nach dem Vortrag des Martha-Textes in Hannover, hat der Dichter seiner Jugendliebe eröffnet, daß er diesen Text lediglich geschrieben habe, weil sein Arzt ihm »etwas Leichtes verordnet« habe. 1980 dann, im Herbst, war das »Waldgesicht« erneut unter den Hörern, als Uwe Johnson aus der Skizze eines Verunglückten las. Sie hörte aus dem Text die Geschichte seiner Trennung von Elisabeth samt der Vermutung bezüglich einer geheimdienstlichen Verschwörung heraus. Daraufhin schrieb sie ihm einen Brief des Inhalts, daß ihr ehemaliger Freund auch sie bereits, ebenfalls nach der Trennung, solcher Konspiration verdächtigt habe. Sie könne ihm also nicht glauben. Der Brief kam ungebeten, und keinerlei Antwort erfolgte mehr.
POLITISIERUNG DER »BABENDERERDE«.
UWE JOHNSON IN OPPOSITION ZUR FDJ
In die Rostocker Zeit fiel Uwe Johnsons entschiedenster Akt in Sachen politische Opposition. Er selbst hat seinen Konflikt mit der Rostocker FDJ-Leitung als die Keimzelle der Babendererde bezeichnet. In den Begleitumständen heißt es, und die Rede geht vom Frühjahr, vom April oder Mai 1953:
So bekam jemand seine ureigene Sache, seinen persönlichen Handel mit der Republik, seinen Streit mit der Welt darüber, wann etwas eine Wahrheit ist und bis wann eine Wahrheit eine Bestrafung verdient. Da ihm verwehrt ist, dies öffentlich auszutragen, wird er es schriftlich tun. (Begleitumstände, S. 69)
Dies meint nichts anderes, als daß die uns heute bekannte, also die »politische« Fassung der Babendererde, aus diesem Konflikt erwachsen sei. Mancher hat daraus gefolgert, Johnson hätte erst jetzt zu schreiben begonnen, die DDR hätte ihn auf diese Weise »zum Schriftsteller gemacht«. Das ist so nicht richtig. Ein erstes Babendererde-Manuskript existierte, wie erwähnt, seit 1951, Johnson brachte es aus Güstrow nach Rostock mit.
Allerdings, und darauf zielen die zitierten Passagen aus den Begleitumständen:Erst der Protestakt des Studenten politisierte den Stoff. Nun erst entstand wohl auch der unbedingte Wille, dieses Buch gedruckt zu sehen. Jetzt sollte es ein Buch werden in der »Demokratischen Republik«, gedacht als Unterstützung einer Reform, von deren Notwendigkeit der Schüler zunehmend überzeugt gewesen sein muß. So intensiv hat Uwe Johnson noch im Rückblick seinen Protestakt erlebt, daß dieser ihm die eher »privaten« Anfänge seines Erstlings gänzlich überlagerte. Erst jetzt wurde die Babendererde zum literarisch eingelegten Einspruch des Güstrowers gegen die stalinistischen Verkrüppelungen der Demokratie, wie sie in der DDR der fünfziger Jahre auf der Tagesordnung standen.
In Ingrid Babendererde hat Johnson die Auseinandersetzung zwischen der »Freien Deutschen Jugend«, dem Staatsjugendverband der DDR, und der christlich ausgerichteten »Jungen Gemeinde« zur Basis seines Erzählens gemacht, angesiedelt im Jahr 1953. Der Erstling verfährt in dieser Hinsicht historisch »korrekt«. Im ersten Halbjahr 1953 nämlich erreichte der Kirchenkampf in der DDR seinen Höhepunkt. Und zwar ziemlich genau in jenen Monaten, in denen auch der Roman sich abspielt. Im April und Mai kam es zu einer größeren Zahl von Verhaftungen. Einige christliche Lehrer und Schüler wurden von den Schulen verwiesen, einzelne Angehörige der Studentengemeinden exmatrikuliert, mehrere christliche Heime unter Vorwänden geschlossen. In den Begleitumständen hat Johnson jenes Zeitungsblatt der »Jungen Welt« zitiert, das die »Junge Gemeinde« als »Tarnorganisation für Kriegshetze, Sabotage und Spionage im USA-Auftrag« entlarvt zu haben meinte. Der Zeitungsartikel setzte damals das öffentliche, staatlicherseits gewünschte Signal für eine spontan auch einsetzende Hatz auf die »Kugelkreuzler« (so benannt nach ihrem Symbol: der Weltkugel mit dem Kreuz darauf).
Im Rostock jener Jahre, so erinnert sich Pastor Traugott Holz, hatte immer noch die LDPD (Liberaldemokratische Partei Deutschlands) das Sagen. SED und FDJ richteten ihren Kampf weniger gegen die Blockparteien als gegen die Kirche. Vor allem galt ihr Kampf der »Jungen Gemeinde« als einer Konkurrenzorganisation. Am Anfang der Eigenstaatlichkeit der DDR bestanden noch problemlose Doppelmitgliedschaften. Nachdem freilich zu Beginn der fünfziger Jahre die FDJ-Uniform eingeführt worden war, griff eine immer schärfer artikulierte Militarisierung Platz. Sie wurde noch einmal durch den Auftrag der II. Parteikonferenz der SED von 1952 verstärkt, wonach man in der FDJ die »Kampfreserve« der Kader- und Staatspartei zu erblicken habe. Diese Umdefinition fiel also ins Abiturjahr des FDJ-Mitglieds Uwe Johnson. Insbesondere die Rostocker FDJ hatte verschärft seit den Weltjugendspielen in Berlin 1951 (zu denen auch Johnson in Berlin gewesen war, wobei ihn der Redner Stephan Hermlin in seinen Bann schlug) vom Beginn der fünfziger Jahre an Schwierigkeiten mit ihrer Rekrutierung. Seit dieser Zeit auch nahm die Rostocker FDJ die »Kugelkreuzler« offen ins Visier.
Die einzige Tatsache, die zählte und auf die es ankam, war die Entschiedenheit der Regierung, mit der »Jungen Gemeinde« eine vermeintliche Konkurrenz für die eigene Jugendorganisation abzuschaffen. Hier sprach noch einmal der Grosse Genosse Stalin. Seit Januar 1953 waren Pfarrer verhaftet und kirchliche Wohlfahrtseinrichtungen beschlagnahmt worden; nun hatte die Kampagne folgerichtig die Hochschulen erreicht. Den Arbeitern hatte man die Fahrpreisermässigungen per Dekret weggenommen; hier scheute die Regierung vor dem Weg, den sie sonst den administrativen zu nennen beliebte. Bei den Studenten sollte es demokratisch zugehen. (Begleitumstände, S. 63 f.)
In dieser Situation, im Mai des Jahres 1953, setzte die FDJ-Gruppe der Fachrichtung Germanistik an Rostocks Universität zum entscheidenden Schlag gegen die christliche Konkurrenz an. Anfang März 1953 war Stalin gestorben. Warnow- und Neptun-Werft erwiesen sich als zunehmend unruhig. Der Arbeiter- und Bauernaufstand des Juni 1953 bereitete sich vor. Am 28. April erklärte das Innenministerium der DDR die »Junge Gemeinde« zur »illegalen Organisation«. Als Folge dieser Kampagne wurden Hunderte von Oberschülern der Schule verwiesen und etwa fünfzig Pastoren und kirchliche Mitarbeiter verhaftet. Auch der Güstrower »Jugendfreund« Johnson war aufgefordert, das Seine beizutragen zur Sicherung der jungen demokratischen Republik.
Die Instruktion lautete, zusammengefasst, so: Du bist doch der Jugendfreund aus Güstrow. Du bist Org.-Leiter gewesen. Da weisst du ja Bescheid. Du meldest dich zu Wort. Du sprichst zunächst über den Kampf der »Jungen Gemeinde« gegen den Frieden, danach konkret über die drei evangelischen Banditen von der »Jungen Gemeinde«, die am vorigen Sonnabend einen Rekruten der Roten Armee mit einem Taschenmesser überfallen und schwer verletzt haben, in der Bahnhofstrasse von Güstrow.