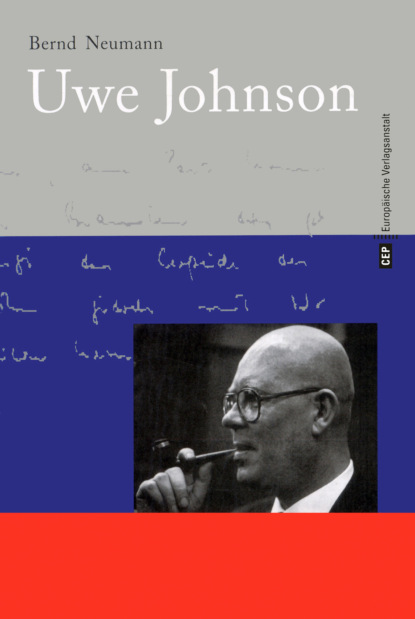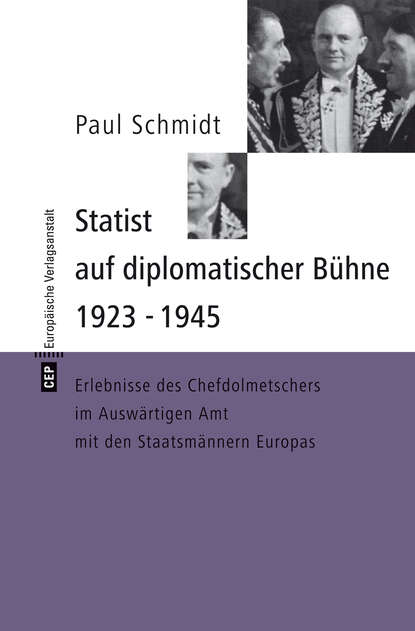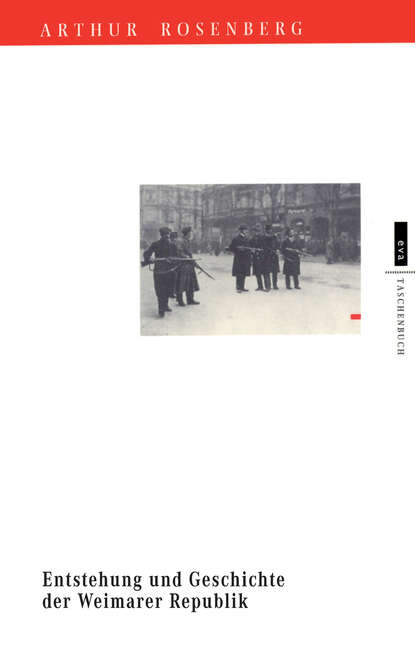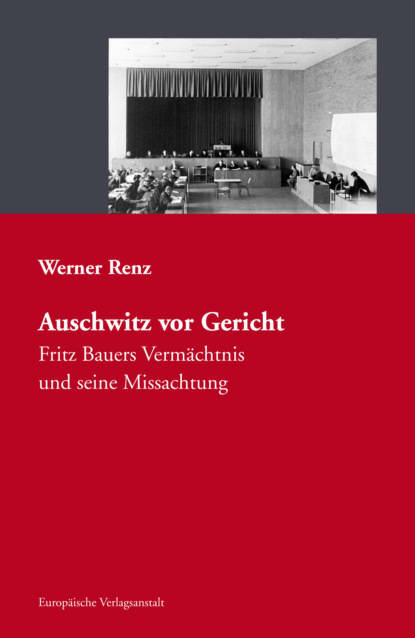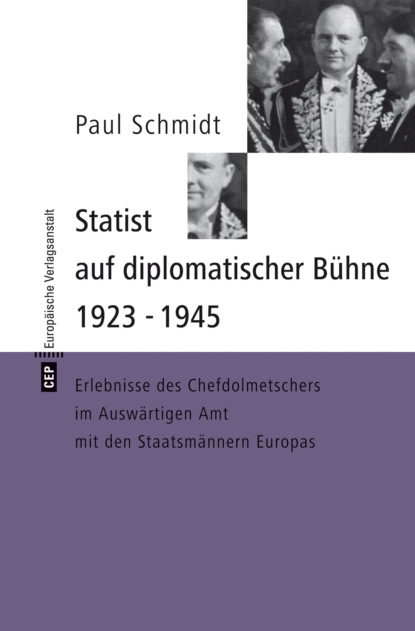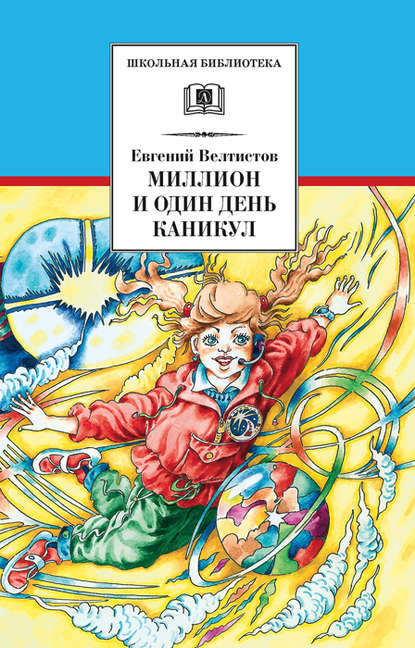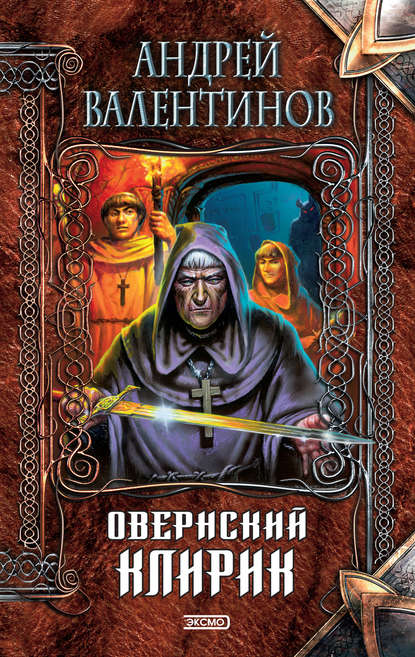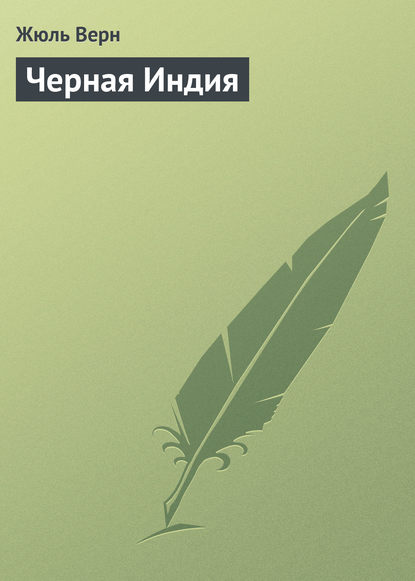- -
- 100%
- +
Der Jugendfreund aus Güstrow bestritt das. Wenn so etwas da vorgekommen sei, fünfzig Meter von der Wache der Volkspolizei, dann wüsste man das in Güstrow. Ihm wurde bedeutet, die Zeit des Funktionärs sei zu schade für fruchtlose Diskussionen. Als er weiterhin sich wehrte gegen den Auftrag, bekam er gesagt: Das ist ein Befehl. (Begleitumstände, S. 64)
Das alles, samt den Vorwürfen über die angebliche Mißhandlung Jugendlicher in christlichen Heimen; und die behaupteten Überfälle der Christen auf Andersdenkende kehrt in der Babendererde wieder – in Gestalt der Auseinandersetzung des FDJ-Präsidiums mit Peter Beetz:
Dann stritten sie: Ob es die Regel sei dass in christlichen Heimen Körperbehinderte misshandelt wurden, aber sie blieben uneinig. Und das Präsidium sagte: Die Junge Gemeinde lasse sich von den Amerikanern bezahlen für Sabotage und Spionage, und als Peter Beetz das nicht glauben wollte, sagten sie: Neulich sei ein Funktionär der Freien Deutschen Jugend nachts in der Eisenbahnstrasse von Angehörigen der Jungen Gemeinde mit Messern überfallen worden, das sei von einem amerikanischen Offizier so bestellt gewesen, und Peter Beetz sagte: Es sei nicht wahr. (Babendererde, S. 143)
Auch Uwe Johnson hatte gesagt: »Es ist nicht wahr.« In den FDJ-Leitungsbeschlüssen der Universität Rostock von 1953–1959 steht auf Seite 22, leider ohne genaueres Datum, jener Beschluß verzeichnet, der den Studenten Johnson als Befehl erreichen wird:
Die Studentengemeinde betrachteten sie als eine Organisation, als eine Zusammenfassung von Mitgliedern, die gegen den Aufbau des Sozialismus und gegen die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik auftreten. Die »Freunde« forderten, die Rädelsführer von der Universität zu entfernen und die Mitläufer von den verbrecherischen Machenschaften der Studentengemeinde [zu] überzeugen, um sie für unseren Verband [...] zu gewinnen.
Ein Beschluß, der auch für Johnson Dienstverpflichtungscharakter hatte. – Doch er verweigerte den Befehl. Führte vielmehr aus, was er selbst in den Begleitumständen dokumentiert hat:
Sodann stellte er seinen Auftrag dar, bis hin zum evangelischen Taschenmesser. Er erklärte sich für ausserstande, über irgend eine andere »Junge Gemeinde« zu reden als die ihm bekannte; das sei die in Güstrow. Im Gegensatz zu der Meinung des Vorredners sei das weder eine illegale noch überhaupt eine Organisation; ihr fehle eine Befehlsstruktur wie ein Mitgliedsbeitrag. Ihr Zeichen, das Kreuz auf dem Kreis der Erdkugel, diene lediglich der Erkennung, wie das Abzeichen für den Fünfjahresplan. [...] Von öffentlichen Überfällen sei in Güstrow nur der bekannt auf zwei Oberschüler, Angehörige der Jungen Gemeinde und mit eben dieser Begründung von der Schule verwiesen, in einer Vollversammlung. Zum Schluss kam der Jugendfreund aus Güstrow mit der Feststellung, die Hetze und die Schikanen gegen eine Religionsgemeinschaft konstituiere einen mehrfachen Bruch der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, ausgeführt durch die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik: Artikel 9 gewährleiste die Freiheit der Meinungsäusserung, Artikel 41 die Glaubensfreiheit und ungestörte Ausübung der Religion, und so fort bis zum Artikel 45. Wenn das eine Verschwörung sei, so wolle er, gerade als einstiger Org.-Leiter, da austreten. Kein Beifall. (Begleitumstände, S. 65 f.)
Nach der Erinnerung anwesender Kommilitonen fiel die Abrechnung Johnsons wesentlich harscher und pointierter aus. Der Protestant Uwe Johnson, Schüler einer ehemals evangelisch-reformatorischen Pflanzschule, riskierte Kopf und Kragen. Selbstverständlich wird er auch gewußt haben, daß zu seinen ca. 150 Zuhörern im restlos besetzten abendlichen Hörsaal 10 der Rostocker Alma mater auch das bürgerliche »Waldgesicht« gehörte. Wir sehen nun Tonio Kröger als einen Protestanten vor uns. Als einen rednerischen Täter, den Überwinder des Hamlet-Komplexes. Ein Teil der Zuhörer, darunter die Delinquenten und der, dem das rhetorische Henkeramt zugedacht war, der Student aus Güstrow, saßen erhöht auf der den halben Saal umlaufenden Galerie in antik-erhabener Umgebung: Szenen aus dem Parthenon schmücken noch heute die Wände. Das Rednerpult, an das der lange Blonde treten sollte, muß auch damals direkt rechts neben der Eingangstür gestanden haben. Wer durch den Eingang kommt, sieht sich sofort mit dem gesamten Auditorium konfrontiert.
Die Atmosphäre war äußerst gespannt. Die Kommilitonin Christa Trenschel, ein Studienjahr über Uwe Johnson und selbst kein Mitglied der »Jungen Gemeinde«, sah auffallend viele fremde Gesichter im Saal und konstatierte das coram publico, was große Unruhe bewirkte und zu einer Rüge der Sitzungsleitung führte. Die Fremden wurden den Studenten daraufhin als die »Freunde von der Kreisleitung« vorgestellt. Angeklagt waren mehrere Studentinnen, u. a. Renate Fründt und Ilse Rahnenführer, die beide später als Germanistinnen in Halle bzw. Rostock arbeiten würden. Sie saßen, roten Kopfes und deutlich verängstigt, gut sichtbar auf der Galerie. Die Sitzungsleitung wiederum, man erinnert das Aula-Tribunal in Ingrid Babendererde, saß an einem langen Extratisch vor dem Auditorium. Zügig ging die Leitung zur Sache über. Der als Ankläger Vorgesehene, Uwe Johnson, schritt zum Rednerplatz. Begann, langsam und gleichmäßig, mit leiser Stimme und aus gebeugter Haltung heraus sehr konzentriert zu sprechen. Die Unterarme schauten aus der Jacke wie fremd hervor. Wenn er den Kopf bewegte, funkelte die Brille. Die gutturale Stimme füllte den Raum vom ersten Wort an. Uwe Johnson äußerte sich nicht nur über die Verfassung der »Demokratischen Republik«, sondern berichtete, er wird es aufgreifen im letzten Band der Jahrestage, zusätzlich über die Praxis des Geheimdienstes an den Schulen; weiterhin, daß man auch ihn schon gezwungen habe, Beurteilungen und »Tatsachen« zu liefern, die dann teilweise bei der strafrechtlichen Verurteilung von Mitschülern Verwendung gefunden hätten. Uwe Johnson wies auf die im Hörsaal anwesenden einzelnen FDJ-Größen. Referierte, was sie ihm abverlangt hatten: Er sei dazu aufgefordert worden, heute abend, so wörtlich, »ein Schwein zu schlachten«. Der bäuerliche Hintergrund dieser stalinistischen Chargen war noch intakt. Im Saal herrschte lautlose Stille.
Auch nachdem der »Jugendfreund« aus Güstrow sein Werk verrichtet hatte, erhoben sich keinerlei Proteste oder Gegendarstellungen der Angegriffenen. Die Mehrheit der Zuhörer hielt Johnson, so ein anderer Zeuge des damaligen Auftritts, entweder für einen Selbstmörder oder für einen Narren. Johnson setzte sich wieder. Die Apparatschiks fingen sich rasch. Die Verurteilung der Mitglieder der »Jungen Gemeinde« kam am Ende im Sinn der gewünschten Geschäftsordnung und ganz »demokratisch« zustande. Lediglich fünf Stimmen ergaben sich gegen ihren Ausschluß. Eine davon war die Uwe Johnsons. Seine unmittelbare Umgebung bis hin zu seiner bürgerlichen Freundin wagte ihm diesen Entschluß nicht nachzutun. Schweigend verließ der Rotblonde mit den zu kurzen Ärmeln den Hörsaal 10. Ein Schriftsteller auf dem Weg zum Thema seines ersten Romans. Den Studenten der Philosophischen Fakultät galt er nach seinem Protest als ein Stigmatisierter, fand sich zunehmend isoliert. Der Beifall, den der Güstrower nicht erhielt, er hat ihn dann seiner Romanfigur Ingrid Babendererde zugeschrieben. Nach deren Protestauftritt in der Aula heißt es:
Sie betrachtete ohne Verständnis die gleichmässig aufruckenden Rükken, überall flackerten die aufspringenden klatschenden Hände; unter ihr der Fussboden bebte gefährlich von dem unaufhörlichen Trampeln. Und Söten klatschte, und Dicken Bormann klatschte, und Pummelchen klatschte, und Eva Mau klatschte, und Itsche klaschte, und Hannes klatschte, und Marianne schlug ihre Hände aufeinander in einer lauten Art, und unablässig klingelte der Wecker.
Als Ingrid auf dem Flur war, schlug die Stille über ihr zusammen wie ein anderer Regen von Lärm. (Babendererde, S. 175)
Über die möglichen politischen Veränderungen, die sein Auftritt bewirken konnte, wird Uwe Johnson sich kaum Illusionen gemacht haben. Obwohl der Protestauftritt einen politischen Akt dargestellt hatte, muß er doch zuallererst als existentielle Selbstbefreiung aus alten Verstrickungen gelten. Am wenigsten ging es dem Güstrower »Jugendfreund« dabei um die Kirche. Allein ihre in der Verfassung verbrieften Rechte sollten unversehrt bleiben. Nach seiner Rede galt für Uwe Johnson, was er in bezug auf die Ingrid-Figur schreiben wird: »Sie mag verhaftet sein. Vielleicht ist sie auch nicht verhaftet. Aber der Fragebogen ist ihr verdorben, jetzt hat sie einen Knoten in ihrem Lebenslauf, oh verflucht.« (ebd., S. 213) Daß auch der Kommilitone aus Güstrow einen Knoten in seinem Lebenslauf hatte, wußten im Frühjahr 1953 an Rostocks Universität alle ganz schnell. Gerüchte entstanden. Er sei bereits verhaftet, denn er kam nicht mehr regelmäßig zu den Lehrveranstaltungen. Andere wollten wissen, er sei von der Stasi »umgedreht« worden. Wie anders könne er sonst weiterhin frei umhergehen? Im Mai, so hat Johnson es selbst beschrieben, wurde er dann in die Partei-Zentrale bestellt, wo man ihn zweimal verhörte. Er hatte die Mitgliedsbücher für die FDJ und für die Deutsch-Sowjetische Freundschaftsgesellschaft mitzubringen – »auffälliger Weise keine Zahnbürste. Offenbar sollte es demokratisch zugehen«.
Die Anklagen lauteten auf: Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen und Organisationen. Diversion. Bündnis mit dem Klassenfeind. Agitation gegen den Fünfjahresplan. Missbrauch der Geschichtswissenschaften. Bruch der Befehlsdisziplin. Ausführung eines Agentenauftrags. Verächtlichmachung der demokratischen Presse. Provokatorisches Austreten. (Begleitumstände, S. 66)
»Ausgetreten« aber war Johnson nicht. Lediglich provokatorisch aufgetreten mit der Behauptung, er wolle austreten – ein nicht unerheblicher Unterschied. Am Ende wurde der Güstrower »Jugendfreund« exmatrikuliert. Erhielt Studienverbot für das Gebiet der »Demokratischen Republik«.
Die politische Entwicklung innerhalb der DDR erwies sich jedoch als vorteilhaft für Uwe Johnson: Die Streichung wurde ihrerseits gestrichen. Die SED sah ein, daß sie sich in diesem Kirchenkampf übernommen hatte. Auf den 10. Juni 1953 fiel die erneute Anerkennung der »Jungen Gemeinde« durch das Innenministerium, vollzogen vom Ministerpräsidenten Grotewohl. Stalin war tot. Berija würde ihm bald folgen. Und niemand wußte so recht, wie es weitergehen würde. Die Regierung versuchte eine Frontbegradigung. Schloß ihren Frieden mit der Kirche und ließ auf diese Weise auch wieder den exmatrikulierten Johnson zum Studium zu.
Die Regierung bedauert ihre Massnahmen. [...] Alle Schüler, die wegen ihrer Zugehörigkeit zur Jungen Gemeinde von den Oberschulen gewiesen wurden, müssen wieder aufgenommen werden. Wegen Eintretens für solche Schüler entlassene Lehrer dürfen ihre Tätigkeit wieder aufnehmen. (Begleitumstände, S. 67)
Johnson war, als man ihm die Streichung der Streichung eröffnete, bereits entschlossen, an die Universität Leipzig zu gehen. Auch wird er aufschreiben, worüber er in Rostock nicht mehr reden konnte. So konsequent wie subtil unterstand der angehende Schriftsteller dabei dem Denken jenes Literaturtheoretikers, der Literatur stets als gesellschaftliche Veranstaltung begriffen hatte: Walter Benjamin.
So wird er zum Lehrling in diesem Beruf, den er sich selber beizubringen hat. Flugs erfindet er für sich noch einmal Walter Benjamins IV. These über die Technik des Schriftstellers:
Meide beliebiges Handwerkszeug. Pedantisches Beharren bei gewissen Papieren, Federn, Tinten ist von Nutzen. Nicht Luxus, aber Fülle dieser Utensilien ist unerlässlich. (Begleitumstände, S. 69)
Johnson begann die Babendererde in der postum veröffentlichten Form zu verfassen.
HILDEGARD EMMEL – ERSTE LESERIN DER »BABENDERERDE«
Hildegard Emmel, Anfang der vierziger Jahre universitäre Lehrkraft, spätere Professorin für Deutsche Literatur, war die erste »berufene« Leserin der Ingrid Babendererde. Sie stand damals am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere, die in Rostock begann und die sie über Oslo, Ankara und die USA in die Schweiz führen würde. Das erste persönliche Zusammentreffen datiert auf das Jahr 1953, genauer auf einen Montagabend im September. Im Anschluß an Hildegard Emmels Spezialseminar Goethe als Rezensent findet sich der Student Johnson, es ist kurz nach acht Uhr abends, vor dem »Professoren-Zimmer« des Rostocker Germanistik-Seminars ein. Linkisch, aber auch bestimmt und mit bemüht tadellosen Formen, in merkwürdig immergleichem Rhythmus sprechend, steht ein sehr junger Dichter vor einer wenig älteren Literatur-Lehrerin:
Es war einmal ein 19jähriger Student. Er hatte eine Novelle geschrieben. Diese Novelle musste mit der Schreibmaschine geschrieben werden und zu diesem Zweck musste sie in eine andere Stadt geschickt werden.
Es handelte sich um einen schreibmaschinegeschriebenen Text, offenbar in Güstrow abgetippt, der dreißig bis vierzig Seiten umfaßte.
Der Student wünschte sich, von der Lehrkraft als Autor entdeckt, »erkannt« zu werden. Johnson drang geradezu auf die Beurteilung des Textes durch Hildegard Emmel: Wenige Wochen später erschien er, das Urteil einzufordern. Die erklärte, es sei unmöglich, zu sagen, ob aus dem Autor dieser Novelle einmal ein bedeutender Schriftsteller werden könnte, mochte dies andererseits aber auch nicht ausschließen. Johnson mag dennoch nicht unzufrieden gewesen sein. Zielte sein Interesse doch, wie von Hildegard Emmel selbst angenommen, in gleichem Maße auf die Person der Lehrerin wie auf deren literarische Beurteilung. Zudem muß Uwe Johnson damals ein weiteres literaturwissenschaftliches Arbeiten als mögliche Berufsperspektive erwogen haben. Hier konnte die Dozentin ihm womöglich hilfreich sein.
Johnson legte die Zwischenprüfung bei Hildegard Emmel ab. Vor die freie Figurenwahl in Goethes Wilhelm Meister gestellt, entschied er sich bei dieser Gelegenheit für die »schöne Seele«, das Fräulein von Klettenberg. Ganze Passagen der Wahlverwandtschaften wußte er auswendig herzusagen. Auf die Vorbereitung zu dieser Prüfung geht denn auch seine habituelle Vertrautheit mit dem Goetheschen Text zurück, dessen Ottilie er mehrfach noch in seinem späteren Werk herbeizitieren wird. Auch mit Eduard Mörikes Texten, dessen Orplid-Lied die Mutmassungen anklingen lassen, wurde der Student womöglich bei Hildegard Emmel bekannt, die sich im Rahmen einer Lehrveranstaltung mit dem schwäbischen Dichter beschäftigt hatte. Nach abgelegtem Examen in Leipzig, 1956 dann, hat Uwe Johnson die Lehrerin eindringlich und durchaus in der Hoffnung auf eine Zusammenarbeit nach den Möglichkeiten einer Assistenz befragt. Doch Hildegard Emmel hatte sich bereits für einen anderen Kandidaten entschieden. Der Leipziger Praktikant und Student Johnson hatte seiner Professorin im Sommer und Herbst 1954 eine Flut persönlicher Briefe geschrieben. Hildegard Emmel sah diese Briefe als Liebesbriefe an und ließ sie unbeantwortet, hat sie später in einem Akt der Diskretion vernichtet. Beachtlich erscheint immerhin, daß seine Beziehung zum »Waldgesicht« den Studenten keineswegs daran hinderte, diese Briefe zu verfassen. Solche gelegentliche bohemienhafte Lockerkeit ist bemerkenswert an einem Mann, der später die Ausschließlichkeit der Zweierbeziehung in geradezu fundamentalistischer Unbedingtheit proklamieren sollte.
Hildegard Emmel und Uwe Johnson sind einander später nicht mehr begegnet. Zwar nahm Uwe Johnson in den Jahren 1967/68, als beide sich zufällig in den USA aufhielten, den Kontakt wieder auf. Ein Treffen scheiterte jedoch an der allzu zeitraubenden Postzustellung. Hildegard Emmel meint mit Bestimmtheit, daß Johnson in Rostock von der Staatssicherheit überwacht wurde. Beide seien sie bei ihren Spaziergängen in der Nähe der Rostocker Universität von der »Firma« beobachtet worden. Außerdem saßen, wie bereits erwähnt, auch im Germanistik-Seminar zwei, die man der Spitzeltätigkeit verdächtigte. In diesem Sinn erweisen sich »Mesewinkel« und »Fabian«, so nennt sich der Hauptmann des SSD Rohlfs in den Mutmassungen zuweilen, als Rostocker Autochthone.
DER STUDENT ALS MARXIST.
ZWISCHENPRÜFUNG IN LEIPZIG
Auch die zweite Zwischenprüfung vom 21. September 1954, der Student stand unmittelbar vor seinem Wechsel nach Leipzig, wurde mit Bravour bewältigt. Johnson schloß sein zweites Studienjahr mit einem »Sehr Gut« in fast allen Fächern ab. Lediglich was die Hpt.-Probleme der dtsch. Wortbildungs- und Satzlehre betraf, reichte es nur zum »Gut«.
Im letzten Rostocker Semester hatte der Kommilitone Johnson eine Seminargruppe ausgerechnet zu Stalins Text Neue Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR geleitet. Am 15. April 1954 schließlich schrieb er seine – erhaltene und in Entwöhnung von einem Arbeitsplatz publizierte – Zwischenprüfungs-Klausur in Marxismus-Leninismus: Wesen und Funktionen des Staates in der Periode des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus.
Diese Klausur liegt, und das ist wert, bedacht zu werden, zeitlich nach Johnsons spektakulärem Auftritt anläßlich der Verfolgung von Mitgliedern der »Jungen Gemeinde«. Allenfalls indirekt ist der dabei markierte Bruch. Der Student spielte vielmehr »business as usual«. Ging mit hoher interpretatorischer Intelligenz seinen Gegenstand an. Und sprachlich, in der Souveränität der teilweise exquisiten Formulierungen, auf beinahe schon schriftstellerischem Niveau. Hier schrieb einer, dessen ideologische Linie, gemessen an der rechten Lehre der damaligen DDR, fast als »linksradikal« begriffen werden könnte. Johnson forderte nämlich, und das galt seit dem Stalinschen »Sieg des Sozialismus in einem Land« als große Trotzkistische Abweichung, die Internationalität der Revolution. Zudem die Bewaffnung des ganzen Volkes, die utopisch gedachte Überführung des Staates in einen Verwalter bloß noch von Sachen und Produktionsprozessen. Johnsons Konzept in dieser Klausur zielte, so scheint es, auf alles andere als die Einführung des Sozialismus auf Filzsohlen ab, wie sie seit dem 17. Juni von der verunsicherten Führung der DDR propagiert wurde. Hier schrieb bereits der Autor der Babendererde, der die Republik verbessern wollte.
Auch wenn sich der Student am Ende salvatorisch auf den Realpolitiker Lenin beruft, so erscheint sein Konzept doch als eines, das wesentlich utopisch-sozialistisch ausgerichtet war. (Johnsons Kritik des »Revisionismus«, man kann diese so auch bei Brecht finden, mit eingeschlossen.) Der »marxistische« Student Johnson kritisierte im übrigen die Bürokratie in der Sprache des jungen Marx, der sich ja noch an junghegelianischer Religionskritik orientierte. So, wenn er die »isolierte Heiligkeit« der Bürokratie als »Scheinheiligkeit« und weiterhin durch die Feststellung entlarvte, daß der »Verwaltungsaufwand in seinen Löhnen das Niveau der Produktionsarbeit« durchaus überschreiten würde. Schließlich gipfelt die Kritik des Staates als eines bürokratischen Leviathan in der Utopie vom menschlichen Staat, der darin, daß er nur noch Produktionsprozesse und Sachen verwalte, zum überhaupt ersten Mal in der Geschichte den Namen »Gemeinwesen« sich verdienen könne.
Damit nicht genug. Zum ersten Mal unternimmt der Schriftsteller als Student es auch, das als »Parteilichkeit« Geforderte zu konterkarieren. Daß Johnson sich in diesen Jahren seine Spielart sozialistischer Utopie bewahrt hatte (im kommenden Semester würde er Ernst Bloch hören), bedeutete keinesfalls, daß er im selben Maße noch Verständnis für die »Kulturförderung« seines Staates gehabt hätte. Die DDR-spezifische Existenz des »Amtes für Literatur« wird nicht toleriert. Mit sprachlicher List artikuliert der Prüfling Widerspruch, schlitzohrig prägt er die Formel vom Preis des »über das ganze Land verzweigten sensiblen und zähen Verwaltungsmechanismus«, die am Ende denn auch ein Fragezeichen des Korrektors provoziert. Johnson schreibt von »kulturell-erzieherischer Funktion«. Diese »hat sich zu beschäftigen mit bourgeoisen Rückständen an Individualismus und Begriffsstutzigkeit sowie mit der Angleichung des Bewusstseins an sozialistische Verhältnisse«. Ein Opfer solcher »Angleichung« war er durch die »Junge Gemeinde«-Affäre selbst bereits geworden. Dort wie in der Klausur hatte er öffentlich gemacht, was die im verborgenen arbeitende Anpassung forderte.
Der Beifall, der den Studenten für seine Arbeit erwartete, erwies sich als pflichtgemäße Anerkennung bewiesener Belesenheit. Bemängelt wurde vom Marxismus-Lehrer Scheithauer am Schluß der Arbeit, daß »praktische Beispiele aus SU und DDR« fehlten. Die Klausur wurde dennoch mit »1–2« bewertet.
Diese Entwicklung ist um so beachtlicher, wenn man bedenkt, daß Uwe Johnson als ein doch recht überzeugter FDJ-Funktionär nach Rostock gekommen war. Jetzt steht er als leicht donquichottesker Herold der Umgestaltung vor uns. Noch immer charakterisiert durch sein rotblondes, abstehendes Haar, sein schüchtern-hölzernes Auftreten und den leichten Silberblick hinter Billigbrillen, die bei Regen schon einmal Rostspuren im Gesicht hinterließen, gekleidet in Jacketts, deren Ärmel auf halber Unterarmlänge auszulaufen pflegten, ist er den Rostocker Kommilitoninnen, neben dem »Waldgesicht« auch Christa Trenschel und Getrude Harlaß, durchaus im Gedächtnis geblieben. Ein wenig ansprechendes Äußeres sollte kompensiert werden durch betonte geistige Überlegenheit. Momente gleichsam der Epiphanie schienen sich ereignet zu haben: wenn dieser junge Mann in den Lehrveranstaltungen das Wort ergriff – mit rhetorischer Brillanz und der Ironie englischen Understatements ausgestattet.
Stets sei von ihm, erinnert sich das »Waldgesicht«, die »vollkommene Antwort« zu erwarten gewesen. Was übrigens auch für die sprachwissenschaftlichen Disziplinen galt. Johnson sprach allerdings erst, wenn andere offenbar nichts mehr zu sagen wußten, und dann oft erst auf Aufforderung des Dozenten. Ein Primus also ohne die Allüren eines solchen. In just diesem Herbstsemester 1953 hielt in Rostock Professor Sielaff in den Hörsälen 1 und 12 seine Vorlesung Literatur des demokratischen Deutschland Vier Stunden wöchentlich. Sich an sein Auditorium wendend, in dem sich auch Johnson und seine Freundin befanden, fragte Professor Sielaff einmal nach der Meinung seiner Hörer. Große Stille. Dann die gaumige Stimme des Güstrowers, die nichts als einen Namen sagte: »Pablo Neruda«. Was meinte dieser Student damit? Sielaff galt als Genosse. Seine Ausführungen, schon deren Titel weist daraufhin, müssen den Geist der Linientreue geatmet haben. Der Spanisch Schreibende hatte gewiß wenig verloren in einer Vorlesung zur Literatur des demokratischen Deutschland Doch hatte er das entscheidende Problem gelöst, das für Johnson die gesamten Ausführungen des Professors überschattet haben mußte: das Dilemma nämlich, wie man poetisch schreiben und dennoch ein guter Kommunist sein konnte. Der Autor der Babendererde mag sich daher selber als einer verstanden haben, der sich als Ziel die Synthese aus Politik und Poesie gesetzt hat. Seine lakonische Opposition indes ging noch einher mit eher einverstandenen Elementen. Denn im Vorjahr 1952 hatte Neruda in seine chilenische Heimat heimkehren können, was man in der DDR durchaus gewürdigt hatte.
Wie auch immer: Johnsons Antwort war geeignet, Aufmerksamkeit auf den Sprecher zu ziehen. Ähnliches galt auch andernorts. So für die Anwesenheit Johnsons auf Universitätspartys, zu denen die Lehrkräfte den offenbar ebenso begabten wie merkwürdigen Studenten einluden. Auch im englischen Konversationskurs hatte er Aufmerksamkeit erweckt, indem er einmal den Hamlet-Monolog »losließ«. Der Erinnerung einer Kommilitonin zufolge sprach Johnson laut und artikuliert, ohne akustische Deckung hinter verschliffener Aussprache zu suchen.
Auf einer Party bei Vietinghoff spielte der lange Blonde dann durch, wie sich einer verhalten müßte, der wie sein Schulfreund Lehmbäcker und später wie Rohlfs in den Mutmassungen ein steifes Bein hatte. Uwe Johnson hinkte den gesamten Abend und gab, befragt, an, er wolle in Erfahrung bringen, wie sich das Leben für einen mit steifem Bein gestalte. Tagelang ging Johnson danach hinkend durch das akademische Revier in Rostock. Im Bewußtsein der Rostocker Mitstudenten damals als einer, der
regelmässig Verabredungen im ehemaligen ›Volkshaus‹ [hat] schräg gegenüber der Universität, am Stalinplatz, da residiert der Staatssicherheitsdienst und führt Buch über die Äusserungen der Studenten. (Begleitumstände, S. 71)