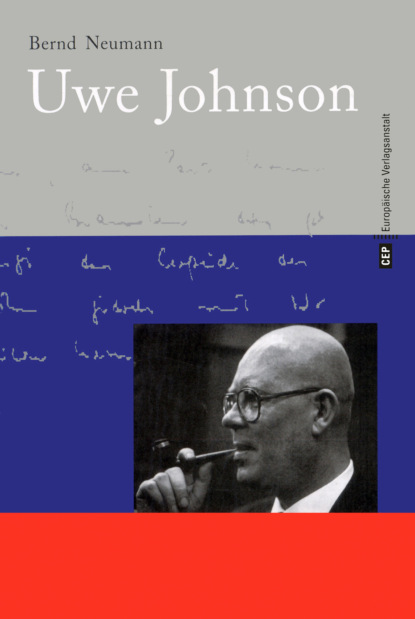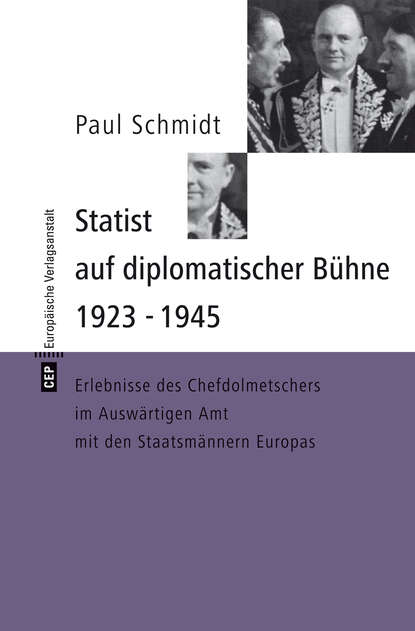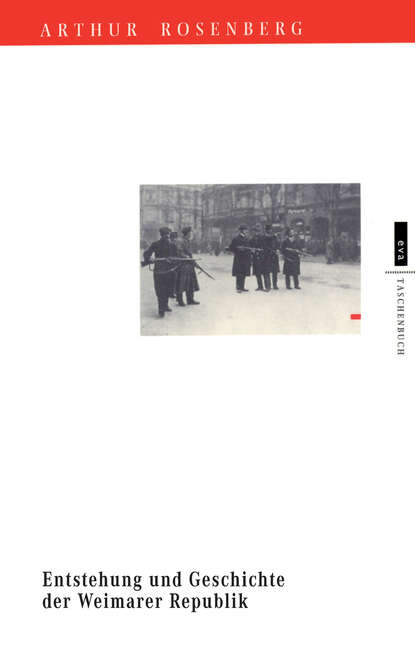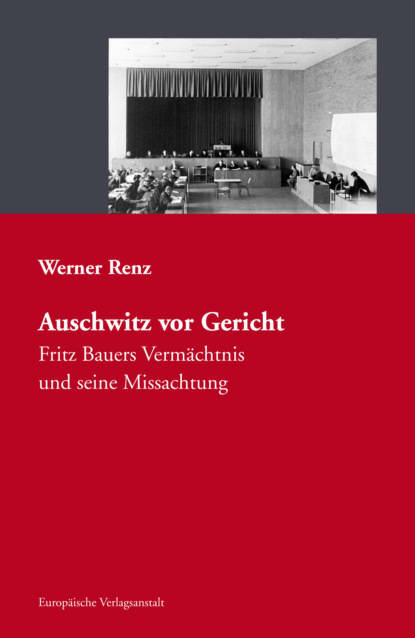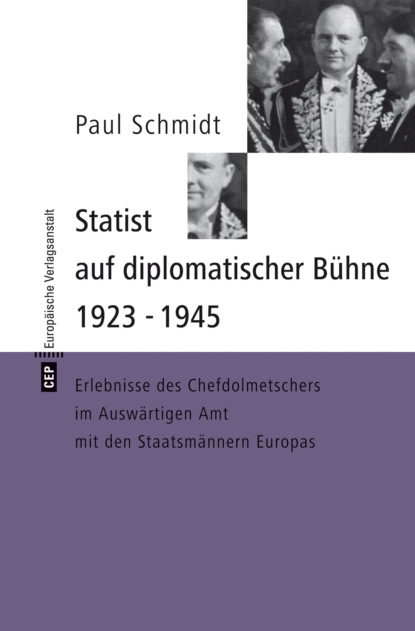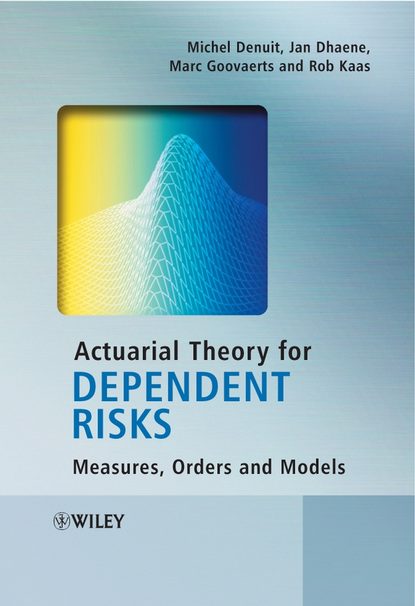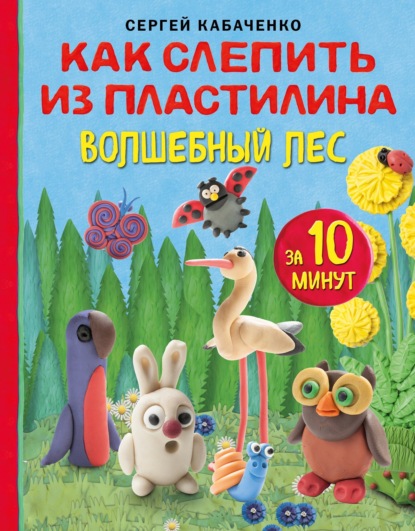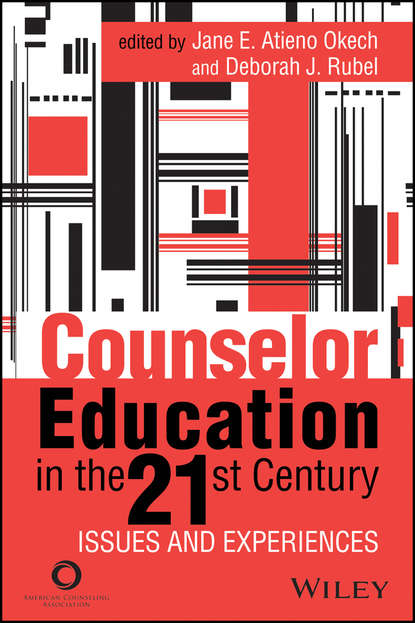- -
- 100%
- +
Erna Johnson steht als eine untersetzte blonde Frau vor uns, mit äußerst bestimmtem, dominantem Blick. Gab sie eine jener »atemlosen Gebärerinnen« (Drittes Buch) ab, die ihren »Führer« verehrten – und die andererseits doch eher an sozialem Aufstieg als an wirklich politischem Engagement interessiert waren? Ihr Mann mochte ihr von der Ausbildung und vom Sozialprestige her überlegen gewesen sein. Sie versorgte ja ausschließlich den Haushalt. Andererseits war sie fast ein Jahrzehnt jünger als er und immerhin ein Kind von Leuten, die einen eigenen Bauernhof besaßen. Dieser Besitz mag Erna Johnson zu Selbstbewußtsein verholfen haben gegenüber ihrem Mann. Um so mehr wuchs das freundliche und stille Kind Uwe auf die Mutter bezogen auf, zudem der Vater viel unterwegs war in Ausübung seines Berufes, der ein Herumreisen in den Molkereien des Bezirks erforderte. »Von seiner Herkunft, seinen Eltern sprach er kaum – mein Eindruck war ein gestörtes Verhältnis zur Mutter, ohne Kommentar über die Hintergründe«, so die amerikanische Verlegerin und spätere mütterliche Freundin Uwe Johnsons, Helen Wolff (in: »Wo ich her bin ...«, hg. von R. Berbig und E. Wizisla, Berlin 1993, S. 158). Kein Zweifel: Energie, Mobilität, die Bildungsaspirationen des Kleinbürgertums mit den entsprechenden Erziehungsvorstellungen zeichneten Uwe Johnsons Mutter aus.
EIN AUGENFEHLER UND EINE LIEBE ZUR MUSIK.
EIN EIGENES HAUS UND DIE VERTREIBUNG DARAUS
Bereits als Kind war Uwe Johnson mit einem Augenfehler behaftet. Ein schulärztliches Attest vom 25. August 1952 bescheinigte ihm auf dem »lk. Auge« eine angeborene Weitsichtigkeit. Erna Johnson suchte das zu kurieren in der ihr eigenen Art. Mit Entschiedenheit und mittels einer schwarzen Augenklappe rückte sie ihrem Kind zu Leibe. Technisch handelte die Frau überlegt und sagte doch wiederholt im Beisein des Knaben: »du schielst as een Schafbock«. Im Leben geht, wie in der Literatur, keine Erfahrung verloren. Die Wiederkehr des Verdrängten kann, wie Psychologie und Dichtung lehren, Menschenschicksal prägen. In der eigenen Tochter Katharina wird Uwe Johnson später anamnetisch erschüttert sein Schicksal wiedererkennen, wenn er am 31. Januar 1969 an die Rostocker Ersatz-Mutter Alice Hensan schreibt:
[...] dass Katharina schiele. Schiele! [...] Aber ich sehe das Kind an, das mit seiner eleganten braunen Brille aussieht genau wie die 12jährige in meiner Schule, die kein Mensch mochte, und kann mich nicht trösten.
Nicht bocksartig schielend, sondern symmetrisch dreinschauend wünschte die Mutter sich ihren Sohn. Ein Hof-Erbe sollte der Knabe zunächst werden, dann ein Chirurg. Im Jahr 1947 hat die verwitwete Erna Johnson einem Mann, der sie heiraten wollte – und den sie davon abzuschrecken wünschte –, erzählt, ihr Sohn solle Medizin studieren. Die sozialen Phantasien, die sich in diesen Berufswünschen aussprachen, sind von ehrgeiziger Dynamik. Darüber hinaus sollte Uwe Johnson Geigenunterricht erhalten, ein Vorhaben, das in die Tat umgesetzt wurde. Die Aufstiegsorientiertheit des Elternhauses spricht schließlich aus jenen Passagen der Begleitumstände, wo diese die proletarische Lösung einer »Schmiedelehre« in Recknitz beschreiben:
Leider wird diese Lehrzeit abgebrochen durch einen Wunsch des Vaters, der durch seinen Tod in ein Vermächtnis verwandelt ist: »Der Junge soll es einmal besser haben.« Darunter hat man zu jener Zeit unberatenerweise verstanden: den Übergang auf eine weiterbildende Schule, das Abitur und, womöglich, ein Studium. Hätte es damals eine Wahl gegeben, ich riete mir von heute her zur Schmiedelehre. (Begleitumstände, S. 33)
Das freilich wurde 1979 rückblickend von einem geschrieben, der im Begriff war, sich nach jahrelanger Depression und Schreibhemmung das Schreiben mühsam wieder beizubringen. Der Wunsch nach der Schmiedelehre liest sich vor diesem Hintergrund so sarkastisch wie illusorisch und provokativ.
Die soziale Karriere der Familie setzte sich fort und gipfelte endlich im Bezug eines Hauses mit Garten, jenem Archetyp des alldeutschen Lebenstraums. Immerhin zogen die Johnsons, soziale Aufsteiger sind in aller Regel mobil, in ihren elf Anklamer Jahren, zwischen 1934 und 1945, dreimal um. Der letzte Umzug ging im Jahr 1938 nach »Mine Hüsung 12«, knapp zwanzig Minuten Fußweg von der alten Adresse entfernt und damals noch vor der eigentlichen Stadt. Ein neuerschlossenes Wohngebiet, auf dem einladende Walmdachhäuschen errichtet wurden. »Am Markt 23« hatten die Johnsons nur den abgeteilten Part einer Fünf-Zimmer-Wohnung ihr eigen nennen können. Jetzt zog die Familie in ein geräumigeres Domizil, das durch Wohnkredite des neuen nationalen – sich ja auch sozialistisch nennenden – Regimes ermöglicht worden war. Das »Häuschen mit Garten« besaß einen – kleineren – Ziergarten vorn und einen – größeren – Nutzgarten hinten. Die Siedlung ging von der Pasewalker Landstraße ab und verlief U-förmig. Johnsons wohnten, von der erwähnten Pasewalker Landstraße her betrachtet, im rechten Flügel des Areals mit einem guten Stück freier Aussicht an der rückwärtigen Front. Eine weitere Stadtrandsiedlung entstand in ungefähr 200 Metern Entfernung, bestimmt für kinderreiche und sozialschwache Familien. Von denen war man aber durch eine Wiese getrennt, durch sumpfigen Grund, den ein Kind im Sommer barfuß als Spielplatz nutzen konnte.
Uwe Johnson selbst hat eine ebenso mimetisch genau erinnerte wie frei konzipierte Skizze dieses frühen Wohnorts gegeben. Auch in ihr wird der Ensemble-Charakter der neuen Siedlung betont, der ursprünglich sehr viel strenger als heute ins Auge getreten sein wird. Daneben stellt der Erinnernde heraus, was dieser Umzug für das soziale Selbstgefühl der Familie und deren emotionalen Zusammenhalt bewirkte. Es entsteht das Bild von Menschen, die in der Gleichförmigkeit ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln, die auch neue Zuneigung füreinander finden, verbunden durch den Stolz auf das endlich Erreichte. Diese nur a posteriori widersprüchliche Signatur prägt Johnsons literarische Skizze des Anklamer Milieus im Dritten Buch über Achim, wo der Autor seiner Figur Achim eine Jugendbiographie erfindet, in der Züge des Alltagslebens der Johnsons um 1939/40 zu erkennen sind:
Das Amt gab ihm südöstlich vor der Stadt ein Einfamilienhaus zur Miete. Das waren damals etwa zehn gleichförmige Häuser um einen ungepflasterten Dorfplatz, in dessen Mitte ein Findling aufgerichtet war zum Gedenken an die Toten des ersten deutschen Weltkrieges aber noch nicht für die des zweiten. Die Häuser hatten alle den nämlichen verglasten Treppenaufgang zur Seite, graubraune Satteldächer, die gleichen Fensterordnungen und Schuppen in den großen Hintergärten. [...] Dem Vater wich der graue Schimmer aus dem Gesicht, er war nicht mehr rauhbärtig wie früher die meiste Zeit der Woche, er trug weiße zugeknöpfte Hemden mit Krawatten, er kam gebadet nach Hause wie festtäglich. [...] Vor den feiertäglichen Besuchen der neuen Kollegen saß die Mutter fahrig überrötet am neuen Frisiertisch und tat sich Puder und Crème und Farbe ins Gesicht; Achim pflegte daneben lehnend ihr zuzusehen, bis sie seinen Blick im Spiegel festhielt und fragte ob es genug sei, und er verlegen nickte. Sie war viel zärtlicher zu ihm, inzwischen glaubte er sich wieder groß genug dafür. (Drittes Buch, S. 89)
Ein Zufall ist es wohl nicht, daß in Uwe Johnsons Literatur Szenen erfüllten Familienlebens, wie sie dem neu bezogenen Haus zugehörten, in tableauartig breiter Schilderung zu neuem Leben erwachen:
Der Vater hat nicht viel gesagt. Sein Gesicht war unlesbar verschwiegen, er verständigte sich mit einzelnen wie hervorgepreßten Worten, nur der Mund war bewegt; [...] Die Mutter ging den an mit Beredsamkeit. [...] Im Umgang mit den Nachbarn war sie lockerer, die Worte gingen ihr unbedacht vom Mund, sie lachte gern: wie überrascht. Mit herzlichen Reden und betulich hielt sie den staatlichen Frauenverband in der Siedlung zusammen, stellte jede Tüte gesammelter Lebensmittel befriedigt nachzählend auf die ausgezogene Servierlade der Kredenz im Wohnzimmer, tat die grösste am Ende selbst hinzu: dabei kam es ihr an auf den Zusammenhalt des deutschen Volkes gegen seine Feinde. [...] Bei den stundenlangen Reden des erregten Hitler [...] sass sie ergeben bisweilen mit Kopfschütteln am Strümpfestopfen, während der Vater krumm den Kopf auf die Tischecke stützte, die man nicht einsehen konnte. [...] Die Mutter bekam nichts Sichtbares zu Weihnachten, aber zum Geburtstag Romane, die sie während des übrigen Jahres nicht zeigen durfte, denn der Vater hielt nichts vom unterhaltenden Lesen. (Drittes Buch, S. 75 ff.)
So weit scheint, bei aller gebotenen Vorsicht gegenüber der Klippe des Biographismus, die Folgerung gestattet: Wir sehen vor uns die Familie Johnson in »Mine Hüsung« Nr. 12. Damit enden aber die Parallelen. Denn Achims Vater ist Arbeiter und Antifaschist, bei dem sogar Widerstandshandlungen nicht auszuschließen sind – in diese Wunschvater-Zone hat der Autor seine Figur als Hommage an seinen Leipziger Professor Hans Mayer weitergeführt. Johnson selbst hat dem Gelehrten dies mitgeteilt.
Der Knabe nannte die neue Heimat »Oma Röhls Stadt«, denn in der Nähe, noch auf dem Lande vermutlich, wohnte die Großmutter von Anneliese Röhl. In der kindlichen Bezeichnung mag auch so etwas wie kindliche Melancholie mitschwingen, Sehnsucht des Knaben nach seiner eigenen fernen, geliebten Oma auf Wollin, der Insel im Oderhaff, wo man mit dem Kahn durch knisterndes Schilf gleiten konnte.
Die Siedlung, wie immer vor 1933 erbaut, als programmatische Sozialleistung des »Dritten Reiches«, ihr Name als Antwort auf Fritz Reuters Versepos Kein Hüsung: Nie mehr im neuen Deutschland sollten Liebende nicht zusammenkommen können, bloß weil ihnen der Wohnraum fehlte. Im Hause des Erich Johnson kündigte sich denn auch noch im Jahr 1939 Nachwuchs an. Die Familie vergrößerte sich 1940 um die Tochter Elke Christine. »Elke Christine«. »Uwe Klaus Dietrich« – klatschten in der Siedlung und im Städtchen die Leute über die aktive Frauenschaftlerin Erna Johnson: Die Frau lese zuviel triviale Literatur und wolle zu hoch hinaus?
Deutschlands Wiederaufbau, wie die Zeit ihn sah, war nicht nur abgeschlossen, das Reich begann vielmehr, sich neuen »Lebensraum« zu erobern. Es stand sehr gut um Hitlers Krieg im Jahre 1940. Immer mehr Volksgenossen würden DKW – und Volkswagen – fahren. Man war, aus Schweden stammend, ohne jeden Zweifel arisch und hatte es auch nachweisen können. Die Familie Johnson hatte manchen Grund zur Zufriedenheit. Und so muß man sich den Parteibeitritt des Vaters am Märzbeginn des Jahres 1940 als einen Akt vorstellen, in dem sich Bekenntnis, Dankbarkeit, Gewährenlassen, Trägheit, Konformismus und Opportunismus ununterscheidbar vermischten: als ein deutsches Syndrom. Der einzige, der immer noch weiter sollte, war der Knabe.
Der besuchte vom April 1940 bis zum Juni 1944 die Comenius-Schule in Anklam, ein guter Schüler. Das Leiden an dieser vor allem preußisch geprägten Schule kann er später authentisch bei Thomas Mann nachlesen – es wird die Identifikation mit dessen Tonio Kröger fördern und auf gewisse Weise die Schriftstellerlaufbahn Johnsons mitinitiieren. Andererseits hing auch an der Wand der preußisch geprägten Schulstube in Anklam das Konterfei Hitlers. Im zweiten Band der Jahrestage kann man darüber nachlesen:
Adolf Hitler ist der Führer.
Adolf Hitler liebt die Kinder.
Die Kinder lieben Adolf Hitler.
Die Kinder beten für Adolf Hitler. (Jahrestage, S. 859)
Und:
Marie, an der Stirnwand des Klassenraums in Jerichow hatte der Spruch gestanden von den deutschen Jungen, die so hart sein sollten wie ein Erzeugnis der Firma Krupp, zäh wie Leder und noch etwas. [...] In Gneez hatten sie in fetter brauner Fraktur an die Klassenwand malen lassen:
»Ihr seid das Deutschland der Zukunft
und wir wollen daher
daß ihr so seid
wie dieses Deutschland der Zukunft
einst sein soll und muß. A. H.«
Auf Mittelachse geordnet. (Jahrestage, S. 934 f.)
Wie auch immer der Grundschüler Johnson sich unterdrückt gefühlt haben mag; seine Zeugnisse fielen überdurchschnittlich aus. Das gab der ehrgeizigen Mutter die Chance, den Knaben für die »Deutsche Heimschule« im fernen Kosten bei Posen anzumelden, ein Internat mit dem strengen Ziel nationalsozialistischer Eliteerziehung. Unverhofft und brutal trat sie an die Stelle familiärer Idylle im Anklamer Walmdachhaus.
Er war daran zu begreifen daß die dörfliche Vertrautheit des verlassenen Ortes verloren war. Die Freunde würden vergessen werden müssen, hier halfen sie einem nicht. Der Wald und der Fluß und daß man jeden Stein im Pflaster kennen konnte: verloren. (Drittes Buch, S. 88 f.)
»Verloren«, hier zum ersten Mal, seitdem immer wieder. Auf die Realisierung des Märchens in »Mine Hüsung« erfolgte jäh der Schubs in die politische Sozialisation, von dem Knaben als eine Art Vertreibung erlebt. Statt normaler Volksschule und freien Nachmittagen auf den Wiesen der Siedlung, in einer Umgebung, die der Knabe inzwischen kennengelernt und zu der seinen gemacht hatte, nun eine Anstalt mit militärischem Drill und, so sieht es aus, sogar verordnetem Boxkampf. Der krude Wechsel erfolgte zur Mitte des Jahres 1944. Er traf einen Zehnjährigen und bildete, ein Trauma mit lebenslangen Folgen, mit einiger Wahrscheinlichkeit vor, was Uwe Johnsons Literatur dann insgesamt prägen wird: den Verlust dessen, was Heimat symbolisiert, aus Gründen der Politik. Eltern- und Liebesverlust, Einbuße alles Vertrauten aus Gründen, die ganz uneinsehbar für den Knaben mit einem fernen, strengen Staat und mit der, wie es in den Mutmassungen heißen wird, »politischen Physik« zu schaffen hatten. Daß ihm der Wechsel zudem in einem Lebensaugenblick zugemutet wurde, als die Familie sich erstmals wirklich auf ein unbefristetes Bleiben eingerichtet hatte, muß die Verletzung förmlich bis in die Fundamente seiner Person getrieben haben. Derart, daß Uwe Johnson diesen ersten, grundlegenden »Verrat« seinen Eltern, der Mutter zumal, nie würde vergeben können: Man hatte das introvertierte, sensible und schmale Kind abrupt der Härteerziehung der neuen Barbaren ausgeliefert. Dabei las der Junge fast süchtig.
Das Alarmsignal war so unübersehbar, es hätte wahrgenommen werden müssen: dies Kind las. Mit zehn Jahren hatte es sich gelangweilt in der Gesellschaft von Winnetou und Karl Mays Bände durchgenommen wie eine Schulaufgabe, da sie als Geschenk zu würdigen waren. Noch die genaueren Indianerbücher waren Pflichtstücke gewesen, Märchen gehörten zur Grundausstattung des Krankseins, waren verordnet wie Medizin, und die Erinnerung misstraut der gefälligen Legende, man habe einmal auf dem Dachboden der Grosseltern, in einer Luft voll sauberen Staubes, von der Sonne geheizt, den »Robinson Crusoe« gefunden. Die psychologische Ausbildung des Wehrwillens durch die militärischen Dreigroschenhefte hatte so wenig angeschlagen, dass das Gedächtnis sich begnügt mit einem einzigen Satz, in dem ein Mann auf einem Flussdampfer dem Bordhund eine Scheibe Brot »hauchdünn« mit Schmalz bestreicht; der Rest dieser Szene ist das einzige, was bedauerlich fehlt. (Begleitumstände, S. 33)
Ein solcher Geschmack wird ihn bereits auf der Grundschule in Anklam vereinzelt haben. Wie viel mehr mußte er das auf der nationalsozialistischen Sonderschule tun. Diese würde ihm, neben anderem, das Lesen zensieren und verbieten wollen. Wer die Heimat nicht und auch nicht seine Lektüre behalten durfte, der mußte sich beides eben schreibend selbst verfertigen. Das Schreiben zum einen als einzig wirksame Therapie gegen das existentielle Verlustgefühl, wie es die Wahrnehmung des unaufhaltsamen Verrinnens der Zeit hervorzurufen vermag. Schreiben darüber hinaus als Mittel gegen den Heimatverlust, der einen, mit schrecklicher Plötzlichkeit, treffen konnte.
An solche Konsequenz war 1944 natürlich noch nicht zu denken. Doch daß er – und noch dazu so plötzlich – fortgegeben wurde, mußte der Knabe zuallererst seiner Mutter als »Schuld« anrechnen, stellte diese doch seine erste Beziehungsperson dar. Noch als die Schwester später, 1963, die krebskranke Mutter zu sich in die Wohnung nahm, statt sie pflegen zu lassen, empfand Uwe Johnson das als eigentlich unverständliche Nähe und Sentimentalität. Die Tiefe der Verletzung schränkte ihm auch da noch die Fähigkeit verstehenden Verzeihens ein.
Zu allem zeichnete sich im Jahre 1944 die Kriegsniederlage für jeden unverkennbar ab. Erna Johnson, realitätsfern und in ihrem Glauben an den »Führer« so hysterisch wie später Uwe Johnsons Figur der Frau Lockenvitz, sandte ihr Kind dennoch in die »Deutsche Heimschule« im fernen Polenland. In diesem aberwitzigen Glauben, spätestens, »verriet« die Mutter ihr Kind. Daß Uwe Johnson später keine je erfahrene »Untreue« vergessen wird, daß er »Treue« als höchsten Wert noch in Nebensächlichstem bewahrte, bis hin zur grotesken, marottenhaften Anstrengung, nie etwas Zugesagtes zu vergessen, und zu der damit verbundenen wahrhaft tragisch-heroischen Anstrengung, Verläßlichkeit zwischen den Menschen einzurichten – das, so scheint es, hat seinen ersten Grund in diesem lebensgeschichtlichen Komplex.
DIE »DEUTSCHE HEIMSCHULE« IN KOSTEN BEI POSEN.
EINGANGSBILDER
Ob Uwe Johnson auf seinen Eintritt in die »Heimschule« vorbereitet war, wie weit er selbst bereit erschien dazu, ist heute nicht mehr zu rekonstruieren. Wohl aber, wie ihm seine »Heimschul«-Zeit ins Bewußtsein trat. Der »Hitlerjugend« kann der Knabe in Anklam aus Altersgründen noch nicht angehört haben, allenfalls dem »Deutschen Jungvolk«. Er selbst hat rückblickend beides unter dem gebräuchlicheren Begriff »Hitlerjugend« zusammengefaßt, hat Zugehörigkeit angedeutet. Dokumente liegen darüber nicht vor. Wohl aber die Äußerung Hans Werner Richters, noch einmal aus dem Etablissement der Schmetterlinge, derzufolge Johnson nach einer Auseinandersetzung einmal gesagt haben soll: »So schlecht hat man mich nicht einmal in der Hitlerjugend behandelt.« Richter weiter:
Auch er dachte ja an seine Biographie, wie Heinrich Böll [dessen Äußerung in dieser Richtung nachgerade notorisch war], auch er sagte einmal in einem anderen Zusammenhang, »ich werde mir doch nicht meine Biographie kaputtmachen«. Ich habe das nie begriffen, ich hielt den Gedanken daran fast für lächerlich. (Richter, Etablissement der Schmetterlinge, S. 181)
Es scheint allerdings, daß Uwe Johnson in diesem Punkt nicht anders dachte als sein Freund Hans Werner Richter. Nirgends hat er versucht, seine Zugehörigkeit zu Hitlers »Jungvolk« zu verbergen. In den Begleitumständen steht vielmehr:
Unter [Hitlers] Kommando verdarb der Sonntag, wenn die Jugend seines Namens in geschlossener Formation, Uniform Vorschrift, abmarschierte zum Besuch von Filmvorführungen über Leute wie Bismarck oder Rudolf Diesel. (Begleitumstände, S. 26 f.)
Man kann also nicht ausschließen, daß der Knabe Uwe zeitweilig einem beflissenen Hitlerjungen geglichen hat. Er selbst hat ausgeführt, gegenüber Wilhelm Johannes Schwarz: »Sicherlich besass ich damals das Weltbild, das die Schule vermittelt hatte, das Weltbild, das alle anderen hatten.« Johnson sagte aber auch, im gleichen Zusammenhang: »Nicht der Führer stand im Mittelpunkt meines Lebens, sondern meine Eltern.« Doch 1944, in der vierten Klasse, wurden ihm seine Kopfform, seine guten Schulleistungen und die Einstellung seiner Eltern zum Verhängnis. Da nämlich suchte eine der Kommissionen, die durch das Reich reisten, auch Uwe Johnson aus, um den blonden Jungen im verschärften Geist der nationalsozialistischen Elite erziehen zu lassen.
Die »Deutsche Heimschule« in Kosten bei Posen, heute polnisch Koscian, galt als eine etwas weniger elitäre Ausgabe jener »Nationalpolitischen Erziehungsanstalten«, die Hitler sich hatte errichten lassen, seinen Nachwuchs für die Kolonisierung der Welt heranzuziehen. Die Kostener Elite mithin war eine Elite der zweiten Wahl. Uwe Johnson erfüllte zwar, was Herkunft, Kopfform, Körperbau und Schulleistungen betraf, alle Vorbedingungen für die Elitezugehörigkeit im »Dritten Reich«. Wohl aber störte des Schülers Augenfehler. Erna Johnson hatte ihn doch nicht in Gänze zu korrigieren vermocht.
Dezidiert gehen Johnsons Lebensläufe, anders übrigens als später die Begleitumstände, auf die Zeit in Kosten ein; der früheste, geschrieben wahrscheinlich 1952 in Güstrow, wie folgt:
Ich wurde im Frühjahr 1940 in der Comenius-Schule in Anklam eingeschult, die ich bis zum Abschluss der 4. Klasse besuchte. Bei einer allgemeinen Auslese wurde ich für den Besuch einer »Deutschen Heimschule« vorgeschlagen. Vom Sommer 1944 bis zum Januar 1945 war ich der Schüler der »Deutschen Heimschule« Kosten bei Poznan/Posen. Nach der durch das Vorrücken der Roten Armee verursachten Auflösung der Heimschule lebte ich bei meinen Eltern in Anklam.
Die Neutralität der Schilderung fällt ins Auge. Eine Beteiligung der Eltern wird nicht erwähnt. Die Stilhaltung erscheint, selbstverständlich, für die damaligen Behörden der DDR berechnet. Verrät zudem noch die Handschrift der Mutter. Dagegen im später, 1954 wohl, geschriebenen Lebenslauf steht, nun bereits im gestrafften und geschmeidigeren Stil, der Einsatz allein erklingt wie ein kleines Fanal:
Ich heisse Uwe Johnson. Meine Eltern sind der Diplomlandwirt Erich Johnson und Erna Johnson, geborene Sträde. Ich wurde geboren am 20. Juli in Cammin in Pommern. Mein Vater arbeitete bis 1945 als Angestellter des Greifswalder Tierzuchtamtes als Tierzuchtwart und Kontrollassistent der Molkerei in Anklam. Dort besuchte ich bis 1944 die Volksschule. 1944 gab mich mein Vater in die Deutsche Heimschule Kosten.
Der Vater gibt hier das Kind fort – in der Formulierung des letzten Satzes gerät zum ersten Mal die Beteiligung der Eltern ins Bild. Doch der Vater soll es damals gewesen sein, ohne Beteiligung oder gar Einverständnis der Mutter? Als dieser Lebenslauf geschrieben wurde, lebte Erna Johnson noch in der DDR. Darin ist meines Erachtens der hauptsächliche Grund für die ausschließliche Nennung des Vaters zu sehen. Erich Johnson lag zudem zu diesem Zeitpunkt bereits in russischer Erde begraben, und die Johnsons wußten dies. In der Abfolge der Lebensläufe spricht ein fortgegebenes Kind, das sich schrittweise an die Verantwortlichen seiner Verstoßung heranarbeitet.
Im Verlauf dieses Prozesses wird der Vater, je später, desto mehr, exkulpiert. Dennoch: Die Wunde, die die Verstoßung einst zugefügt hatte, vernarbte allenfalls oberflächlich. Es erscheint schon als auffällig, wie sich die stilistische Geste des Fortgegeben-Werdens wiederholt, wenn es um die »Heimschule« geht. Noch 1981 schrieb der, der da bereits fast vierzig Jahre Abstand zu seinem Dasein als »Jungmann« besaß, an seinen Schulfreund Lehmbäcker: »1944 war ich in eine ›Nationalpolitische Erziehungsanstalt‹ getan [!], eine Kaserne von einem Internat.« Der sonst allem englischen Understatement zugetane Johnson nordet hier die »Heimschule« zur NaPoLa auf. In den selbstbiographischen Passagen seiner Literatur freilich hat er die Verantwortung des Vaters in gleichem Maße reduziert, wie er die der Mutter zumindest konstant erhielt. Im Gegensatz zum oben zitierten Lebenslauf wird es in den Jahrestagen die in religiöser Hysterie befangene Lisbeth sein, die ihr Kind fortgeben will. Cresspahl rettet seine Tochter, führt also aus, was in der Realität des Sommers 1944 Erich Johnson nicht möglich gewesen war.
Weiterhin erscheint in diesem Zusammenhang signifikant, daß jene Darstellungen, die sich aus Johnsons Rückerinnerung an die eigene Jugend speisen, auch Achims Jugendgeschichte im Dritten Buch und die Geschichte des Schülers Lockenvitz im Abschlußband der Jahrestage, die Rolle des Vaters je später, je deutlicher abtönen. Mehr oder weniger gezwungen stimmt Achims Vater der Polit-Karriere seines Sohnes zu. Im Fall des Lockenvitz schließlich wird recht unkaschiert verhandelt, worum es in der Realität von 1944 gegangen sein mag: Der Vater sagt ja zum NaPoLa-Plan, »vor die Wahl gestellt [...]: Einziehung zur Wehrmacht, oder ein anderes Bekenntnis zum Hitlerstaat.« (Jahrestage, S. 1722) Durch die Fortgabe des Knaben konnte der Vater bei der Mutter bleiben – bis kein Jahr später auch er »Mine Hüsung« verlassen mußte, um in den »Volkssturm« einzurücken.