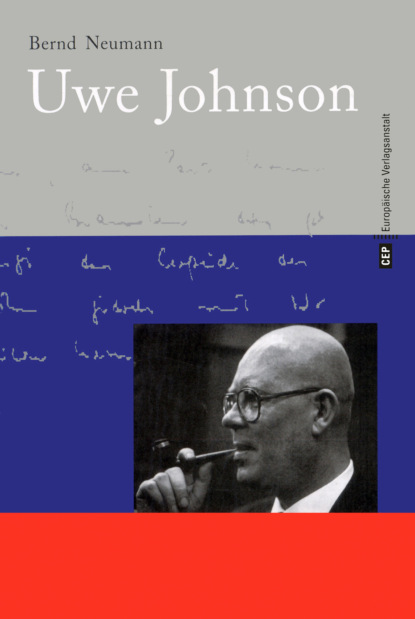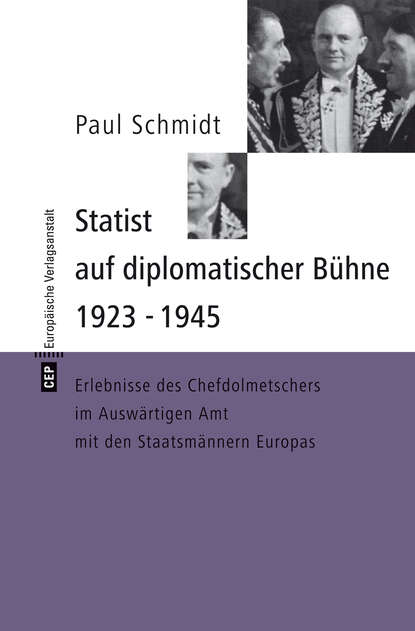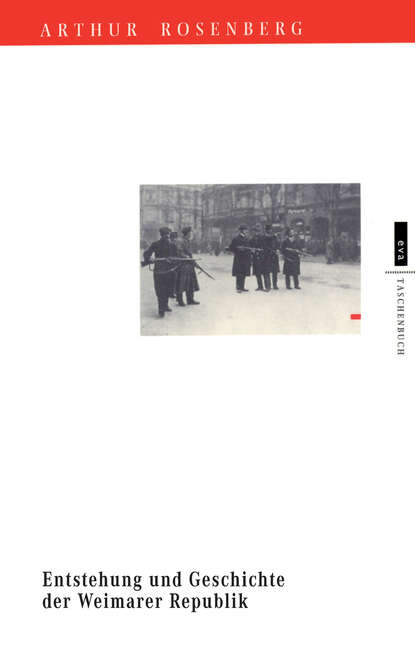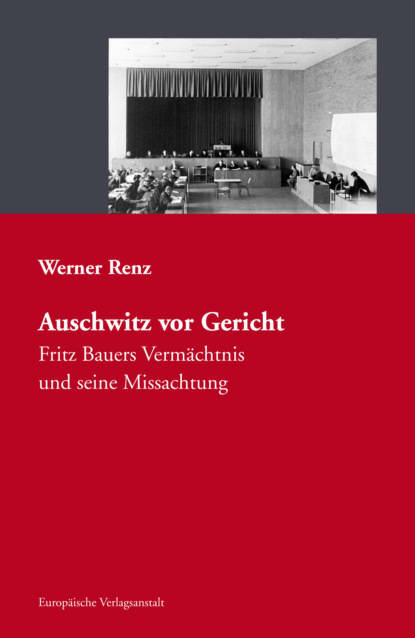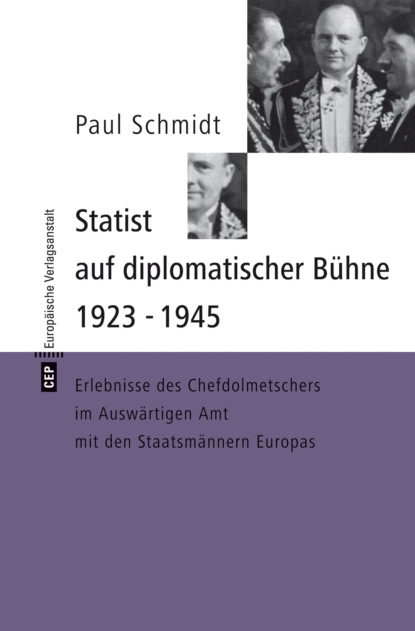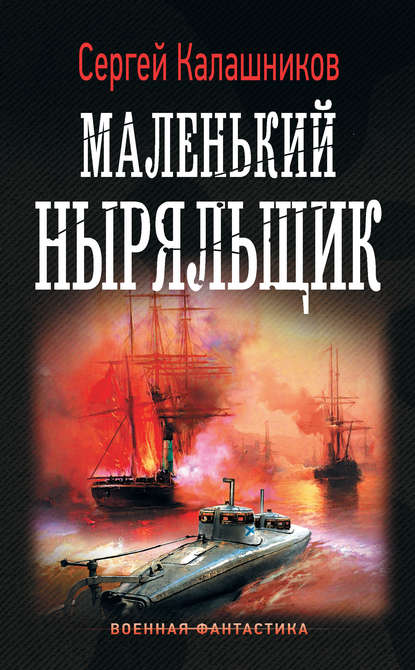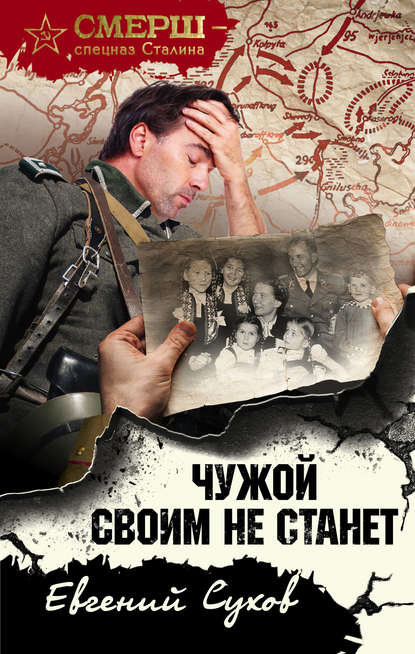- -
- 100%
- +
DIE »DEUTSCHE HEIMSCHULE« ALS INSTITUTION
Uwe Johnsons Aufenthalt in Kosten brachte ihn in zentrale Bereiche des braunen Erziehungswesens. Auf dem Reichsparteitag von 1935 hatte der »Führer« ausgeführt: »In Zukunft wird der junge Deutsche von einer Schule in die andre gehoben werden. Beim Kinde beginnt es, und beim alten Kämpfer wird es enden. Keiner soll sagen, daß es für ihn eine Zeit gibt, in der er sich ausschließlich selbst überlassen sein kann.« Uwe Johnson hat die Realisierung dieses Versprechens – oder lag hier eine Drohung vor? – am eigenen Leib erfahren. Mit zehn Jahren konnte ein Kind in eine NaPoLa aufgenommen werden. Insgesamt existierten etwa vierzig dieser Anstalten im gesamten Reich. Sie waren meist in Schlössern oder beschlagnahmten Klöstern untergebracht, in repräsentativer Umgebung jedenfalls, das Selbstgefühl der künftigen Elite auch durch entsprechendes Ambiente zu festigen. Als Vorbild galt die berühmte, herrscherlich über dem See gelegene, vormals kaiserliche Kadettenanstalt im holsteinischen Plön. Ursprünglich waren die NaPoLas eine Gründung der SA und als ein Geschenk zum Geburtstag des »Führers« 1933 gedacht. Nach dem 30. Juni 1934, dem Datum des sogenannten Röhmputschs, fielen sie an die SS. Im Lehrplan der NaPoLas stand herkömmlicher Schulunterricht neben militärischer Ausbildung. Letztere lief wahlweise auf eine der drei Waffengattungen zu oder auch auf die Waffen-SS. Daß eine Mehrzahl der sogenannten Jungmannen gerade der Waffen-SS den Vorzug gab, kann nicht überraschen.
Neben den »Nationalpolitischen Erziehungsanstalten« (offizielle Abkürzung: NPEA) und neben den vor allem in Holland und Flandern gegründeten »Reichsschulen« gehörten die »Deutschen Heimschulen« zum engeren Bestand der sogenannten nationalsozialistischen Sonderschulen. Für sie alle galt ein vergleichbar strenges Auswahlverfahren. Die reisenden Auswahlkommissionen sollten übrigens auch eine zu ausschließliche Selbstrekrutierung der NSDAP verhindern. Das hatte seine Gründe, schließlich wünschte jedes nationalsozialistisch überzeugte Elternteil sein Kind in einer der Schulen des »Führers« zu sehen. Die Sonderschulen waren, wie Statistiken zeigen, vor allem vom Mittelstand besucht – jenem Mittelstand, der auch in der Anklamer Siedlung »Mine Hüsung« zu Hause war.
Zwei Wege führten in solche Eliteerziehung hinein: ein eigener Antrag – was in der Praxis bedeutete: Antrag der Eltern – oder das Erwähltwerden durch eine der obersten Auslesekommissionen. Uwe Johnson verkörperte den gewünschten Typ und wurde auf die letztgenannte Weise »entdeckt«. Offiziell unterstanden diese Sonderschulen dem Reichsbildungsministerium. De facto bestimmte in ihnen freilich die SS unter Heinrich Himmler bis in die pädagogischen Details hinein. Insgesamt galt, was Horst Überhorst in Elite für die Diktatur (Düsseldorf 1969) geschrieben hat:
Wer bei der Aufnahmeprüfung nach dem Urteil des Referenten der SS nicht rassisch hochwertig war, hatte keine Chance, die Prüfung zu bestehen, auch wenn er sich sonst gegenüber allen Prüflingen als überlegen erwies. (Überhorst, Elite, S. 82 f.)
Dennoch meinte der SS-Gruppenführer Beyer in einem Schreiben an den »Reichsführer SS« Himmler, daß in den »Heimschulen [...] alles, jedenfalls keine Auslese« sei.
Bei der »Auslese« aber zählte bei weitem nicht allein die »Reinrassigkeit«. Ohne erstklassige schulische Leistungen besaß kein Schüler eine Chance. Auch mußte, und das geschah keineswegs nur pro forma, die Einwilligung der Eltern in jedem Fall eingeholt werden. In einer zeitgenössischen Veröffentlichung von Fritz Kloppe aus dem Jahr 1934 mit dem Titel Nationalpolitische Erziehungsanstalten heißt es:
Richtungweisend sind drei Sätze: Bei der persönlichen Vorstellung des anzunehmenden Schülers bei den Leitern der Anstalt – Kommandeur, Erziehungs- und Unterrichtsleiter – wird in einer kurzen Besprechung mit Vater und Jungen zunächst erkannt werden müssen, wieweit der Aufnahme Begehrende in die Anstalt paßt. [...] Die zweite Vorbedingung ist die rein körperliche Anlage des Jungen. Schwächliche Kinder mit körperlichen Fehlern, mit Erbkrankheiten (Herzfehler, Augenfehler) sind völlig ungeeignet. Bedauerlich persönlich, ein tüchtiger, rassisch einwandfreier Knabe mit solch einem Fehler, aber Humanitätsgefühle: ach der arme Junge! sind unzulässig.
Daß nun gerade Uwe Johnson, trotz eines manifesten Augenfehlers, in die nationalsozialistische Sonderschule in Kosten aufrückte, spricht für seine Schulzeugnisse. Und für die Bereitschaft der Eltern, den Knaben fortzugeben. Seit dem 7. Oktober 1937 war durch den Reichsbildungsminister Rust verfügt, daß sämtliche Volksschulen
diejenigen Jungen des dritten und vierten Schuljahres, die für eine Nationalpolitische Erziehungsanstalt geeignet erscheinen, zum 1. November jedes Jahres dem Kreisschulamt melden. Der Kreisschulrat reicht die Vorschläge der nächstgelegenen Nationalpolitischen Erziehungsanstalt auf dem Dienstwege weiter.
Dieser Dienstweg muß die Akte Johnson (und vermutlich auch den Knaben selbst) über Köslin geführt haben. Vom Oktober bis zum November 1943 wird Uwe Johnson einer Vormusterung ausgesetzt gewesen sein, durchgeführt vom Anstaltsarzt, dem Unterrichtsleiter und einigen anderen Erziehern in der am nächsten gelegenen NaPoLa, im Fall des Anklamers also im genannten Köslin. Dort wurde sein Schädel vermessen, seine Abstammung untersucht, wurden seine Zeugnisse gelesen, die Farbe der Augen, der Abstand zwischen Nase und Kinn, der Neigungswinkel der Stirn, die Kopfform insgesamt taxiert. Neben den Zeugnissen muß auch die Gesundheit des Knaben erstklassig gewesen sein. Denn von allen Volksschülern des Reichs, das damals rund 80 Millionen Menschen umfaßte, wurden pro Jahrgang lediglich vierhundert zur Vorprüfung für die NaPoLa angenommen. Hinzu kamen noch die, die von den Eltern direkt gemeldet wurden. Lediglich 100 bis 120 Schüler wurden nach der Vorprüfung zur Aufnahmeprüfung zugelassen, die wiederum nur ein Drittel bestand.
Auch die praktischen Prüfungen waren in allen Fällen ähnlich. Überhorst hat sie nach dem Zeugnis eines »Jungmann K.« aus der Klasse 5a beschrieben:
Dann führte man uns die Panzernahbekämpfung vor. Wir sahen wie gefährlich ein Panzer ist und wie schwer er zu »knacken« ist. Das »Knacken« eines Panzers erfordert vor allem Ruhe, Schnelligkeit und Geistesgegenwart. Wir sahen, wie SS-Männer einen russischen Panzer vom Typ T 34 auf sich zurollen ließen und erst im letzten Augenblick, als die Ketten des Panzers etwa 75 cm vor ihrem Körper waren, zur Seite sprangen. (Überhorst, Elite, S. 396)
Diese heroische Seite besaß freilich auch ihr administratives Gegenbild. Da es sich bei dem Ganzen um eine deutsche Auslese handelte, war nämlich noch die geringste Einzelheit detailgenau geregelt:
Die Reisekosten zur Aufnahmeprüfung und der Aufenthalt in der Anstalt (täglich 1,30 Reichsmark) gehen zu Lasten der Eltern. Es empfiehlt sich, die Fahrkarte des Jungmannen für die Hinfahrt von der Bahn zu »Reklamationszwecken« bescheinigen und sich aushändigen zu lassen, da die Kosten dieser Fahrt bei Bestehen der Prüfung auf Antrag zur Hälfte erstattet werden können. (Überhorst, Elite, S. 83)
Erna Johnson, eine glückliche deutsche Mutter, wird im Sommer 1944 den Vorschriften gefolgt sein. Sie hat ihrem Sohn zusammengestellt und ganz gewiß mit seinem vollen Namen versehen:
1 braune Sporthose,
1 Braunhemd,
1 schwarze Badehose,
1 kurze Hose,
1 Badetuch,
2 Paar schwarze Strümpfe,
1 Paar Hosenträger,
1 weißes Turnhemd,
1 Wäschebeutel,
1 Nähkästchen,
1 Wandereßbesteck,
1 Zahnbürste mit Behälter,
1 Reisekoffer oder Reisekorb,
3 Nachthemden oder Schlafanzüge,
4 Handtücher, Seife,
1 Handbürste,
2 Waschlappen,
1 Nagelscherchen,
18 Taschentücher,
1 Paar Turnschuhe,
1 Kleiderbürste, evtl. Rasierzeug,
1 Wasserglas,
2 Putzlappen,
Schuhputzzeug. (Überhorst, Elite, S. 84)
Damit ausgerüstet, ein Besitzer von insgesamt 18 Taschentüchern, reiste ein Knabe im Sommer 1944 aus seinem Anklamer Häuschen ins Internat der Kostener »Heimschule«.
SCHULUNTERRICHT UND SONNENWENDFEIER
Die in der »Heimschule« mißbrauchte Sehnsucht nach Gemeinschaft wird Uwe Johnson, vor allem im Sport, recht grausam zugesetzt haben. Seine gesamte Persönlichkeit stand quer zu dem, was in der »Heimschule« gefordert wurde. Und doch wird er sich gewünscht haben, dazuzugehören. Alles erschien abgestellt auf die Identifikation mit dem Aggressor, machte sie doch das Zentrum von Herrschaftsausübung in beiden Totalitarismen unseres Jahrhunderts aus. Im Unterwerfungsritual stand das Schauspiel der Gewalt mit seiner archaischen, wortwörtlich bluttriefenden Attraktion im Mittelpunkt. »These new boarding-schools, therefore, fifteen in number, started in 1933, were modelled in more than one respect upon our English Public Schools« – so hat es damals ein Engländer, der in Hitlers Reich zu Besuch weilte, aufgeschrieben (auch dies zitiert nach Überhorst, Elite, S. 321). Das Englische stand an zentraler Stelle im Lehrplan dieser Schulen. Vor dem Krieg waren Schüleraustausch und ständige Verbindung mit englischen Schulen häufig. Vor allem den Sport als hochrangigen Erziehungsfaktor hatten Public School und NaPoLa gemeinsam. Statt des englischen Mannschaftssports freilich wurde in den von der SS gesteuerten Anstalten das Boxen Mann gegen Mann verordnet. Eine NaPoLa-eigene Zeitschrift, Der Jungmann, veranschaulicht, wie es dabei zuging:
In der [Aufnahmeprüfung] fing es an. [...] Die Zugführer standen mit Notizblock und gezücktem Bleistift bereit, jeden Fehlschlag zu vermerken. Die ersten Gegner machten sich fertig. Auf das Kommando »Los!« schossen sie wie zwei Kampfhähne aufeinander und begannen eine schreckliche Schlägerei. Sie dachten: »Je mehr wir aufeinander losgehen, desto höher wird es uns gewertet.« Schlag um Schlag prasselte auf die nackten Körper. Jeder kniff die Augen zu und schlug wild um sich. Schließlich mußte der Zugführer wegen blauer Augen und roter Nasen den Kampf abbrechen. (Jungmann, Jg. 1936, Heft 2, S. 29)
Über Uwe Johnsons Gemütsverfassung auf dem NS-Internat gibt ein Brief Auskunft, den er am 5. August 1981 an den Schulfreund Heinz Lehmbäcker gesandt hat:
Dear Henry
ich habe zu danken für zwei Briefe, vom 12. und 27. des vorigen Monats, auch für Glückwünsche zu einem Tag zwischen den beiden. Dieser 20. Juli ist mir in einem recht frühen Sommer abhanden gekommen. 1944 war ich in eine »Nationalpolitische Erziehungsanstalt« getan, eine Kaserne von einem Internat, da wurde den halben Tag Sport als Heeresdrill betrieben, auch die Freizeit war der militärischen Erziehung gewidmet, so dass ich zu leiden hatte, Brillenträger schon damals. Am 19. befand die »Stube«, ich hätte ihre Ehre durch mangelhaften Bettenbau geschändet, so dass das Geschenk zum Geburtstag in den frühen Morgenstunden erschien als nächtliche Abreibung, »Heiliger Geist« genannt, und ich am Abend recht erleichtert war über die Nachricht, in Berlin sei die Regierung abgeschafft worden, in deren Sinne Kinder der Maßen abgerichtet wurden. So fällt mir zum 20. Juli immer zuerst ein, und verdrängt das private Datum, dass an diesem Tage etwas zu meinem persönlichen Nachteil schief gegangen ist. Tatsächlich habe ich ihn in diesem Jahr zum ersten Mal zu begehen versucht. Aber in dem Luftkissenfahrzeug zwischen Dover und Frankreich, dieser fliegenden Garage, fiel mir angesichts der vierzig Minuten Reisezeit doch wieder als Hauptsache ein, dass Hitlers Seelöwe zu lahm war für diese Strecke, und in Boulogne-sur-Mer sah ich am deutlichsten an der höckerigen Stadt die vielen Eisenbahntunnel, in der [sic!] Hermann Meier mit seinem Sonderzug Asien sich verkroch, weil er Schiss hatte vor der Royal Air Force, die er längst »am Boden zerschmettert« hatte mit seinem grossen Maul. Nunmehr will ich mich endgültig begeben in die Einsicht, dass mir dieser Tag beschlagnahmt ist.
Daß Uwe Johnson in diesem Brief seinen Geburtstag am 20. Juli mit dem gescheiterten Attentat auf den »Führer« zusammensieht und Göring nennt, wie dieser genannt zu werden wünschte, sollte er nicht die Luftherrschaft über England erringen – das schuldet sich natürlich dem politisch reflektierten, sarkastischen Bewußtsein des nunmehr 47jährigen Autors. Dennoch wird deutlich: Der Knabe Johnson war kein Hitlerjunge Quex. Vielmehr einer, den die Quexe drangsalierten, wofür es verschiedene Gründe gab. Zunächst: Johnson besaß zum Sport ein ausgesprochen delikates Verhältnis. Weiterhin: auf der Comenius-Grundschule hatte man den Konflikten noch durch Auswendiglernen entgehen können. Darüber berichtet auch die Gesine der Jahrestage ihrer Tochter Marie. Schon damals war Johnson ein langaufgeschossener Leptosomer, schlaksig und schielend. Als einer, der zudem leidenschaftlich las, und zwar seine »private« Lektüre, war er ein nachgerade prädestiniertes Objekt des Gehänselt-Werdens. Das um so mehr, als er sicherlich sein Handikap durch gute Schulleistungen auszugleichen trachtete. Die Photos des jungen Studenten zeigen eine deutliche Narbe unter dem linken Auge. Als Teil von Achims Jugenderfahrung hat Uwe Johnson im Dritten Buch jene Passage niedergeschrieben, in der wir ihn erneut in Kosten vor uns sehen:
In der Schule schloß er lange keine neuen Freundschaften, der Briefwechsel mit den zurückgelassenen wurde aber ratlos. [...] So übertrieb er den Eifer im Unterricht wie bei den Schularbeiten bis nahe an den Platz des Klassenersten; drei Mitschüler lauerten ihm auf an der nachmittäglich unbegangenen Straßenecke und schlugen ihn zusammen, ein scharfkantiger Stein hinterhergeworfen riß ihm die Schläfe weit auf, das ist diese Narbe am linken Auge. [...] Immerhin war ich doch ziemlich verletzt: sagte er, und: Bedenke mal daß wir die reinen Kinder waren. (Drittes Buch, S. 90 ff.)
Sie erschienen als die reinen Kinder, diese zehnjährigen »Jungmannen«. Und müssen einander dennoch im Stil der staatlicherseits gewünschten »Blonden Bestie« Nietzsches zugesetzt haben. Des Mecklenburgers Erfahrung war eine generationstypische. Das macht auch die literarische Qualität der entsprechenden Passagen etwa im Dritten Buch aus. In Fritz Rudolf Fries’ Weg nach Oobliadooh, in einem Roman also, den sein Autor selbst als Antwort auf die Mutmassungen verstand und den kein anderer als Uwe Johnson half, dem Suhrkamp Verlag zur Publikation zu vermitteln, erscheinen ganz ähnliche Erfahrungen aufbewahrt:
Paasch vortreten, sagt der Lagerälteste. [...] Die Fahne steigt in den Himmel, reißt ein schwarz-rot-weißes Loch ins Weiß der Morgenstunde. [...] Paasch ist an der Reihe. Er tritt aus dem Karree der Geborgenheit. Jemand verbindet ihm die Augen, führt ihn an den Rand der Grube, über die zu springen es gilt, ohne ihre Ausmaße zu kennen. Der Älteste pfeift. Paasch springt, fällt ins Bodenlose. Die Meute johlt. Der Lagerälteste pfeift ab. Paasch kann zurücktreten, taumelnd. (Fries, Obliadooh, S. 44)
Der Sport als Kampf und Krieg dominierte den Alltag dieser Anstalten. Daneben stand der Unterricht mit einem Stundenplan wie dem folgenden, der auf der NaPoLa im ostpreußischen Stuhm galt:
Deutsch 4 Wochenstunden Geschichte 3 Erdkunde 2 Latein 4 Englisch 5 Mathematik 3 Physik 2 Chemie 2 Biologie 2 Kunsterziehung 2 Musik 1 Sport 5 (Überhorst, Elite, S. 180)Selbstverständlich kann der Knabe Uwe Johnson von solcher Ausbildung nicht gänzlich unbeeinflußt geblieben sein, zumal sie sich an durchaus avancierten pädagogischen Modellen ausrichtete. Wie immer auch ideologisch der Blick nach rückwärts gewandt war, bezog die Pädagogik von Hitlers Sonderschulen die damals ganz modernen Medien Film und Rundfunk mit ein – und zwar in einem ganz erstaunlichen Ausmaß. Diese Eliteschulen erschienen als ein getreues Spiegelbild des »Dritten Reichs«, waren ideologisch einem vorindustriellen Denken, technisch und pädagogisch aber dem Modernsten, das damals überhaupt erreichbar erschien, verpflichtet. Insonderheit der »bildnerischen und handwerklichen Erziehung« räumten diese Anstalten einen breiten Raum ein. Dabei ging es ihnen immer um die Wahrnehmung von Geschichte im Gegenwärtigen, um das Erkennen des Symbolischen im Alltäglichen. Sehr früh bereits wird Uwe Johnson einen frappierend genauen, einen förmlich archäologisch sezierenden Blick für symbolische Komponenten in allen Erscheinungen entwickeln. Johnsons Darstellung der mecklenburgischen Landschaft in ihrem mythisch-geologischen Aufbau in den Mutmassungen legen Zeugnis davon ab. Gleiches tut die Heimatinnigkeit der Babendererde. Man mag sich gegen diese Erkenntnis sperren: Der Schriftsteller Johnson wird von der Kunsterziehung in der Kostener »Heimschule« nicht unbeeinflußt geblieben sein. Die Pädagogen des »Dritten Reichs« wußten nur zu genau, wie eine ästhetische Macht der Kunst sich politisch instrumentalisieren läßt:
Uns leitet dabei die Erkenntnis, daß Symbol und Bildwerk über die Herzen und Handlungen der Menschen wieder die Macht einer großen schöpferischen, von einer festen sittlichen Wertordnung getragenen Zeit gewonnen haben. Wenn aber 400 Jungen 8 Jahre hindurch täglich vor einem Glasfenster, dem von Langemarck oder dem des 9. November oder unter den 18 schmiedeeisernen Leuchtenböden des großen Saales sitzen, auf denen der Sinn dieses Geschehens in gestalteten Symbolen, Namen der Toten und Zahlen bis zum Sieg der Bewegung im Sudetenland eindeutig geformt ist, dann bildet das bei allen Jungen eine einzige Vorstellung. (Überhorst, Elite, S. 197)
Wer will das bestreiten? Und was im Kopf dieser Jungen dann eine »einzige Vorstellung« gebildet haben muß, ist zumindest in Umrissen rekonstruierbar. Der Wille, Symbole zu schaffen und dadurch die jugendlichen Gemüter zu erschüttern, kennzeichnete die Feierstunden und Gemeinschaftsgesänge. Der Tagesablauf der Sonderschulen trat als geschlossene Ereignisfolge auf, die ihren Zielpunkt eben in den Feierstunden hatte. Jeder Tag begann mit dem Wecken um 6.45 Uhr durch eine wütend schrillende elektrische Klingel. Darauf folgten Frühsport und das Duschen, das die verschiedenen Stuben in gehetzter Zeitabfolge durch erst brodelnde Hitze, dann strenge Kälte jagte. Um acht Uhr erhielten die Jungen die erste Portion Symbolik bei der Flaggenhissung verabreicht. Danach: Frühstück. Weitere wichtige Teile des Tages galten dem gemeinsamen Singen, Uwe Johnsons großem Sehnsuchts-Traum in späteren Güstrower Tagen. Es war überwiegend in die abendliche Dunkelheit verlegt, erhellt nur vom mystischen Lodern der Flammen (die »Waberlohe«). Da wird auch Uwe Johnson das Horst-Wessel-Lied gesungen haben, bezwungen vom Wunsch, dieser Gemeinschaft anzugehören. Allabendlich in der Gemeinschaftsstube der »Deutschen Heimschule« in Kosten erhob sich der Gesang der Knaben:
In den Ostwind hebt die Fahnen,
denn im Ostwind stehn sie gut!
Dann befehlen sie zum Aufbruch,
und den Ruf hört unser Blut.
Denn ein Land gibt uns die Antwort,
und das trägt ein deutsch’ Gesicht:
Dafür haben viel geblutet,
und drum schweigt der Boden nicht!
In den Ostwind hebt die Fahnen,
denn der Ostwind macht sie weit.
Drüben geht es an ein Bauen,
das ist größer als die Zeit!
Auch in diesen Zusammenhängen müssen wir uns den »Jungmann« Uwe Johnson vergegenwärtigen. Johnsons Texte werden der Erforschung und Widerlegung beider ideologischer Totalitarismen auf deutschem Boden mit den Mitteln der Ästhetik dienen, dabei sich so kompromißlos, klarsichtig und integer wie nur wenige andere artikulieren. Seine Authentizität gewann dieses Werk auch durch die Teilnahme seines Autors an den Ritualen der Nazi-Macht – zumal vieles davon dann in der ideologischen Adaption Stalins und den Ritualen der DDR-Staatspartei und der »Freien Deutschen Jugend« erneut auftauchte. Heiner Müller, auch er einer, der ein »Leben in zwei Diktaturen« (so der Untertitel seiner Lebenserinnerungen) geführt hat, stellte die Faszination des Horst-Wessel-Liedes direkt neben die der »Internationale«. Auf diese Weise vermochte einer durch beide deutsche Diktaturen hindurchzugehen. Niemand wird glauben, solche Feststellung mache dem Mecklenburger »die Biographie kaputt«. Im Gegenteil: erst solche Biographie verhalf ihm dazu, die innere Wahrheit seines Werkes zu festigen. Die fast unbegreifliche Stärke und Zähigkeit eines jungen Autors, der jahrelang unter denkbar ungünstigsten Bedingungen sein schriftstellerisches Werk vorantrieb, könnte man mit dem Durchsetzungsvermögen in Zusammenhang bringen, das man Uwe Johnson in Kosten antrainiert haben wird. Ihm gelang es, die Ablehnung des ersten Romans mit dem Verfassen des nächsten zu beantworten.
Am Ende des Schuljahres 1944 erhielt der »Jungmann« Uwe Johnson als Beurteilung die folgenden Sätze ins Zeugnis geschrieben: »Er ist ein verständiger, gewissenhafter Junge. Sein Interesse am Unterricht und seine Mitarbeit sind erfreulich.« Ein freundlicher Abschiedsgruß. Und doch hat der Güstrower diese Anstalt später so gehaßt, daß er sie aus seinem Leben in all jenen Lebensläufen ausstrich, die er erst mit dem Jahr 1945 beginnen ließ.
EIN EINSAMER LIEST.
ERSTE BEGEGNUNG EINES FORTGEGEBENEN
MIT DER KATZE ERINNERUNG
Die Facetten von Uwe Johnsons Kostener Dasein ergeben ein erstes Bild von Fremdheit. Daß der Knabe nicht frei gewesen sein kann vom Bestreben, von dieser Gemeinschaft, die ihn quälte, auch akzeptiert zu werden, machte alles nur noch schlimmer. Und dahin war es gekommen, weil seine Eltern ihn fortgegeben hatten. (Der Dichter Joachim de Catt in der Skizze eines Verunglückten wird dann als ein Waisen- und Findelkind in die Skizze geraten, als vermutlich ein Jude noch dazu.) In den Kostener Tagen könnte sich jedenfalls eine traumatische Erfahrung ereignet haben, die Johnsons Werk prägen sollte. Zumal sie sich, wenn auch unter anderem Vorzeichen, 1959 wiederholen würde: daß einem die Politik die Heimat nimmt. Daß man also »Heimat« immer schon im Zeichen vorweggenommenen Abschiedsschmerzes erleben mußte. Daß man im Gedächtnis zu bewahren angehalten war, was real jederzeit verloren gehen konnte. Die Babendererde wird mit folgenden Sätzen schließen:
– Wir werden ja sehen was an diesem ist: sagte Klaus. Sie würden ja sehen was an diesem war. Ob sie es vergessen hatten über ein Jahr, und ob das schlimm sein würde. Ob Ingrid dies gespreizte Gestab des Fensterschattens und ob Klaus Ingrids Hand an seiner Schulter und ob sie das Poltern der Ruder von vorhin mit dem eigentümlichen Ton von Rudern im Boot vergessen haben würden, und ob das schlimm sein würde. Und das Flirren der Fliederbüsche unter dem leichten Wind und das Schaben der Boote am Steg und das leise Getropf im Schleusenbecken. (Babendererde, S. 247)
Und, und, und. Es würde schlimm sein. Und es würde zugleich gar nicht schlimm sein, da der – vorausgewußte – Verlust seinerseits die Katze Erinnerung auf den Plan rief. Als Klaus im Erstling fortgeht und das Licht löscht, leuchten auf dem Dachboden der Niebuhrs die Augen der Katze auf: um dann erst mit dem Ausgang der Jahrestage wieder zu verlöschen.
Die Fremdheitserfahrung in Kosten war zudem eine ambivalente: Gegenüber den anderen »Jungmannen« stellte Uwe Johnson einerseits den verweichlicht Lesenden dar. Hochgewachsen und blond, angetan mit der blauen Ausgehuniform, erschien er andererseits als der germanische Herrenmensch – Eliteschüler eines völkermörderischen Regimes. In dieser paradox zugespitzten Situation hat Uwe Johnson die Literatur entdeckt. Und bleibt als der Lesende der unaufhebbar Fremde par excellence. Wie Johnson sich selbst dabei erlebt hat, dokumentiert sich auch in einem Beitrag, den er 1976 für die Ersten Lese-Erlebnisse verfaßte, die sein Verleger unter den Autoren seines Verlages gesammelt hat und wo Uwe Johnson just diese Kostener Erfahrungen zu Protokoll gegeben hat: