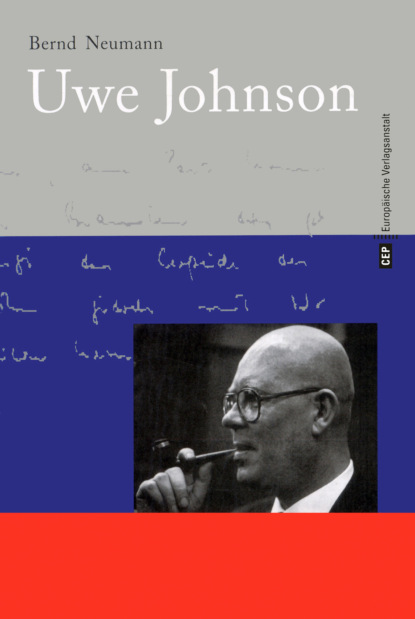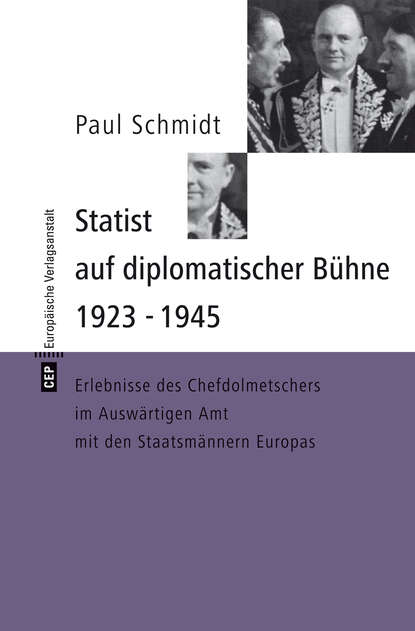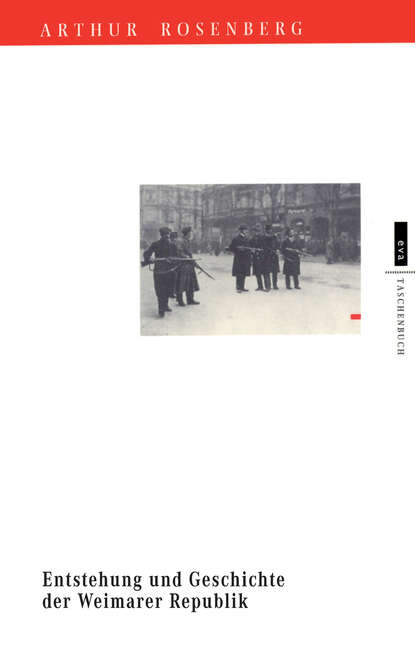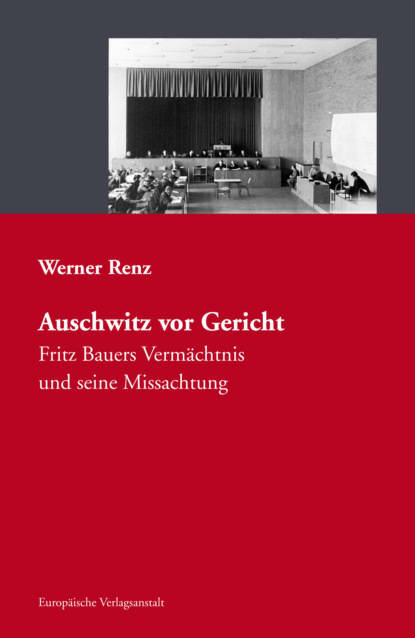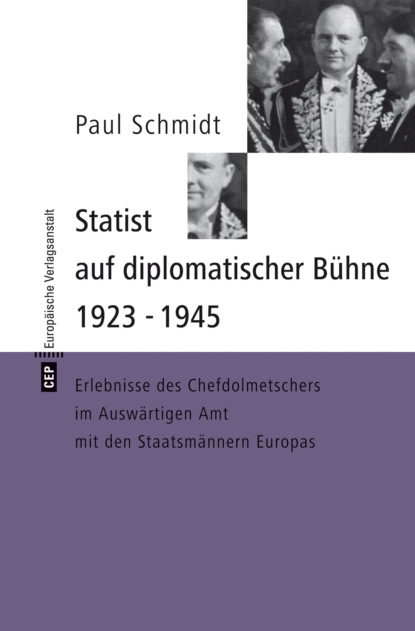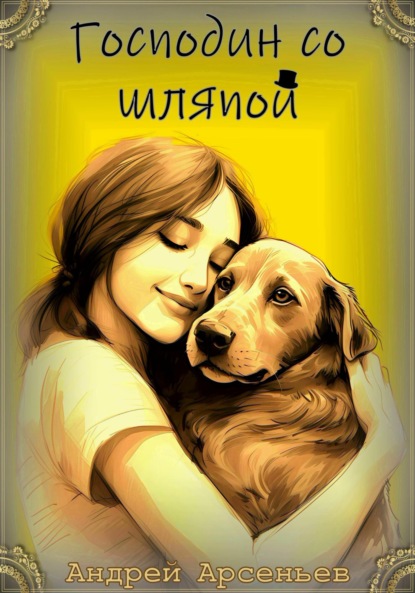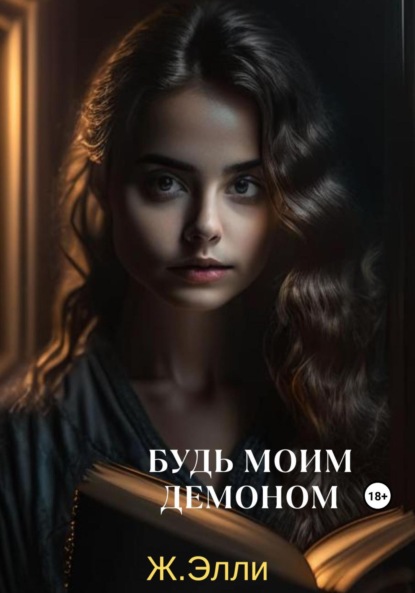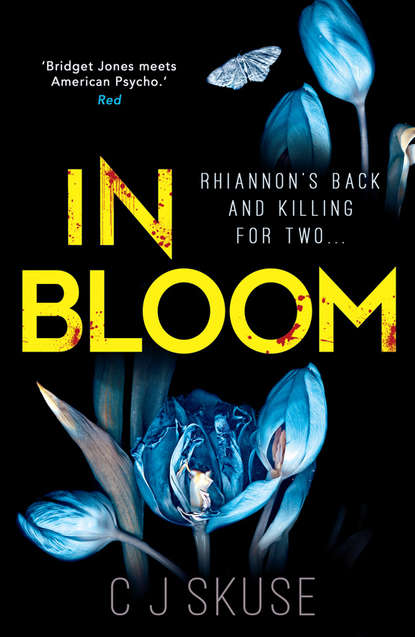- -
- 100%
- +
Von den polnischen Kindern beschmissen mit Steinen oder gefrorener Hundescheiße (denn es ist Januar), geht der Jungmann durch die zivilistischen Straßen auf die Leihbücherei, das Buch zurückzugeben, das er errungen hat unter heftiger Anschnauzerei von seiten der staatlich angestellten Frau, ehemals von Beruf Dame. Ein Buch über die Rückzugsgefechte der nordamerikanischen Indianer, bedeckt mit einem löcherigen Mantel von Wissenschaft; das Papier ist solider. Daneben die getürkte Autobiografie Hermann Görings. So viel weiß man schon, aber mit zehn Jahren nehmen sie einen nicht für Bibliografie. Wer liest, ist ungesund am Körper. Privates Lesen ist Verweichlichung. (Lese-Erlebnisse, S. 108)
Der Mecklenburger bezog sich dabei implizit auch auf die – im gleichen Sammelband veröffentlichten – Leseerinnerungen Martin Walsers. Walser hatte Hölderlin auf dem großväterlichen Dachboden, bei gleichzeitigem Blick auf die Berge jenseits des Bodensees, entdeckt. Johnson dagegen bietet uns Kosten im Januar. Und, wenn diese Zuspitzung erlaubt ist: Hundescheiße statt Hölderlins Hymnen.
Johnsons Sarkasmus zeigt den lesenden Knaben als Außenseiter der eigenen Gruppe. Selbst die Feinde seiner Gegner konnten ihn nicht akzeptieren. Die Reflexion solch doppelter Fremdheitserfahrung, ihrerseits zum Motor des Erzählens selbst geworden, wird dann die Jahrestage als Johnsons letztes und abschließendes Werk vorantreiben. Im New-York-Epos gilt der »Genosse Schriftsteller«, der ja auf seine Art ein Opfer der Nazischule war, den jüdischen Emigranten, sie versammeln sich in New York unter der Leitung des Rabbi Prinz, ehemals Berlin-Dahlem, als ein besonders germanisch aussehender Deutscher – gleichgültig, was dieser Redner ausführen mag. »Germanisch« schaute der Vortragende ja auch aus, verstärkt durch die schwarze Lederjacke, mochte diese in Wahrheit auch eher das Gegenteil ausdrücken: Johnsons Brecht-Verehrung. Ich zitiere bereits in diesem Zusammenhang eine Erinnerung Helen Wolffs an ihren Autor, Freund und Protegé Uwe Johnson in dessen New Yorker Zeit (hier wie auch sonst sollen die Erinnerungen Helen Wolffs im englischen Original wiedergegeben werden. Das Englische ist die Sprache dieser Emigrantin auch darin geworden, daß ihr darin gleichermaßen pointierte Formulierungen wie im Deutschen gelingen):
On another plane, he found here something he was looking for – the historical past that obsessed him. On the Upper West side, where he lived, he met, in density, survivors of his country’s mass murderings, and he responded to them with a mixture of fascination and guilt – the latter totally misplaced, of course, since he was a child when the war ended and by fact of date innocent. One episode to stand for many: Johnson used to take an occasional meal at a Jewish Cafeteria on Broadway, sitting in a corner, as he thought unobtrusively, but all the same conscious of his Teutonic appearance, enhanced by the inevitable leather jacket. A Jewish family took a table close to him, then began eying him suspiciously or so he thought. He immediately got up and retreated, but in a way that no one could misinterpret: He walked slowly backward toward the door, all the time turned toward the family and ceaselessly bowing in a gesture of regret and respect.
Mit einer Mischung aus Faszination und Schuld reagierte Uwe Johnson auf die Anwesenheit der Opfer des Holocaust in New York. Diese Konfrontation wird dazu führen, daß er seine eigenen Wurzeln in der deutschen Geschichte genauer wird ergründen wollen. In dieser Konstellation, wenn auch angesiedelt im weit prinzipielleren Bereich des entscheidenden deutschen Verbrechens: dem Holocaust, erkannte der angehende Autor der Jahrestage neben anderem auch Facetten seiner vormaligen Befindlichkeit in Kosten. Damals eilte er, wie zitiert, durch die Straßen der Stadt, mit Hundekot von den Einheimischen beworfen, auf dem Weg, sich eine Lektüre zu besorgen, die ihn zum Außenseiter der eigenen Gruppe machen würde. Die schockartige Entdeckung, daß man, obwohl an den Verbrechen der Nazis unschuldig, den Juden dennoch als blonder Deutscher und Mitverantwortlicher für den Genozid erscheinen mußte, wird dann den Erzählpakt zwischen Gesine und Johnson mitbegründen.
In der beschriebenen Kostener Situation muß sich etwas wie die »Konditionierung« des Erinnerungs-Schreibers Uwe Johnson ereignet haben. Wenn dies so war, kam diese »Konditionierung« aus der Situation des abgeschiedenen Lesens heraus zustande. Aus einem Lesen, das zudem im Bewußtsein ausgeübt wurde, Verbotenes zu unternehmen. Solches mit Schuldgefühlen beladenes Lust-Lesen hatte der Zehnjährige bereits zu Hause praktiziert:
Das war ein weltvergessenes Lesen, fiebrig, süchtig, übrigens durchaus in dem wahnwitzigen Wissen, dass die dort geschilderten Personen unwahrscheinlich waren, ihre Handlungen wenig zu empfehlen, kaum wünschenswert. Dies an die Empfindung von Sünde reichende Bewusstsein wurde nur notdürftig beruhigt von der mechanischen Stimmigkeit, in der die Erzählung jeweils sich zusammenfasste. Im Grunde verdankte sich die Faszination der immer von neuem staunenden Einsicht, dass die Namen auf dem Titelblatt einmal wirklich gewesen waren, bis zum Nachweis der Anmeldung bei der Polizei, dass es also Menschen gab, die sich die Welt selber machen können. (Begleitumstände, S. 34)
Der Knabe würde schließlich selbst einer jener Menschen werden, die »sich die Welt selber machen können«: als Autor zur Phantasieproduktion fähig und darin immun gegen den abrupten, früh und traumatisch erfahrenen Verlust alles Vertrauten. Uwe Johnsons große Entdeckung aus dem Jahr 1944, dem Jahr seiner ersten in die Tiefe reichenden lebensgeschichtlichen Verletzung, lautete, in einen den Begleitumständen entnommenen Satz von evangelischer Heilsintensität gefaßt: »Dies war ein Mittel gegen die Zeit, zumindest gegen ihr Vergehen.« (ebd.)
Wenn, wie Erik H. Erikson es als verbreitete Auffassung durchgesetzt hat, die geglückte Beziehung zur Mutter ein »Ur-Vertrauen« zu begründen vermag, ruft deren Mißglücken gewiß das Gegenteil hervor. Wenn die Mutter den Knaben fortgibt, vermag das Opfer dies nur als tiefste Untreue, als Verrat auszulegen. Ein »Ur-Mißtrauen« kann daraus resultieren, das dann lebenslang durch »Verträge« jener früh erfahrenen mangelnden Verläßlichkeit in allen emotionalen Beziehungen aufzuhelfen versuchen wird. Die erste, schreckliche Verlusterfahrung vermag auf der Seite des Kindes das Streben nach Bewahrung des einmal erlebten Schönen hervorzubringen. Kann womöglich ein kognitives Verhalten begründen, das zur Voraussetzung für alle Erinnerungs-Literatur gerät, ein zunächst noch magisch verstandenes Mittel zur Bannung allgegenwärtig drohenden Verlustes?
Ein Vorgriff auch auf die Jahrestage als die summa des Johnsonschen Schreibens erscheint hier am Platz. Die »Katze Erinnerung« tritt, ausführlicher geschildert, zu gerade dem Zeitpunkt in Gesines Leben ein, als Lisbeth diesem ein Ende machen will. Im zweiten Band der Jahrestage steht die folgende Beschreibung zu lesen, die die lebensgeschichtliche Genese des Katzen-Symbols poetisch konkretisiert, in Form einer Geschichte, einer Parabel fast, erzählt. Wie hatte Uwe Johnson gesagt: »Man hat kein anderes Material als seine eigenen Erfahrungen.«
Der Deckel aber war neu, den hatte Cresspahl gemacht, damit ich nicht einen Küchenschemel anschleppte und darauf ins Wasser stieg. – Wenn er fehlte, konnte das ein Versehen sein. Von einem Fremden, ja. Wer aber zum Haus gehörte, wußte das mit der Katze und mir. Es war ein großes graues Biest, massig und faul. Als Cresspahl die Pinnowsche Scheune zur Werkstatt umbaute und in der Futterkammer bei seinem Werkzeug schlief, hatte diese Katze ihn besucht und war bei ihm geblieben. [...] Ich wollte sie zum Spielen überreden; sie aber lag lieber innen am Küchenfenster und besah sich die Vögel. Sie war auch alt, nicht bloß träge. Das Kind stand oft da draußen, hatte den Kopf im Nacken, sah zur Katze hinauf und redete mit ihr, und die Katze sah mich an, als wüßte sie ein Geheimnis und würde es mir doch nicht sagen. [...] – Und deine Mutter, deine Mutter stand dabei? – Ja. Nein. Wenn ich daran vorbeidenke, sehe ich sie. Sie steht dann vor der Hintertür, trocknet ihre Hände in der Schürze, wringt ihre Hände, eins kann das andere sein. Sie sieht mir zu wie ein Erwachsener sich an einem Kinderstreich erheitert und wartet wie er ausgeht [...] – Und sie rührte sich nicht. – Da war ich längst unter Wasser. Ich hatte immer noch ihr Bild bei mir; erst dann fiel mir auf, daß in dem runden Tonnenschacht nur der Himmel zu sehen war. – Dann zog sie dich raus. – Dann zog Cresspahl mich raus. (Jahrestage, S. 617 ff.)
Johnsons »Person« Gesine, als sie noch ein Kind war und ihrerseits vom Ertrinken bedroht, erblickt die Katze, wie man etwas zum ersten Mal ansehen kann, das einem längst vertraut erscheint. Der größte aller Verluste setzt das Symboltier der Johnsonschen Erinnerungs-Literatur mit schockartiger Plötzlichkeit auf seinen Platz. Weil alle Geborgenheit als bedroht und trügerisch erfahren wird, bleibt nur, das Bedrohte im Gedächtnis aufzuheben. Daraus resultiert ein permanentes Eingedenken, entspringt die Erinnerungsliteratur, die Uwe Johnson nun zeitlebens schreiben sollte.
EINE GÖTTERDÄMMERUNG:
KRIEGSENDE UND VOLKSSTURMMANN ERICH JOHNSON
Im realen Leben des Uwe Johnson lief nun alles auf die Auflösung der »Heimschule« im Januar/Februar 1945 zu. Die NaPoLas wurden in aller Regel geordnet aufgelöst, die Schüler nach Hause überführt. Doch gab es im Osten Fälle verzweifelten Widerstands. Uwe Johnson wird noch 1975 aus diesen Tagen der Kostener Götterdämmerung erinnern, daß er die Stadt nicht mitverteidigen »durfte«. In Erste Lese-Erlebnisse hat Johnson darüber hinaus benannt, was es, neben dem blanken Leben, zuallererst vor der heranrückenden Roten Armee zu retten galt: das Buch.
Mittags ist Appell. Alle über vierzehn dürfen die Stadt verteidigen. Die unter vierzehn dürfen bis Einbruch der Dunkelheit behilflich sein im Ausheben von Panzergräben. Bei Lampenlicht sind die Jungmannen aufgestellt vor der Karte des Generalgouvernements, Hände und Rükken beherrscht durch die blaue, die Ausgehuniform, und diskutieren die geographischen Gewinne des Gegners (»der Russen«), statt sie nach den gekrümmten Pfeilen zu betrachten. Vor dem Abendessen wird die Schule geteilt, die jüngere Hälfte packt ein. Das Buch liegt im Koffer obenauf, in einem Griff erhältlich für die Rückgabe. Der Koffer steht auf den unebenen Steinen des Marktplatzes, im Schnee. (Lese-Erlebnisse, S. 108)
In Johnsons zweitem, nüchtern gehaltenem »Leipziger« Lebenslauf steht: »Ich verliess Kosten im Januar 1945 vor dem Einrücken der Roten Armee.« Während die letzten, verzweifelten Abwehrkämpfe vor sich gingen, zog Uwe Johnson mit einem Treck nach Westen. Die Trecks bewegten sich, nachdem bereits am 12. Januar 1945 der mittlere Teil der Ostfront bei Baranow zusammengebrochen war und die besetzten Gebiete Polens für die Sowjets offen dalagen, zahlreich durchs Land. Massenhafter Tod umgab sie. Die deutsche Bevölkerung aus den östlichen Gebieten floh bei schneidender Kälte nach Westen. Helen Wolff erinnert sich:
Entscheidend, und mir mehrfach erzählt, war für den Elfjährigen, der das offenbar am Straßenrand beobachtet hatte, das Zurückfluten des geschlagenen deutschen Heeres und die Flucht von Bevölkerungsmassen. Er hätte, sagt er, bis zu diesem Augenblick alles geglaubt, was man in der Schule (und wohl auch im Elternhaus) von Deutschlands Unbesiegbarkeit und dem Feldherrngenie des Führers propagiert hatte. (Wolff in: »Wo ich her bin ...«, S. 157)
In Recknitz, wo die Familie Johnson auf ihrem Weg nach Westen Zuflucht gefunden hatte, angekommen, erblickte ein jugendlicher Zeitzeuge die folgenden Bilder:
Hinter dem Gemeindewald steht ein Schloss, darin spukt es. Das ist der Tod, der dort vorspricht bei den Flüchtlingen; mit den Trecks aus dem Osten ist die Typhusseuche angekommen. Am Schloss ist ein Begräbnisplatz nur für Personen gräflichen Standes. So werden die Toten auf Erntewagen ins Dorf gebracht, wie Fracht gestapelt, wie Abfall verscharrt. Ein elfjähriges Kind sieht von der Kirchhofmauer aus heimlich zu, da rutscht das Bein einer jungen weiblichen Leiche für einen Augenblick aus der Zeltbahn, bevor der Körper aufschlägt und das schmierige Tuch zurückgezogen wird aus dem Massengrabloch. [...] Von einer Achtzehnjährigen heisst es, in bedauerndem Ton: Gerade Insa war so eigen mit dem Wasser – ein Kind versteht sofort, dass Insa liegt, krank auf den Tod, mit einer Trauer um Insa wird fortan gefälligst weitergelebt, bis zu dem Augenblick dreissig Jahre später, wenn jemand aufsteht und sich weigert, gestorben zu sein, abermals vergeblich. (Begleitumstände, S. 29)
Daß es sich, wie von P. Nöldechen vermutet, bei dem »Schloß« um das Bothmersche, bei Klütz gelegene handelte, ist eher unwahrscheinlich. Gewiß war dort bei Kriegsende ein Typhushospital eingerichtet. Doch der Knabe Johnson, von Anklam aus nach Recknitz treckend, kann schwerlich dort vorbeigekommen sein.
Die Bilder des Grauens können nichts daran geändert haben, daß Uwe Johnson den Abschied aus der »Heimschule« auch als Befreiung empfunden hat. In Anklam kann er sich, wenn überhaupt, nur wenige Tage aufgehalten und die, allerdings nicht mehr vollständige, Familie angetroffen haben. Es fehlte der zum »Volkssturm« eingezogene Vater – womit für Uwe Johnson ein »Zurückgesetztsein« als vaterloses Kind begann:
So ist es erspriesslich für ein Kind, wenn es allezeit zu sagen weiss, wo der Vater sich aufhält, tot oder lebendig; werden oder bleiben dessen Bewandtnisse ungewiss, so hat der Sohn sich zurückgesetzt zu fühlen für die Zukunft. (Begleitumstände, S. 32)
Uwe Johnson, zunächst in Recknitz und dann in Güstrow, würde von nun an nicht mehr allzeit zu sagen wissen, wo sein Vater verblieben war. Im Gegenteil: dessen Verschwinden blieb nicht nur unaufgeklärt; ihm mußten von nun an auch taktisch wohldurchdachte Äußerungen in den Lebensläufen und Schulgesprächen des Schülers gelten. Die Restitution der Vaterfigur, die Erkundung ihres Ergehens und ihrer »Schuld«: Sie mußte dem Sohn zwangsläufig zu einem weiteren Hauptmotiv seines späteren Schreibens geraten – was von der Einführung des Heinrich Cresspahl in den Mutmassungen bis hin zu den Jahrestagen gilt.
Mit Gewißheit rekonstruieren läßt sich, daß Uwe Johnsons Vater noch unmittelbar vor Kriegsende zum »Volkssturm« einberufen wurde. Der »Volkssturm« spielte vor allem an der Ostfront zu diesem Zeitpunkt eine gewisse Rolle. Es handelte sich dabei um das buchstäblich letzte Aufgebot Adolf Hitlers. Während an der Westfront inzwischen jede Motivation zur Fortsetzung fehlte, erschien das in den Landstrichen, die später die »verlorenen Ostgebiete« heißen würden, noch anders. Hier wirkte die Furcht vor der Roten Armee mobilisierend. Auf sie konnten die Strategen des »Volkssturms« bauen. Am 27. September 1944 erging Hitlers Erlaß über die Bildung des »Volkssturms« an sämtliche Gauleiter. In den letzten Septembertagen muß er auch in Anklam in Erich Johnsons Kenntnis gelangt sein. Der Stil dieses Wagner-Oper-Imitats wird dem Oberkontrollassistenten in den Ohren geklungen haben: er, dicklich gewiß und inzwischen 44 Jahre alt, erfahren vor allem im Umgang mit Rindvieh und Molkereiprodukten, sollte nun das »Versagen aller europäischer Verbündeten« ausgleichen. Und die heranrollende »rote Flut« aufhalten.
Auf diese Weise wurde der 44jährige Erich Johnson doch noch zum Soldaten. Er sollte, laut Ausbildungsordnung, den Granatwerfer »vollständig« beherrschen und seine Handgranaten im »Zielwurf« einsetzen können. Das besagte die Theorie. In der Praxis wird Erich Johnson mit einem Spaten bewaffnet gewesen sein und vielleicht noch mit einem italienischen Beutegewehr. Er wird seine braune Parteiuniform zum Einsatz feldgrau umgefärbt haben. Der Farbstoff M44 stand zu diesem Zweck in großen Mengen zur Verfügung: die einzige »Wunderwaffe«, die der »Führer« noch bis zur Produktionsreife voranzutreiben vermocht hatte. Sie werden ihm weiterhin das Soldbuch und die vorgeschriebene schwarzweiß-rote Armbinde mit der Aufschrift »Volkssturm« ausgehändigt und ihn, das war ebenfalls vorgeschrieben, nicht weit von seiner Heimat eingesetzt haben. »Nicht weit von der Heimat«: das bedeutete die Ostfront. Der Oberkontrollassistent Johnson erschien damit zu einem ordentlichen Kombattanten gemäß der Haager Landkriegsordnung avanciert. Nach deutscher Lesart. Die Sowjetarmeen sahen das anders.
DAS VERSCHWINDEN DES VATERS – EIN LEBENSRÄTSEL
Über Erich Johnsons Kriegserlebnisse wissen wir nichts Sicheres. Es ist jedoch gewiß, daß er dem Soldatentod und der Gefangennahme entging. Auch, daß er nach Anklam zurückkehrte. Erich Johnson könnte es wie dem Zeugen Hoffart ergangen sein, der seinerseits dem »Volkssturm« Kosten zugehörte:
Ausladung in Warthbrücken. Über Nacht Einquartierung in Barackenunterkunft. Am 21. 1., 4 Uhr, Ausgabe von 72 Schuß Munition je Mann. Um 14 Uhr meldete ein Posten Annäherung der Russen. Die Kp. griff den Gegner an, wurde jedoch im Gegenangriff zurückgejagt. Munition bald verschossen, zahlreiche unerlaubte Entfernungen, ein Teil der Kp. geriet in Gefangenschaft. Hoffart schloß sich mit einigen Versprengten einem Treck an.
Erich Johnson mag sich ebenfalls mit anderen Versprengten einem Treck angeschlossen haben. Jedenfalls fand der Heimkehrer seine Familie in Anklam noch vor. Das geht aus persönlichen Aufzeichnungen einer damals 22jährigen Anklamer Kindergärtnerin hervor. Mira Jaeger erinnert sich, daß ihre Familie mit den Johnsons zusammen Ende März/Anfang April 1945 von Anklam nach Recknitz treckte: und zwar mit der zu diesem Zeitpunkt noch vollständigen Familie Johnson. Man wurde teilweise auf Lastwagen der zurückflutenden deutschen Armee befördert. Führte auch eigene Fahrräder mit. Kam dabei an Plakaten vorbei mit Aufschriften wie: »Panzerfaust und deutsche Landser sind stärker als die roten Panzer!« Recknitz erreicht, stieg man bei Uwes »Onkel Milding« in der Schmiede ab. Seit dem Februar 1945 lautete, gemäß Uwe Johnsons eigenem Lebenslauf, die Wohnsitzangabe »Recknitz, Schmiede«. Milding wird 1952 sterben. Er war der NS-Blockwart des Dorfes gewesen. Die ehemalige Kindergärtnerin erinnert sich weiter:
Seine Frau, eine stattliche Person mit großflächigem Gesicht, das blonde Haar zu einem Dutt geflochten, sah ihrem Bruder, Herrn Johnson, meine ich, sehr ähnlich.
Das Willkommen war offenbar nicht allzu herzlich, insbesondere nicht für Uwe Johnson. Denn es heißt in Mira Jaegers Aufzeichnungen weiter:
Die Verwandten nahm er ja noch in Kauf, obwohl er an Uwe immer etwas auszusetzen hatte. [...] Einmal, als Uwe, was selten geschah, während eines Gesprächs etwas dazu sagen wollte, brüllte der Schmied: »Du höllst din Muul!« Andererseits, wenn Uwe auf Fragen nur nickte, kam unweigerlich: »Kriggst du din Muul nich up?«
Der Schmied und der angehende Intellektuelle scheinen einander nicht sonderlich grün gewesen zu sein.
Etwa zwei oder drei Wochen nach der deutschen Kapitulation (8. Mai), Ende Mai oder Anfang Juni also, gingen Erna und Erich Johnson noch einmal zurück nach Anklam, um zu sehen, ob »die Luft rein« und das Haus noch am Stehen sei. Von dieser Reise kam dann lediglich die Mutter nach Recknitz zurück. Denn als Erich Johnson zum Walmdachhaus in »Mine Hüsung« zurückkehrte, muß er direkt in eine Falle gelaufen sein. Die Stadt war, wie inzwischen auch Recknitz, von der Roten Armee besetzt. Dem Recknitzer Schmied geschah noch im selben Jahr 1945, allerdings nur für kurze Zeit, was Erich Johnson widerfuhr: sowjetische Haft als »Politischer« im von den Siegern übernommenen KZ Neubrandenburg. Warum nun stieß Uwe Johnsons Vater dieses Schicksal zu? »Onkel Milding« schien stärker vorbelastet und kehrte doch sehr schnell wieder nach Recknitz zurück. Erich Johnson dagegen wurde nach Rußland deportiert und starb dort 1946, im März vermutlich. Hier liegt ein Rätsel in Uwe Johnsons Biographie. Das mußte die Phantasie, auch die des Sohnes, anziehen – zumal bereits der Knabe von Onkel Mildings Schicksal und dem anzunehmenden Verschwinden des eigenen Vaters im gleichen KZ »Fünfeichen« mit Sicherheit gewußt hat.
Dieser Tatbestand zeigt sich zunächst einmal in den Lebensläufen. Der erste »Leipziger« Lebenslauf, wir haben ihn schon kennengelernt als einen, der noch die deutliche Handschrift der Mutter trug, spricht ausdrücklich davon, daß der Vater als »Mitglied des ›Volkssturms‹ gefangengenommen« wurde. Das erscheint aber als offensichtliche Irreführung. Hätten die Sowjets Erich Johnson gefangengenommen, er wäre in einem Kriegsgefangenenlager oder, das geschah Anfang 1945 noch häufiger, als Partisan vor einem Erschießungspeloton gelandet. Doch solches Schicksal blieb Erich Johnson erspart. Johnsons zweiter »Leipziger« Lebenslauf schrieb denn auch ganz nüchtern: »Mein Vater wurde bei seiner Rückkehr nach Anklam im Juni 1945 interniert.« Alle Zeugenaussagen sprechen für die zweite Version; sie kann als gesichert angenommen werden.
Erich Johnson kehrte mit seiner Frau nach Anklam zurück und wurde in »Mine Hüsung« von den Sowjets verhaftet. Danach wurde der Mann erst nach Neubrandenburg, dann nach Kowel in die Ukraine verbracht, wo er verstarb. Eine weitere, signifikante Änderung in des Sohnes Leipziger Lebensläufen weist in diese Richtung: Spricht noch der erste Lebenslauf bezüglich des Todes des Vaters von den »Aussagen eines entlassenen Kriegsgefangenen«, so korrigiert das der zweite, verfaßt vom nun mündigen Sohn, der jetzt formuliert: »nach Aussagen Zurückgekehrter«. In der Tat war jener Paul Hermann Friedrich Rammin, der dann am 27. Januar 1948 vor dem Standesamt Anklam den Tod des Erich Johnson auf seinen Eid nahm, keineswegs ein Kriegsgefangener. Ihn hatten die Sowjets vielmehr ebenfalls in Anklam interniert. Auch er gab einen »Politischen« ab, aus welchen Gründen auch immer. Im Juni war Rammin nach Rußland verbracht worden, zusammen mit Uwe Johnsons Vater. Per Postkarte würde er sich später, ein Davongekommener, bei Erna Johnson melden.
Nicht zufällig scheinen die zentralen Änderungen in Johnsons selbstverfaßten Lebensläufen stets bezogen auf das ungeklärte Schicksal des Vaters. Offensichtlich ist auch, daß die Mutter in dieser Hinsicht etwas verbergen wollte. Sie wird Rücksicht auf die Behörden der DDR genommen haben. Ein kriegsgefangener Mann erschien weniger belastend als ein »Politischer«. Doch möglicherweise bestand darin gar nicht der einzige Grund. Eine Aussage nämlich lautet:
Sie [die Familie Johnson] sind ja, bevor die Rote Armee in Anklam einrückte, ’rausgegangen aus der Stadt. Und da soll in ihrer Wohnung eine SA-Uniform gelegen haben – offen auf dem Tisch. Und es wurde gesagt, das ist ihr zuzutrauen, daß sie das aus »Gnatz« gemacht hat
– also aus Trotz, um ihre Ungebrochenheit den nun siegreichen sowjetischen Truppen gegenüber darzutun. »Nun erst recht.« Das würde selbstverständlich die Inhaftierung Erich Johnsons als »Politischer« statt als Volkssturmmann erklären. Und seine Frau hätte ihn zum Ort der Verhaftung begleitet, diese durch den Besuch in Anklam geradezu herbeigeführt? Die geschilderten Umstände ließen das Verschwinden des Vaters zu einem Geheimnis geraten, in dem »Verrat«, Versehen und Unglück gleichberechtigt – und eigentlich ununterscheidbar – nebeneinander zu stehen kamen.
»Aber«, so relativiert die zitierte Zeugenaussage ihren eigenen ersten Part, »es gab noch eine zweite Lesart. Daß das aus Wut die Hauswirtin gemacht hatte, mit der sie stets auf Kriegsfuß stand. Und das war allerdings auch eine sehr rabiate und zänkische Frau, mit der aneinanderzugeraten war nicht so übermässig schön.« Also hätten wir es mit »zwei on-dits, die einander aufheben«, zu tun. Kaum verwunderlich auch, daß »kein Mensch, jeder hat mit sich zu tun, [...] den Sachverhalt« überprüft hat. Auch in dieser Annahme hat Anneliese Klug, Uwe Johnsons Anklamer »Kindermädchen«, gewiß recht. Selbst Uwe Johnsons Schwester Elke hat sich zunächst geweigert, zur Biographie ihres Bruders beizutragen. Später, in Kenntnis der Druckfahnen dieses Buchs, hat sie die folgende Version niedergeschrieben:
Nach der Verhaftung verschwand unsere Mutter für lange Zeit, wochen-, vielleicht monatelang, so schien es mir. Wissen Sie, wo sie war? Sie reiste den Gefangenentransporten hinterher, um zu sehen, was aus ihrem Mann wird. Reisen in dieser Zeit war kein Absteigen in einem Hotel, mit ordentlichem Frühstück; reisen kann man das auch nicht gut nennen; Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung. Sie schlief in Parks und auf dem offenen Feld, zu essen hatte sie wenig, gelegentlich hat sich einer erbarmt, ihr was zu essen gegeben und manchmal ein Bett. Sie gab erst auf, als der Transport bei Frankfurt/Oder über die Grenze ging. Einmal hat sie mir einen schäbigen, schwarzen Mantel gezeigt, ihn gegen das Licht gehalten und gemeint: Ja, der hat viel aushalten müssen, diese Nächte auf dem Feld, auf der bloßen Erde. Hätten Sie so gehandelt?