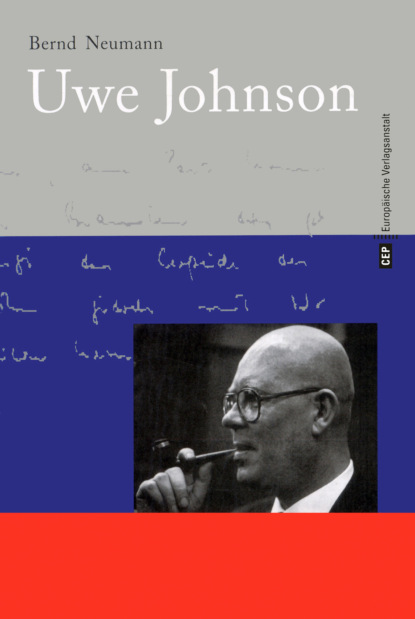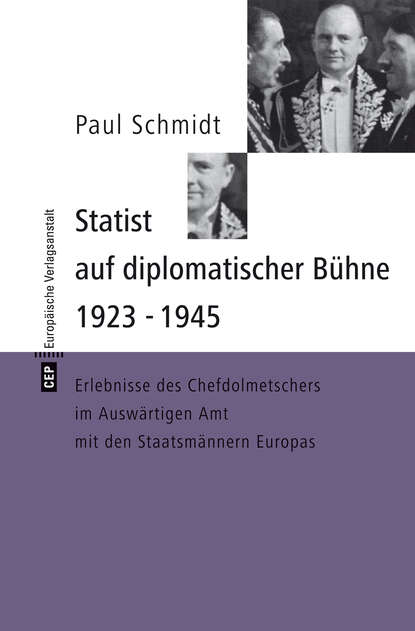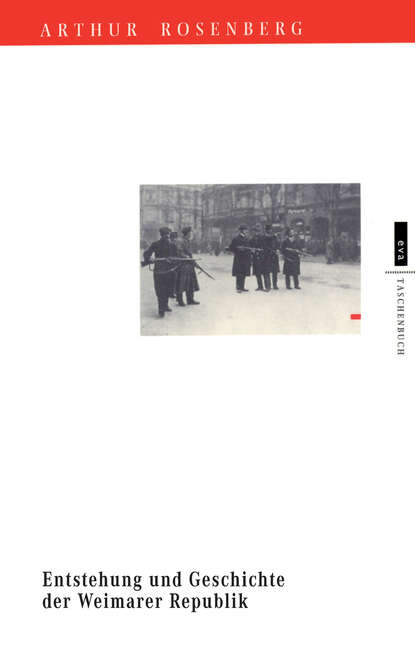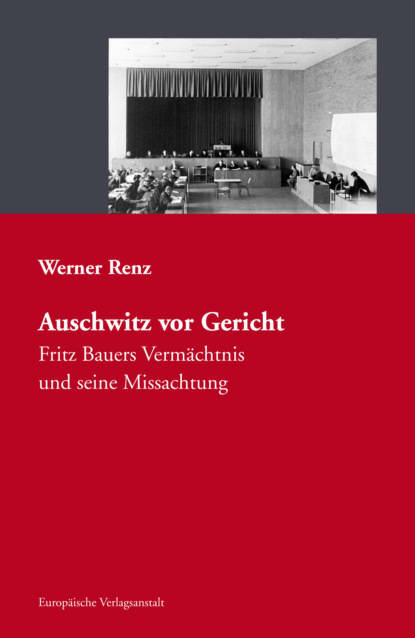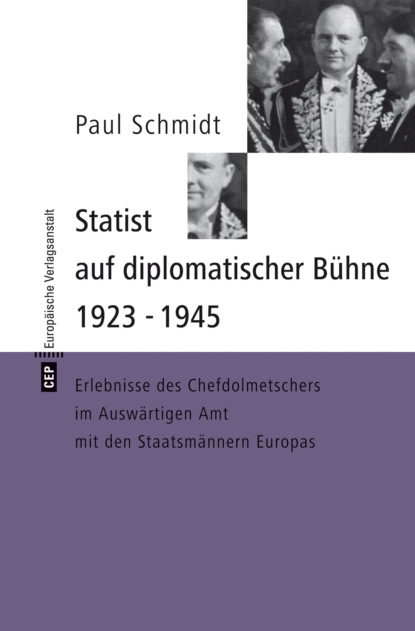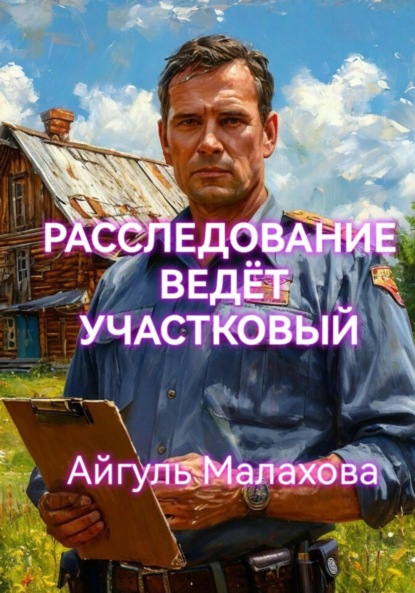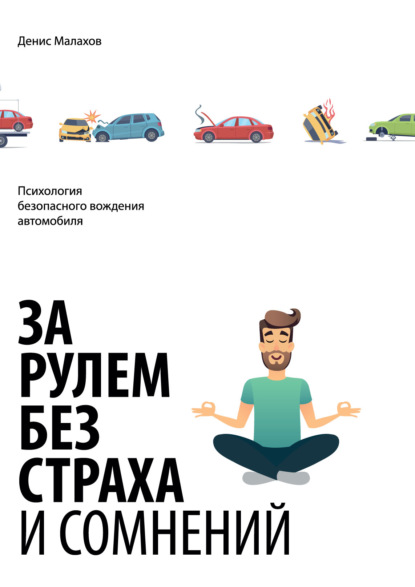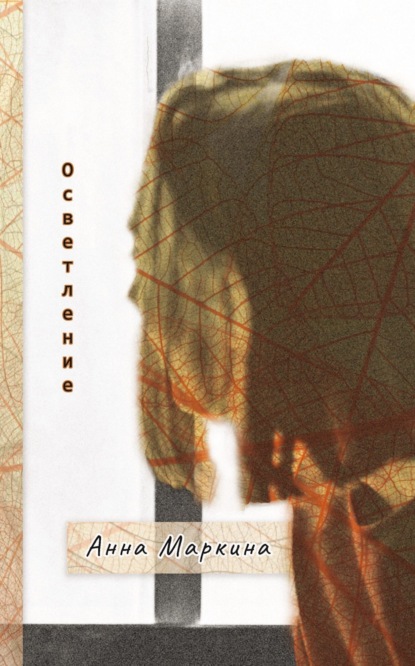- -
- 100%
- +
Johnsons letzte Adresse in Güstrow, nach der Übersiedlung von Mutter und Schwester in den Westen, lautete »Lange Stege« (auch: »Langestege«) Nr. 23. Sie liegt auf der anderen Seite der Nebel und am Rande der Stadt, unweit der Bahnlinie und gegenüber einem mecklenburgischen Walmdachhaus, das zum Vorbild für das inzwischen allseits bekannte Cresspahl-Haus geworden ist. In »Lange Stege« blieb Johnson gemeldet, bis er nach Westberlin übersiedelte, mithin auch während des gesamten Studiums. Auch diese letzte Wohnung muß ihm durch Vermittlung der Reichsbahn-Gewerkschaft zugekommen sein.
Uwe Johnson war auf diese Weise in einer Stadt angekommen, die ihn prägen sollte wie keine andere, Berlin und selbst New York eingeschlossen. In Güstrow: Stadt Ernst Barlachs, würde Uwe Johnson im eigentlichen Sinn heranwachsen, sein Abitur ablegen und dann für immer zu Hause sein wollen. Heute sehen wir in ihm den anderen großen Künstler-Sohn dieser Stadt neben Barlach. Die Stadt Güstrow liegt auf einer abgeflachten Sandfläche zwischen Nebel und Inselsee. Ihr Name leitet sich aus »Guztrowe« her, was slawisch für »Krähennest« steht. – »Gneez« in den Jahrestagen, das auf russisch »Nest« zurückgehen soll, erweist sich somit auch etymologisch als ein Güstrower Pendant. Die Stadt besitzt ein klassizistisches Rathaus aus der Mitte des 18. Jahrhunderts und ein seit 1961 restauriertes Renaissanceschloß. Ihre eigentliche Geschichte beginnt im 13. Jahrhundert. Fürst Heinrich Borwin II. ließ an ihrem Platz, auf damals noch wendischem Gebiet, eine landesherrliche Burg errichten. Denn dort verliefen die Handelsstraßen zwischen Rostock und Brandenburg, zwischen Lübeck und Pommern. Im Jahr 1228 erhielt Güstrow seine Stadtprivilegien ausgefertigt. Bereits im 13. Jahrhundert entstand die noch heute erhaltene, vom Schüler Johnson erlebte städtebauliche Struktur der Stadt mit ihren rundum laufenden Befestigungs- und vier Toranlagen. Insonderheit die alte Stadtmauer, ihre Reste verlaufen direkt neben der Brinckman-Schule, wird später wiederkehren in Ingrid Babendererde.
1503 zerstörte eine Feuersbrunst die Stadt. Sie wurde danach wieder aufgebaut und diente bis 1695 als Residenz mecklenburgischer Herzöge. Wallenstein residierte 1628/29 in Güstrow. An sein Hofgericht erinnert eine Tafel unweit von Dom und Brinckman-Gymnasium. Der 1226 begonnene Backstein-Dom stellt seinerseits den Mittelpunkt und das Wahrzeichen der Stadt dar. Ein Muster norddeutscher Backsteingotik, wurde er von Heinrich Borwin II. als Kollegialskirche gestiftet und zwischen 1226 und 1500 als dreischiffige, kreuzförmige Pfeilerbasilika errichtet. Im Jahr 1660 waren 2435 Einwohner registriert. 1802 dann werden es 6542 Einwohner in insgesamt 778 Häusern sein. 1806 wurde Güstrow von Napoleons Truppen auf ihrem Zug nach Rußland besetzt und geriet danach in den »Befreiungskriegen« zum Zentrum der deutsch-patriotischen Erhebung. In Güstrow versammelten sich die Freiwilligen Jäger Mecklenburgs, um gegen den welschen Feind ins Feld zu ziehen.
Von 1849 bis 1870 lebte der niederdeutsche Dichter und Lehrer John Brinckman in der Stadt. Das zentrale, traditionsreiche Gymnasium wird später auf seinen Namen getauft. Als er stirbt, hat die Stadt bereits 11 000 Einwohner. Und später in den dreißiger Jahren dann wohnte und arbeitete der Bildhauer und Schriftsteller Ernst Barlach am Inselsee in der Nähe der Stadt. Er vereinsamte zunehmend im Güstrow des »Dritten Reiches«, bis er 1938, fast völlig isoliert, starb und in Ratzeburg begraben zu sein wünschte. In den Jahrestagen hat Uwe Johnson dieses deutschen Künstlerschicksals gedacht:
Am 27. Oktober starb Ernst Barlach, Bildhauer, Zeichner, Dramatiker. Weil er für einen Juden gehalten wurde, war er in Güstrow auf der Straße angespuckt worden. Den hatten sie mit Verboten von Arbeit und Ausstellungen gehetzt, bis er sich hinlegte und starb. Die Lübecker hatten einen Alfred Rosenberg zu ihrem Ehrenbürger gemacht, aber die Figuren Barlachs hatten sie nicht an ihre Katharinenkirche getan. Der Lübecker General-Anzeiger hatte zu seinem Tode nicht von sich aus etwas drucken mögen, sondern lieber aus dem Berliner Tageblatt abgeschrieben, er sei ein Problem geblieben für ein Geschlecht, das andere Wege gegangen sei. (Jahrestage, S. 712)
Das Güstrow, in das die Johnsons 1946 kamen, gehörte später als Kreisstadt zum Bezirk Schwerin, konzentrierte Schulen und Ausbildungsstätten in sich. Industriestadt war der Ort nie gewesen. Dafür hatte die Stadt in den zwanziger und dreißiger Jahren den Ruf eines »mecklenburgischen Paris« genossen. Seit 1955 existierte ein Stadtmuseum, 1978 dann wird das Atelierhaus Barlachs am Fuß des Heidbergs, unweit des Inselsees, der Öffentlichkeit übergeben. Zwischen 1972 und 1978 werden der Marktplatz umgestaltet, Fußgängerzonen errichtet und die Innenstadt wird mit Blick auf die 750-Jahr-Feier renoviert. 1981 schließlich erhielt Güstrow vielbeachteten Besuch: Erich Honecker und Helmut Schmidt statteten der Stadt gemeinsam eine Visite ab.
Im Dom der Stadt hängt seit 1952 Der Schwebende, Barlachs berühmter Engel mit dem Käthe-Kollwitz-Gesicht. Die Nazis hatten die Plastik als »entartet« verworfen und zu Rüstungszwecken eingeschmolzen. Die spätgotische Gertraudenkapelle fungierte dann als Barlach-Gedenkstätte, aber das auch erst als eine Art von Wiedergutmachung: nachdem nämlich die SED noch 1951 Barlachs Werk als »formalistisch« verdammt und seine Berliner Ausstellung geschlossen hatte. Das wechselvolle Geschick von Barlachs Nachruhm spielte sich am Beginn der fünfziger Jahre im Klassenraum und vor der Haustür Uwe Johnsons ab. So versetzte der letzte Wunsch des Erich Johnson: sein Sohn solle einmal die berühmte Brinckman-Schule in Güstrow besuchen, diesen mitten in die Kunstauseinandersetzung der frühen fünfziger Jahre. Davon wird anläßlich von Uwe Johnsons Abitur noch ausführlicher zu handeln sein.
Im Güstrow des Jahres 1946 mußte die Mutter versuchen, sich neu zu etablieren, ihre beiden Kinder durchzubringen. Das hat die Bauerntochter ohne besondere Berufsausbildung mit dem ihr eigenen, auch bewunderungswürdigen Einsatz getan. Im ersten »Leipziger« Lebenslauf von wahrscheinlich 1952, der Studienakte beigefügt und fast als Selbstdarstellung Erna Johnsons zu lesen, steht über ihre Berufskarriere in Güstrow geschrieben:
Meine Mutter, ursprünglich ohne erlernten Beruf, ist heute Zugschaffnerin am Bahnhof Güstrow. [...] Meine Mutter sah sich vor die Aufgabe gestellt, unserer Familie eine neue Existenzgrundlage zu schaffen. Nach einem mit Erfolg beendeten Lehrgang als Kindergärtnerin war sie zeitweilig Praktikantin am Landeskinderheim Güstrow und darauf Näherin bei der »Volkssolidarität« der Roten Armee und den Güstrower Kleiderwerken VEB.
Erst einige Zeit nach der Umsiedlung also ging Erna Johnson zur Reichsbahn, vermutlich um der etwas besseren Bezahlung und vor allem um der Dienstwohnung willen. Sie baute unter schwierigsten Verhältnissen eine neue Existenz auf. Brachte erhebliche persönliche Opfer für das Fortkommen ihrer Kinder. Wechselte 1952 sogar vom Dienst als Personenzugschaffnerin zu dem einer Güterzugschaffnerin, um Uwes Stipendium zu erhöhen und ihm seine weitere Laufbahn als die eines »Arbeiterkindes« zu ebnen. Mithin ein Berufswechsel, in dem sich auch die sozialdarwinistische Sichtweise der DDR-Behörden spiegelt. Aus Uwe Johnsons Leipziger studentischer Personalakte vom Herbst 1956 kann man lernen, daß die sozialistischen Verwalter das ihnen übergebene Volk in zehn Kategorien einteilten. Die staatliche Zuwendungsskala schaute aus wie folgt: 1. Arbeiter 2. Landarbeiter 3. Werktätiger, Bauer 4. Schaffende Intelligenz 5. Angestellte 6. Selbständige Handwerker 7. Selbständiges Gewerbe 8. Freie Berufe 9. Großbauern 10. Sonstige.
Uwe Johnson stufte sich, Ironie oder nicht, unter »Sonstige« ein. Den Vater führte er unter Kategorie fünf auf. Die Mutter aber wechselte von der Kategorie fünf in die Kategorie eins. Am 20. Januar 1955 verfügte Erna Johnson über ein Monatsgehalt von 263 Mark. Ausgezahlt wurde es ihr vom Bahnbetriebswerk Güstrow. Der Wechsel der Klassenzugehörigkeit, dessen psychologische Probleme Jonas Blach in den Mutmassungen erörtern wird, als er mit dem Gedanken spielt, als Rangierer vor der politischen Verfolgung wegzutauchen, brachte ihrem Sohn eine Erhöhung des Stipendiums von 130 auf 180 Mark ein. Und ebnete ihm (und prospektive auch seiner Schwester) die weitere Studienlaufbahn.
Doch gerade der zum »Arbeiterkind« avancierte Uwe Johnson sollte sich seiner Mutter zunehmend entfremden. Schon um das Jahr 1948 herum erwähnt der Schulfreund Lehmbäcker Erna Johnson als eine intelligente, aber zunehmend verstörte Frau, die sich deutlich verunsichert fühlte in der Gegenwart ihres opponierenden Sohnes. Ingrid Babendererde im gleichnamigen Buch denkt an Frau Petersen wie folgt:
In Petersens Guter Stube, und seine Mutter ging redend von einem Zimmer ins andere, ohne Aufenthalt redend nach ihrer schrecklichen Weise. (Babendererde, S. 56)
Die Entfremdung hatte neben ideologisch-politischen Gründen vor allem private. Erna Johnson hatte ihrem Sohn das Flüchtlingsmädchen verboten. Sie selbst jedoch hatte wohl im Jahr 1948 eine Affäre mit einem zudem noch verheirateten, kinderreichen Mann gehabt. Der Sohn hat das als schrecklichen »Verrat« am verschwundenen Vater aufgefaßt. In den Jahrestagen, vierter Band, kann man lesen:
Ein beeinträchtigtes Kind. Wichtiger noch als Möbel bei all den Umzügen war eine gerahmte Fotografie des Vaters, ein vergrößertes Führerscheinbild; die Nietösen deutlich sichtbar. Frau Lockenvitz war aber erst fünfunddreißig Jahre alt, als ihr Mann zum Letzten Mal »gesehen wurde«; sie nahm aus seinem Nachlaß nur den Auftrag, den Jungen bis vor die Tür einer Universität zu bringen. (Der Vater hatte Agrarbiologie studiert.) Deswegen war nach dem Fasching 1949 im Schaufenster der Drogerie Mallenbrandt ein erzählendes Foto zu sehen von der Festlichkeit: eine junge Frau, die Brüste zusammengequetscht im Décolleté. Ein Kind, das sich schämt. Ein Sechzehnjähriger, der von seiner Mutter geschlagen wird, weil er nach nächtlichem Herrenbesuch das Bild des Vaters von der Wand nimmt und versteckt; weil sie sich schämt vor dem Kind. Lockenvitz hatte, in einer Zeit knapp an Elektrozubehör, über einem Fenster der Wohnung eine Klingel aufgehängt von jenem Schlitten, der im Osten verblieben war, sie erreichbar gemacht mit eingepichtem Sacksband, so war er aus auf Besuch; nun schraubte er sie ab: überhörte Klopfen an der Tür. (Jahrestage, S. 1724)
Sie hatten es beide nicht leicht. Der strenge Sohn nicht, und nicht die noch lebenslustige Mutter. Ein benachteiligtes Kind und eine benachteiligte Mutter zu Ende der vierziger Jahre dieses Jahrhunderts in Güstrow, das da gerade von der einen in die andere Diktatur überging. Eigentlich waren sie bereits voneinander getrennt: Deshalb zieht sich, wie im Erstling geschrieben steht, auch ein »Riß« durch das Namensschild der Petersens.
POLITISCHE NEUORIENTIERUNG UND STALINKULT.
SZENEN AUS DER »NEUEN SCHULE«
Der geschilderte private Dissens beförderte seinerseits die politische Umorientierung des seit 1949 »freien deutschen Jungen« Uwe Johnson. Immer konsequenter wird der Schüler Johnson zum politischen Kritiker der Erwachsenen. Die neue Ordnung schien ihm anfangs gerechtfertigt durch die kriegsverbrecherische Barbarei des »Dritten Reichs«, die zu erkennen die »Neue Schule« ihre Schüler so rigide wie unabweisbar lehrte. Daß der Jüngling glaubte, diese Erkenntnis zu Hause in der Feldstraße durchsetzen zu müssen, brachte Züge juveniler Selbstgerechtigkeit ins Spiel. Uwe Johnson mag Ausgang der vierziger Jahre ganz als das Produkt eines Schulunterrichts agiert haben, der den Nationalsozialismus durchgehend als die Sache »der anderen« behandelte. Die Mutter wird dabei zu diesen »anderen« gezählt haben. Dies legen die Begleitumstände nahe, die unter Hinweis auf Stalin durchaus selbstkritisch festhalten:
Mit der schauerlich unbeugsamen Moral des Jugendlichen, der Schuld für sich als künftige Erfahrung ausschliesst, war dieser Jossif Wissarionowitsch angenommen als der Sieger. (Begleitumstände, S. 41)
Daß die »Neue Schule« ihrerseits Personenkult betrieb, lag im Bewußtsein des Schülers als ein »Stück Natur in der Einrichtung der menschlichen Gesellschaften« beschlossen. Vollends in den Mittelpunkt des Schulunterrichts rückte Stalin, seit Johnson im September 1948 auf die John-Brinckman-Oberschule gewechselt war. Diese Anstalt würde die Babendererde prägen und darüber hinaus auch den Abschlußband der Jahrestage. Hier hatte die »Neue Schule« sich durchgesetzt und erhebliche personelle Konsequenzen gezeitigt. Der hochverehrte alte Englischlehrer Wilhelm Müller, er hatte sein Englisch noch in Oxford erlernt (und wird als Kliefoth in den Jahrestagen wieder auftauchen: Kliefoth-Kleiefuß-der mit dem weißen Fuß, also Müller). Wilhelm Müller war damals schon als Direktor der Schule abgesetzt. Wartete – wie dann Sedenbohm in der Babendererde – resigniert auf seine Pensionierung. Darüber steht im zweiten Band der Jahrestage zu lesen:
Nach dem Krieg amtierte Dr. Kliefoth als Direktor der Gneezer Oberschule und hatte für Englischstunden nicht Zeit. An seiner Stelle unterrichtete Frau Dr. Weidling, bis die sowjetische Spionageabwehr herausgefunden hatte, daß ihr Mann nicht Hauptmann bei den Panzern, sondern bei der Abwehr gewesen war und sie ihre Beherrschung der Sprache den Auslandsreisen verdankte, auf die Weidling sie mitgenommen hatte. Da war Kliefoth längst abgesetzt, auch als Lehrer. Englisch wurde dann bis zum Abitur gegeben von einem Junglehrer, der den Vornamen Hansgerhard trug. Er war nicht in England gewesen und erklärte der schweigenden Klasse, daß seine Professoren auf der Universität Greifswald ihm gelegentliche Abweichungen in der Aussprache freigestellt hätten, wenn er die britischen Schallplatten nicht habe nachmachen können. Seine Begründung sei gewesen: er höre das anders. Es war seine erste Lehrerstelle, und es war sein erster Fehler. Danach wies er auf seine Jugend hin und bat die Schüler, sie trotz ihres Rechts auf den Nachnamen mit dem Vornamen anreden zu dürfen; er erwähnte den Neuen Geist der Neuen Schule. Lise Wollenberg meldete sich. – Aber gern, Hansgerhard: sagte sie. Heinz Wollenberg galt noch als Stütze der Gesellschaft, und Lise bekam von dem jungen Mann die Entschuldigung für seinen Wutausbruch. Nach diesem dritten Fehler nannte er nicht mehr alle beim Vornamen. Bei ihm wurde nicht »Der goldene Käfer« von Edgar Allan Poe gelesen. Er nahm durch »Ist der Krieg unvermeidlich?« von Jossif Stalin. (Jahrestage, S. 777 f.)
Der Generalissimus Jossif Stalin betrat auf diese Weise also sogar noch den Englischunterricht. »Zwei Bilder« hat Johnson das entsprechende Kapitel der Begleitumstände überschrieben. Das offizielle Stalin-Porträt erscheint im Buch abgedruckt, eine Ehre, die Adolf Hitler nicht widerfahren konnte. Die seitenlange, von erbittertem Sarkasmus getragene Beschreibung verrät, wie eindrücklich dieses Bild auf Johnson gewirkt haben muß:
In der Stadt, vom Hörensagen im Dorf bekannt, erschien das zweite Bild. Der werte Name war Stalin, J., Josef. Jossif Wissarionowitsch. Im Bilde wurde er meist gezeigt nach der Manier seines Portraits auf dem Frontispiz seines Standardwerkes »Über den Grossen Vaterländischen Krieg der Sowjetunion«, Verlag für fremdsprachige Literatur, Moskau 1946: ein fülliger Mann mit frappierend glatter Uniformbrust, an einen Harnisch gemahnend, mit wenig Hals im verzierten Kragen und einem straffen Gesicht (keinerlei Pockennarben), das merkbar wurde durch die behagliche Behaarung über Stirn und Schläfen, über den Augenbrauen und unterhalb der Nase. Der Mann, dargestellt in der Verfassung eines fünfzigsten Lebensjahres, tatsächlich den Siebzig nah, liess sich sehen im Halbprofil, den starr glänzenden Blick abwendend auf etwas Erheblicheres als den Betrachter, mit auffällig senkrecht hängenden Armen, als sei er schon längere Zeit unbeweglich und werde so verbleiben, einem Denkmale zu Lebzeiten gleich. [...] Spätestens im Jahre 1950 hatte man sich befriedigend auszukennen in seiner »Kurzen Lebensbeschreibung« von immerhin 158 Seiten, von seinem Geburtstag am 21. Dezember 1879 neueren Stils, dem Abonnementsanlass für die letzte Schulversammlung vor den Weihnachtsferien, bis zu den Schlussfolgerungen, Garantien für edle Noten im Jahreszeugnis. (Begleitumstände, S. 35)
Soweit die politische Panegyrik, mit der sich Stalin in seinen neu errichteten Satrapenstaaten und also auch in der DDR und in Güstrow feiern ließ. Ein Jugendlicher konnte, ja mußte vielleicht dadurch erneut verführt werden. Mit gütigem und unbewegtem Blick schaute der Woschd in die kommenden Jahre des Schülers Uwe Johnson alias Lockenvitz alias Jürgen Petersen hinein – auf ewiges Bleiben eingerichtet. Die Regeln für die Kunstbetrachtung, die dann Professor Shdanow im Namen des Georgiers verkündete (und die Professor Lukács in der DDR populär machen sollte), würden sich als umstandslos austauschbar mit denen erweisen, die man Uwe Johnson noch im Kunst- und Werkunterricht der Kostener »Heimschule« beigebracht hatte. Die neuen Zeiten erwiesen sich irgendwo ganz als die alten. »Pius« Siebmann in der Babendererde wird immer dann zu seiner wahren Lebendigkeit gelangen, wenn er aus den Zeiten der Hitlerjugend erzählt. Auch Uwe Johnsons Abituraufsatz wird diesen Sachverhalt unfreiwillig demonstrieren.
DIE JOHN-BRINCKMAN-SCHULE IN GÜSTROW
Uwe Johnson als Schüler der »Neuen Schule«, der durchaus willig erschien, Neues zu lernen: Alles spricht dafür. Erst einmal mußte er sich 1949, also bereits auf der Brinckman-Oberschule – die, wie erinnerlich, noch der Vater für ihn gewünscht hatte –, öffentlich von der »faschistischen« Vergangenheit eben dieses Vaters lossagen. Auch dies gehörte zum Stil der neuen Zeit. Uwe Johnson hat dieses Faktum in seinem – bis dato unveröffentlichten – »Merkbuch« festgehalten. Das war nicht ausschließlich eine erzwungene Handlung. Der Oberschüler wird den versprochenen Neuanfang zunächst durchaus gewollt und das Wiedergutmachen der Fehler der Eltern, die endliche Korrektur der Fehlläufe deutscher Geschichte mit jugendlicher Unbedingtheit angestrebt haben. Nahezu manichäische Vorstellungen vom Anbruch einer gänzlich neuen Zeit repräsentierten eine verbreitete Hoffnung in jenen Tagen. Und Uwe Johnson erschien zudem für diese Form von politischem Messianismus empfänglich gemacht durch seine Erziehung auf einer der »Heimschulen« Adolf Hitlers. Wie immer die beiden Totalitarismen unterschiedliche Inhalte haben mochten: Sie setzten doch auf weitgehend identische Formen von Indoktrination und Knabenabrichtung.
Ohnehin steht der Oberschüler Johnson zu dieser Zeit, Ausgang der vierziger Jahre, als ein eifriger Schüler vor uns: ein Primus-Typ. Axel Walter, später Superintendent an Güstrows Dom, seit 1948 Uwe Johnsons Schulkamerad in den ersten Klassen der Brinckman-Oberschule, erinnert ihn als einen, dessen Leistungen im Englischen, Deutschen und Lateinischen bereits damals auffallend gut gewesen waren. In Gesprächen mit Walter tritt der Schüler Johnson wie der Schüler Lockenvitz im vierten Band der Jahrestage auf als einer, der aus großem Wissen heraus die Lehrer gern ironisch kritisierte. Dieser Schüler erschien durchaus ambivalent in seinem Wunsch nach Anerkennung einerseits und seiner Profilierung als Oppositioneller andererseits. Dies galt vor allem für den Englischunterricht bei »Hg. Knick«, daneben für den Deutschunterricht bei der »Junglehrerin« Liselott Prey, die an der Oberschule in Güstrow genannt wurde, wie später die Deutschlehrerin in Johnsons erstem literarischen Werk von ihren Schülern geheißen wird: »Das Blonde Gift«. Ein Einzelgänger und Schweiger, wirkte Johnson leicht »erhaben über seine Schulkameraden«. Er war aber deutlich bemüht, diese das nicht merken zu lassen. Entsprechend vielfältig waren seine Aktivitäten mit dem Ziel, dieser Schülergemeinschaft mit anzugehören.
Der schlaksige Schüler, er wird dann dem Klaus Niebuhr in der Babendererde den Berufswunsch eines Dramaturgen zuschreiben, spielte in einer Tschechow-Aufführung der Klasse neben Heinz Lehmbäcker, Fritz Möllendorf und Hans-Joachim Petersen mit. Lehmbäcker erinnert, daß Uwe Johnson selbst Pläne hatte, an Brechts Berliner Theater als Dramaturg zu beginnen. Einen leidenschaftlichen Teilnehmer stellte Uwe Johnson, neben dem nachmittäglichen Baden im Sumpf-See, auch im Rahmen der eher jugendbewegten Freizeit-Aktivitäten dar. Dabei ging es ums Wandern und Zelten an einem der zahlreichen Seen. Daß man überwiegend mit dem Rad unterwegs war, erhöhte den Radius dieser Ausflüge. Sommersprossig und mit kurz geschnittenem, zum Teil widerspenstig abstehendem Haar – noch immer: ein »Lockenvitz« – fuhr Johnson überhaupt viel Rad, schwamm gern und sehr gut, setzte seine »Rekorde« beim Austragen von Eilpaketen der Deutschen Post. Und zeigte, wie Axel Walter sich entsinnt, vitales Interesse an einem Materialismus-versus-Idealismus-Streit, in dem er vehement die Position der Materialisten verfocht. Alles in allem Interessen, die sich in den Klausuren des Leipziger Studenten, der Otway-Klausur zumal, wiederfinden werden. Da freilich treten sie bereits systematisiert und auf wissenschaftlichem Niveau auf. Zu rühmen war der Gerechtigkeitssinn dieses Schülers. Er sah auf Fairneß in der Diskussion und schlug sich in aller Regel auf die Seite der Schwächeren, selbst wenn er deren Ansichten nicht teilte. Der Oberschüler Johnson gab sich, so die Aussage dieses Kirchenmannes, als ein junger Atheist, der der Kirche sehr reserviert gegenüberstand. Die Konfirmation lehnte er gegen den Wunsch der Mutter ab. Und immer noch hielt Uwe Johnson seine häusliche Sphäre gegenüber den Mitschülern abgesondert: Die Mutter Erna Johnson hat Axel Walter gar nicht kennenzulernen vermocht.
All diese gesellschaftliche Aktivität verhinderte jedoch nicht das Lesen. In seiner Antwort auf eine Anfrage der Stadtbibliothek Hannover vom 29. Juli 1982 wird Johnson sich erinnern:
Mit der Lektüre von Büchern, die in der Zeit vom Mai 1933 bis 1945 in Deutschland verboten wurden, habe ich 1948 angefangen, nach dem Lehrplan für die Oberschulen in Mecklenburg-Vorpommern, damals sowjetisch besetzte Zone. Aus dem dazugehörigen Lesebuch für den Deutschunterricht erinnere ich ein Gedicht von Albert Ehrenstein. Zum fakultativen Lehrstoff gehörte Unter fremden Himmeln, ein Abriss der deutschen Exilliteratur von F. C. Weiskopf, 1948 in Ostberlin erschienen; geduldet wurde eine Zeitlang die Anthologie Verboten und verbrannt, herausgegeben von Richard Drews und Alfred Kantorowicz, 1947 verlegt in München und Westberlin. Eine Auswirkung solcher Lektüre auf die literarische Produktion eines Vierzehnjährigen [...] werden Sie wohl selbst ausschliessen.
Womit Uwe Johnson bestätigte, daß er damals, als Vierzehnjähriger, bereits eine literarische Produktion betrieb, von der allerdings nichts überliefert zu sein scheint. Des weiteren las man Neuland unterm Pflug von Michail Scholochow oder Stalingrad von Theodor Plivier. Daneben sind dem Mitschüler Walter von Johnsons ausgedehnter Klassiker-Lektüre Balladen und überhaupt Gedichte von Goethe in Erinnerung geblieben.
DAS MITGLIED DER »FREIEN DEUTSCHEN JUGEND«.
EIN ZEITBILD
Kein damaliger Oberschüler, wollte er eine Zukunft im Sozialismus besitzen, kam um die Mitgliedschaft in der »Freien Deutschen Jugend« herum. Uwe Johnson mag diese am Anfang sogar gewünscht haben. Wir befinden uns im Jahr 1949, mithin noch ganz in den Anfängen der FDJ. Diese waren, wie sich Hans Mayer in seinen Lebenserinnerungen entsinnt, nicht zuletzt geprägt von unabweisbar Patriotisch-Humanistischem, dem Erbe der Mozart und Goethe. Auf einen wie den Oberschüler Johnson wird das seine Anziehungskraft nicht verfehlt haben.
Johnson stand in einer für diese Jahre und für ihn nicht ungewöhnlichen Double-bind-Situation. Er hatte sich als Mitglied in die FDJ gemeldet. Doch diese Mitgliedschaft führte zugleich zur unheimlichen Bekanntschaft mit den Praktiken damaliger »proletarischer Staatsmacht«. Die Erfahrung mit der Stasi und mit Hilde Benjamins »sozialistischer« Terrorjustiz dieser Jahre wird Uwe Johnson später am Beispiel der Figur des Lockenvitz im vierten Band der Jahrestage beschreiben. Auch die Begleitumstände verdeutlichen die Ambivalenz seiner Karriere als »Jugendfreund«.