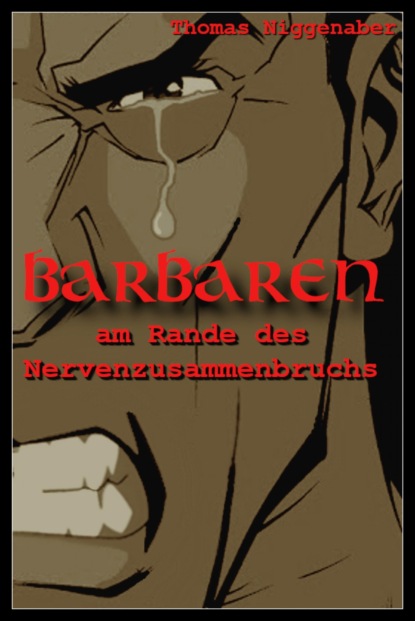- -
- 100%
- +
Die selbst ernannten Frauenrechtlerinnen sahen betreten und schweigend zu Boden. Offenbar vermochten sie es nicht, den Ausführungen Tisshas irgendwas entgegenzusetzen. Nur Sosshas Streitlust schien noch ungebrochen zu sein.
»Was du sagst, stimmt leider nicht so ganz«, verkündete sie trotzig und mit siegessicherer Miene. »Es gibt da etwas, das ausschließlich den Männern vorbehalten ist. Warum genießen nur sie das Privileg, unterdrückt zu werden? Was ist, wenn sich auch eine Frau in die Sklaverei begeben möchte? Wird uns dieses Recht auf freiwillige Knechtschaft etwa nicht verweigert?«
Tissha legte ihren Kopf leicht schräg und formte ein mitleidiges Lächeln mit ihren vollen Lippen. »Ernsthaft, Sossha? Jetzt wird es aber wirklich lächerlich, oder?«
Sie sprach nicht weiter, weil etwas an der rothaarigen Amazone ihre Aufmerksamkeit erregt hatte. Sie trat ganz nahe an selbige heran und untersuchte ihr Gesicht mit zusammengekniffenen Augen.
»Was hast du denn da?«
»Wo?« Sossha betastete vorsichtig ihre Wangen. Als eine ihrer Fingerspitzen auf eine kleine, rötliche Erhebung stieß, riss sie ihre Augen weit auf. »Was … was ist das?«
Ihre Begleiterinnen taten es Tissha gleich und mit neugierigen Blicken taxierten sie das Antlitz ihrer Rädelsführerin.
»Das ist ein Pickel!«, stellte die Amazone in der weit ausgeschnittenen Tunika plötzlich voller Bestürzung fest.
Alle anwesenden Frauen wichen vor Sossha zurück, als wäre sie soeben in Flammen aufgegangen. Einige schlugen sich entsetzt ihre Hände vor den Mund, andere begannen sogar hysterisch zu kreischen. Selbst Khelea zuckte erschrocken auf ihrem Thron zusammen.
»Das ist unmöglich!«, rief sie erschüttert. »Wir sind Amazonen – wir bekommen keine Pickel!«
Auch Tissha hatte sich rückwärts ein paar Schritte von ihrer Freundin entfernt. »Aber da ist einer, ganz eindeutig! Ich habe solche Wucherungen schon mal bei Männern gesehen.«
»Das ist ja schrecklich!«, schluchzte nun die brünette Amazone mit bebender Stimme. Die Furcht trieb ihr die Tränen in die Augen »Ist das etwa ansteckend? Könnten wir etwa auch solche widerwärtigen Verunstaltungen bekommen?«
Das erste Mal seit Anbeginn der Zeit sahen sich die Amazonen mit einer Hautunreinheit konfrontiert. Die anwesenden Frauen gerieten aufgrund dessen in Aufruhr. Sie plapperten wild durcheinander, verliehen lautstark ihrer Besorgnis Ausdruck oder stellten Vermutungen darüber an, wie es zu der Deformation Sosshas kommen konnte. Stimmen wurden laut, dass es jetzt vielleicht sogar zu weiteren, anderen Missbildungen kommen könnte. Grauenerregende Wörter wie Krähenfüße, Tränensäcke oder gar Krampfadern wurden hinter vorgehaltener Hand geflüstert.
Die Geschädigte selbst sah indes hilfesuchend um sich. Ganz eindeutig hatte sich eine leichte Panik ihrer bemächtigt, wofür unter den gegebenen Umständen auch wirklich jede Amazone Verständnis gehabt hätte. Nach einer Weile gelang es ihr jedoch, ihre Fassung wieder zu erlangen. Beeindruckt stellte Tissha fest, dass Sossha nun sogar versuchte, einen Nutzen aus ihrem furchtbaren Schicksalsschlag zu ziehen.
»Da könnt ihr mal sehen, liebe Schwestern, wie sehr wir in dieser Gesellschaft auf unser Äußeres reduziert werden!«, rief sie in der Absicht, das eigentliche Thema dieser Zusammenkunft wieder in den Vordergrund zu rücken. »Seht doch nur, wie immens euch mein kleiner Makel verunsichert. Das ist das Ergebnis eines völlig übertriebenen Schönheitswahns, der uns Frauen seit unserer Geburt aufgezwungen wird. Wollt ihr euch etwa weiter diesem Diktat beugen?«
Die von ihr erwünschte Resonanz blieb aus. Zu geschockt waren ihre Mitstreiterinnen von dem Anblick ihres entstellten Gesichts. In ihren Köpfen gab es neben ihrer Betroffenheit und Furcht derzeit keinerlei Platz für andere Gedanken.
»Gib es auf, Sossha«, forderte die Königin deshalb mit triumphierendem Lächeln. »Für deinen Gleichberechtigungs-Mumpitz interessiert sich hier nun wahrlich niemand mehr.«
Mit kraftvoller Stimme wandte sie sich an die anderen Anwesenden. »Aber, liebe Schwestern, was sollen wir jetzt tun? Wir wissen nicht, was Sossha befallen hat. Ist es eine Krankheit? Vielleicht sogar eine Seuche? Wäre es ratsam, Sossha frei herumlaufen zu lassen, obwohl wir nicht wissen, woran sie leidet und ob es ansteckend ist?«
Sie warf ihrer Tochter einen vielsagenden Blick zu und diese verstand sofort, was ihre Mutter nun von ihr erwartete.
Während im Saal über die Fragen der Königin nachgedacht oder beratschlagt wurde, trat Tissha vor ihre ahnungslos dreinblickende Freundin. Mit einem kurzen Blick in die Runde vergewisserte sie sich davon, dass Sossha auf keinerlei Beistand der anderen Kriegerinnen mehr zählen konnte.
»Tut mir echt leid, Herzchen«, drückte sie dann ihr aufrichtiges Bedauern aus.
Mit einem kraftvollen, technisch einwandfrei ausgeführten Kinnhaken schickte sie die rothaarige Amazone anschließend zu Boden. Die anderen Frauen verstummten und sahen auf die Bewusstlose herab.
»Bringt sie in ihre Gemächer!«, befahl die Königin. »Sperrt sie dort ein, bis wir mehr über ihr seltsames Leiden herausgefunden haben. Nehmt aber den Hinterausgang, die Menge vor dem Palast soll von alledem nichts mitbekommen.«
Mit ernster Miene und finsterem Blick musterte sie jede einzelne ihrer Untertaninnen im Saal. »Und was euch betrifft: Ich weiß nicht, welcher Irrsinn sich in eure Hirne geschlichen hat und warum ihr Sossha gefolgt seid. Auch mit euch stimmt irgendwas nicht, das ist mal sicher. Also werdet ihr in den nächsten Tagen eure Häuser auch nicht verlassen. Darüber hinaus will ich nie wieder etwas von Gleichberechtigung, Femminisstuss oder so einem Quatsch hören. Sollte eine von Euch meinem Befehl nicht Folge leisten, werde ich mir aus ihrer Haut ein paar neue Handschuhe oder einige andere modische Accessoires machen. Gleiches gilt natürlich für den Fall, dass ihr irgendjemandem davon erzählt, was hier heute vorgefallen ist. Habt ihr die Worte eurer Königin vernommen?«
Genau in dem Maße eingeschüchtert, wie Khelea es beabsichtigt hatte, bekundeten sämtliche Anwesenden die Kenntnisnahme ihrer Ansage. Niemand wagte es noch, irgendwelche Einwände zu äußern. Danach hoben drei der Amazonen ihre bewusstlose Rädelsführerin vom Boden auf. Wie befohlen trugen sie diese aus dem Palast, unbemerkt von der Masse Amazonen, die sich vor dem Haupteingang versammelt hatte. Nachdem auch die restliche Anhängerschaft Sosshas den Saal verlassen hatte, waren Mutter und Tochter endlich allein.
Khelea erhob sich von ihrem Thron und begann, unruhig hin und her zu gehen. Der Saum ihrer langen königlichen Robe schliff dabei leise über den grauen Marmorboden, ohne dabei schmutzig zu werden.
»Da ist was faul im Staate der Amazonen«, sinnierte sie. »Im Staate der Amazonen und ich befürchte auch in anderen Teilen der Welt. Ich spüre das schon seit Längerem. Nur deshalb habe ich diese aufrührerischen Weiber nicht sofort hinrichten lassen. Irgendeine bisher unbekannte Macht oder so etwas scheint von ihnen Besitz ergriffen zu haben. Vielleicht können sie gar nichts dafür, dass sie plötzlich so seltsame Gedanken hegen. Vielleicht ist mein Volk wirklich von einer unheilvollen Seuche befallen. Die Nachricht der Barbaren, dass sie ihren Feldzug gegen uns nicht führen wollen, war auch so ein ungewöhnliches Vorkommnis.«
Sie stieß ein kurzes, humorloses Lachen aus. »Barbaren die nicht kämpfen wollen – das ist wie Regen, der nicht fallen will, Wind, der nicht wehen oder eine Sonne, die morgens nicht aufgehen möchte. Jetzt dieses seltsame Verhalten Sosshas samt ihrer Gefolgschaft und das fürchterliche Ding, das ihrem Gesicht entsprossen ist. Was hat das nur zu bedeuten?«
Sie wandte sich ihrer Tochter zu und verschränkte die Arme vor der Brust. »Lass mich raten: Mein entlaufenes Haustier konntest du auch nicht wieder einfangen.«
»Es ist lieber in den Tod gegangen, als in seine gemütliche Sklaverei zurückzukehren«, gab Tissha die Geschehnisse in äußerst verkürzter Form wieder. »Für mich völlig unbegreiflich.«
Weitere Details über die Ereignisse im Dschungel behielt sie lieber für sich. Selbige waren nicht unbedingt wichtig und ließen sie auch nicht gerade in einem guten Licht dastehen. Ihre Mutter gab sich erstaunlicherweise mit dieser knappen Erklärung zufrieden, was eigentlich so gar nicht ihrem herrischen Naturell entsprach. Anscheinend beschäftigten sie andere Sorgen weit mehr, als es das Ableben ihres Haustiers tat.
»Also befällt der Wahnsinn auch die niederen Lebensformen«, stellte sie lediglich fest. »Aber da ist noch etwas.«
Sie machte eine lange Pause, so als wäre ihr das, was sie nun zu sagen gedachte, peinlich. Es trotzdem auszusprechen, schien sie einiges an Überwindung zu kosten.
»Ich hatte letzte Nacht einen seltsamen Traum. Ich träumte davon, dass alle Lebewesen Archainos in Frieden zusammen leben würden. Es gab keine Gewalt, keinen Krieg und keinen Streit mehr zwischen den Völkern. Männer und Frauen waren gleichgestellt, sie hatten alle die gleichen Rechte und lebten in Harmonie und Eintracht zusammen. Nie zuvor hatte ich einen gruseligeren Albtraum wie diesen.«
»Das klingt wirklich schauderhaft«, stimmte Tissha ihr zu. Es befremdete sie sehr, dass ihre Mutter sich die Blöße gab, über so persönlich Dinge wie ihre Träume zu reden. »Aber du hast jetzt nicht vor, mir dein Herz auszuschütten, oder?«
Khelea bedachte sie mit strafenden Blicken. »Rede keinen Unsinn, Kind! Ich habe diesen Traum nur erwähnt, weil ich glaube, dass er eine tiefere Bedeutung hat. Vielleicht ist er ein Omen – eine Warnung vor weiteren seltsamen Ereignissen, die uns in Zukunft heimsuchen könnten. Ich möchte deshalb, dass du zu den Elfen reist, um mehr über diesen Traum und die heutigen Geschehnisse herauszufinden. Wie du sicherlich weißt, gibt es unter den Spitzohren einige äußerst fähige Wahrsager und Orakel. Ihre mystische Verbundenheit mit der Natur lässt sie Dinge sehen, welche den Angehörigen anderer Völker verborgen bleiben. Darüber hinaus sind sie die einzigen Wesen Archainos, die so etwas wie eine sensible Seite haben. Wenn jemand etwas über Emotionen oder Gemütszustände weiß, dann sind sie es.«
»Muss das denn wirklich sein?« Tissha verzog mürrisch ihre Mundwinkel. »Elfen sind die größten Weicheier dieser Welt. Mit ihnen zu reden ist unglaublich nervig. Ewig jammern sie rum, wie grausam die Welt doch sei und dass jedes Leben wertvoll wäre, unabhängig von Rasse oder Herkunft. Einen anständigen Kampf wissen diese Luschen gar nicht zu schätzen. Die kämpfen nur, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt. Ich bekomme echt Migräne, wenn ich mich länger als ein paar Minuten mit denen unterhalten muss.«
Khelea stemmte ihre Hände in die Hüfte und baute sich vor ihrer Tochter auf. »Wenn du nicht möchtest, musst du meinem Befehl natürlich nicht folgen. Warum solltest du auch? Ich bin ja nur die Königin und darüber hinaus auch noch deine Mutter! Letzteres muss mich dann allerdings auch nicht in meiner Entscheidung beeinflussen, wen ich für den Verlust meines liebsten Haustieres in handliche Würfel schneiden lasse.«
Früh am nächsten Morgen verließ Tissha die Stadt auf dem Rücken ihrer fuchsroten Stute, um dem Volk der Elfen einen Besuch abzustatten.
6
»Sind wir bald da?«, fragte Hohlefried von Ömmerbaum mit quengelndem Tonfall.
Seine zwei Begleiter stöhnten entnervt auf. Er stellte diese Frage bereits zum dritten Mal, seit sie nach ihrer Unterredung im Langhaus aufgebrochen waren.
Nach selbiger hatte auch der Druide zunächst noch darüber nachgedacht, seinen König und die zwei Fremden auf ihrer gefahrvollen Reise zu begleiten. Doch dann war ein Stammesangehöriger in einem Frauengewand aufgetaucht – fest davon überzeugt, als Frau im Körper eines Barbaren geboren worden zu sein. Lautstark hatte dieser Irre seine Rechte als Transgender eingefordert und beharrlich hatte er darauf bestanden, in Zukunft Loretta genannt zu werden. Diesen Wahnsinnigen in seinen schrägen Klamotten durch die Gegend laufen zu lassen, wäre natürlich unverantwortlich gewesen. Damit er sich um diesen und weitere verwirrte Bewohner kümmern konnte, war Grahlum deshalb im Dorf zurückgeblieben. Der ramponierte Herold hatte es indes vorgezogen, nach Loewenehr zurückzukehren, derweil die drei anderen zur Vampirjagd aufgebrochen waren.
Das war jetzt gerade mal eine Stunde her.
Storne drehte sich auf seinem schwarz-weiß gescheckten Hengst zu dem hinter ihm reitenden Paladin um. »Ich sage es Euch jetzt ein letztes Mal: Wir werden noch bis zum späten Nachmittag unterwegs sein und jetzt ist es gerade mal kurz vor Mittag! Und nun ist es an mir, Euch eine Frage zu stellen: Seid Ihr eigentlich noch ganz dicht?«
Der gepanzerte Krieger dachte kurz nach. »Ob ich noch dicht bin? Nun, ich müsste mich in der Tat mal kurz erleichtern. Wie konntet Ihr das wissen, König Storne?«
Der Barbar wandte sich an den Erzmagier, der zu seiner Linken ritt. »Warum trägt Euer Begleiter eigentlich einen Helm? Viel Schützenswertes scheint sich darunter ja nicht zu verbergen.«
Teophus schmunzelte. »Ihr werdet es vielleicht nicht glauben, doch von all den Paladinen im Dienste König Ludebrechts ist er noch einer der Pfiffigsten.«
Wahrhaftig von Zweifel erfüllt betrachtete Storne erneut den Paladin. Hinter dessen geschlossenem Visier erklang plötzlich ein lautes Niesen, dann ein »Bäh!« gefolgt von einem leisen »Nicht schon wieder«. Hastig kramte der junge Krieger daraufhin ein Tuch aus seiner Satteltasche hervor. Mit diesem wischte er ungelenk den Rotz von der Innenseite des Visiers, nachdem er selbiges geöffnet hatte.
»Der hellste Stern am Firmament ist er aber wahrlich nicht«, gab Teophus zu. »Aber wenigstens kann er mit dem Schwert umgehen.«
Der Barbar zog die Augenbrauen zusammen und knurrte missmutig. Auch dieser Aussage des Magiers schenkte er nur wenig Glauben.
»War nicht soeben die Rede von einer kurzen Rast, damit ich mein Wasser abschlagen kann?« Der Paladin rutschte unruhig auf seinem Sattel hin und her. »Oder habe ich da wieder etwas falsch verstanden?«
»Das ist doch wohl nicht Euer Ernst, Hohlefried!«, fuhr ihn nun der weißhaarige Magier an. »Habe ich Euch nicht vor unserem Aufbruch darauf hingewiesen, dass Ihr noch einmal den Abort aufsuchen sollt? Mit Euch reisen zu müssen, ist wahrhaftig eine Marter!«
Der König sackte seufzend in sich zusammen. Sie hatten erst ein kurzes Stück ihres Weges durch die dicht bewaldeten Regionen der Nordlande hinter sich gebracht und sein Nervenkostüm zeigte jetzt schon erste Verschleißerscheinungen. Wenn sie weiter in dieser Geschwindigkeit vorankämen, würden sie ihr Ziel erst am nächsten Morgen erreichen.
»Dann lasst uns halt eine kurze Pause einlegen«, entschied er dennoch. »Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, wenn die metallenen Beinkleider des Paladins Rost ansetzen.«
Sie zügelten ihre Pferde und während Storne und Teophus gemächlich von deren Rücken stiegen, sprang Hohlefried erstaunlich behände von seinem Gaul herunter. Danach entschwand er mit einer beachtlichen Geschwindigkeit zwischen den dicht stehenden Bäumen, die den Pfad durch den Wald säumten.
»Wie schafft er es, sich so flink zu bewegen?«, wunderte sich Storne, während er die Pferde an einer kleinen Birke in der Nähe festband. »Behindert ihn seine Rüstung denn gar nicht?«
Der Erzmagier ließ sich auf einen umgestürzten Baumstamm am Wegesrand nieder. »Natürlich nicht, er spürt sie noch nicht mal – er ist ein Paladin. Ritter und Paladine können sich mühelos in Rüstungen bewegen, deren Gewicht jedes andere humanoide Wesen in die Knie zwingen würde. Diese Fähigkeiten hat ihnen die Natur verliehen. Wie Ihr sicherlich wisst, sind die Naturgesetze Archainos vielgestaltig und sehr individuell. Deshalb sehen Amazonen ja auch immer gut aus, wächst uns Magiern schon in frühester Jugend ein langer Bart und verliert eine holde Jungfrau nie ihre Unschuld, egal wie oft und mit wem sie es schon getrieben hat.«
»Und wir Barbaren frieren darum nie in unserem Lendenschurz und unsere Körper sind immer muskulös und braun gebrannt«, fügte der König hinzu. Er setzte sich neben den Magier. »Wir nennen das alles aber nicht Naturgesetze sondern Isso.«
»Hallo?«, ertönte die Stimme des Paladins durch die Bäume. »Ich wollte nur Bescheid sagen, dass es noch etwas dauern könnte. Ich habe gerade festgestellt, dass ich auch meine Heckklappe mal kurz öffnen muss!«
»Bitte keine weiteren Details!«, rief Teophus zurück. Seine Verstimmung über diese weitere Verzögerung konnte er nicht verbergen. »Wegen dem werden wir uns dem Gegner womöglich noch im Dunkeln stellen müssen«, sagte er dann leise. »Bei einem Kampf gegen einen Vampir ist das ganz bestimmt nicht von Vorteil.«
Storne winkte ab. »Das wird sich so oder so nicht vermeiden lassen. Dort, wo wir hingehen, scheint ohnehin niemals die Sonne. Die Ruinen und der Friedhof liegen in ewiger Finsternis, dort ist es immer Nacht – seltsam, aber Isso.«
Der Weißhaarige strich sich mit der Rechten über seinen langen Bart. »Interessant, wenngleich für unser Vorhaben nicht sehr hilfreich. Dennoch sollten wir es vermeiden, unnötig Zeit zu verschwenden. Immerhin geht es um das Wohlergehen meiner Nichte.«
»Glaubt Ihr wirklich, dass sie noch unter den Lebenden weilt?« Die Skepsis in Stornes Frage war nicht zu überhören.
Der Erzmagier antwortete nicht sofort. Stattdessen holte er noch einmal Sielruds Kette mit dem Rubin daran aus seinem Gewand hervor. Mit beiden Händen umschloss er das Schmuckstück, dann schloss er seine Augen.
»Ich kann ihre Lebensenergie noch spüren«, murmelte er, während sich seine Augäpfel unter den geschlossenen Lidern deutlich sichtbar hin und herbewegten. »Der Vampirlord hat sie noch nicht zu einer Untoten gemacht. Wahrscheinlich hat er sie irgendwo eingesperrt, zusammen mit den anderen Mädchen, die er vielleicht auch noch nicht verwandelt hat.«
»Warum sollte er so etwas tun?«, fragte ihn Storne. »Wozu braucht er Gefangene?«
»Als Nahrungsquelle.« Teophus sah den Barbaren mit traurigen Augen an und ein leichter Schauder durchfuhr seinen Körper. »Manchmal halten sich Vampire ein paar willenlose Opfer wie Vieh, an dem sie ihren Durst jederzeit stillen können. Wenn sie nur geringe Mengen ihres Blutes trinken, sterben diese armen Kreaturen nicht und eine Verwandlung findet nicht statt. Nach einer Weile regeneriert sich ihr Lebenssaft und der Vampir kann sie erneut zur Ader lassen. Ich habe von Fällen gehört, in denen Menschen über Jahrzehnte hinweg unter dem Bann eines Blutsaugers gestanden und ihm als Futterspender gedient haben.«
»Abscheulich!«, befand Storne. »Blut ist zum Vergießen da, nicht zum Verzehren.«
Ein lautes Keuchen und Ächzen, das plötzlich aus dem Wald zu ihnen drang, erregte seine Aufmerksamkeit. Er sah den Magier fragend an und gemeinsam dachten sie einen Augenblick lang schweigend über die Ursache dieser Geräusche nach. Dass es für den Paladin ganz normal war, solche Laute bei der Verrichtung seines Geschäftes von sich zu geben, hielten beide für durchaus denkbar.
Erst ein gellender Hilfeschrei überzeugte sie davon, dass der junge Krieger bei seinem Stuhlgang in irgendeine Bedrängnis geraten war. Während Storne nun geschwind seine gewaltige, zweischneidige Streitaxt vom Sattel nahm, holte Teophus seinen Stab und den Zweihänder des Paladins. Dann eilten sie dem jungen Krieger zu Hilfe.
Erst nach einigen Metern entdeckten sie diesen hinter einem großen Wacholderbusch inmitten hoher Eichen. In ein grobes Netz aus Schlingpflanzen verheddert, erwehrte er sich verzweifelt zweier Gegner, die ihn scheinbar als Jagdbeute betrachteten. Wild und ungestüm drangen die dürren, grünhäutigen Zweibeiner, die gerade mal einen Meter groß waren, dabei auf den gepanzerten Jungspund ein. Einem von ihnen hielt Hohlefried die Handgelenke fest, damit dieser nicht mit seinem Beil auf ihn einprügeln konnte. Der andere grüne Bursche hockte derweil auf dem Rücken des Paladins und drosch mit einem Holzknüppel auf dessen Helm ein.
Offensichtlich hatten die Angreifer ihrem Opfer noch nicht einmal die Zeit gelassen, die metallene Klappe vor seinem Gesäß zu schließen. Auch sein Unterzeug hatte Hohlefried nicht mehr hochziehen können. Mit entblößtem Gesäß musste er sich deshalb gegen die beiden Gestalten verteidigen.
Noch bevor Storne und Teophus ihn aus dieser Bredouille befreien konnten, brachen drei weitere Kreaturen aus dem Unterholz hervor.
»Goblins!«, stellte der Magier überflüssigerweise fest.
Auch der Barbar hatte die Wesen schon längst anhand ihrer langen, spitzen Ohren und ihrer ebenso langen und spitzen Nasen identifiziert. Dass Goblins allgemein für ihre Feigheit und Scheu bekannt waren, merkte man diesen wüsten, mit Tierfellen bekleideten Radaubrüdern allerdings nicht an. Mit Krummsäbeln bewaffnet und laut schreiend stürmten sie heran.
»Die übernehme ich!«, entschied Storne. »Helft Ihr dem Paladin.«
Erfreut darüber, sich endlich wieder seiner Lieblingsbeschäftigung widmen zu können, schwang er fröhlich seine Axt hin und her. Nur einen Atemzug später lag der erste Goblin enthauptet darnieder und ein zweiter schaute erstaunt seinen Armen hinterher, die in einem hohen Bogen durch den Wald flogen. Bevor er sich wieder aus diesem übermächtigen Staunen lösen konnte, amputierte ihm Storne noch geschwind beide Beine mit einem einzigen Axthieb.
Dem Boden nun ein gutes Stück näher sah der Goblin hilflos zu, wie der Barbar den dritten Angreifer mit einem senkrechten Hieb in zwei Hälften zerteilte. Danach verließ das Leben den grünen Kerl ebenso schnell, wie es der größte Teil seines Blutes tat.
Der Magier kümmerte sich zwischenzeitlich um die zwei Quälgeister, die es auf Hohlefried abgesehen hatten. Mit der kristallbesetzten Spitze seines Stabes zeigte er auf die beiden Grünhäute, die daraufhin in die Lüfte entschwebten, als würden sie von unsichtbaren Händen emporgehoben. Jammernd und zappelnd stiegen sie höher und höher, bis sie nur noch als kleine Punkte am Himmel zu erkennen waren. Ihr Jammern verwandelte sich in panisches Kreischen, als Teophus den Stab zur Seite schwenkte und sie im freien Fall ihrem unvermeidlichen Ende entgegenrasten. Erst ihr heftiger Aufprall, der ihnen sämtliche Knochen in ihren dürren Leibern zertrümmerte, ließ diesen Lärm verstummen.
Nun war es an Hohlefried, seinen Wert im Kampf zu beweisen. Gerade als Teophus ihn aus dem Netz befreit und ihm sein Schwert überreicht hatte, tauchten zwei weitere Goblins aus dem Gebüsch zu seiner Linken auf. Überaus geschickt parierte er den von oben geführten Schlag, den einer der Kerle mit seinem Knüppel ausführte. Zeitgleich trat er dem anderen Angreifer mit seinem metallbeschlagenen Stiefel ins Gesicht, sodass dieser mit blutender, augenscheinlich gebrochener Nase nach hinten taumelte und zu Boden ging. Dies verschaffte dem Paladin ausreichend Zeit, sich weiter mit dem ersten Gegner zu beschäftigen.
Zwei weitere Attacken des grünen Keulenschwingers wehrte er noch ab, dann rammte er ihm seinen Zweihänder fast bis zum Heft in den Leib. Die Lebenslichter des Goblins erloschen binnen weniger Augenblicke. Als lebloser Klumpen Fleisch steckte der er nun auf der langen Klinge. Doch das störte Hohlefried nicht weiter. Da sich der andere Bursche wieder aufgerappelt hatte und nun angriff, musste er umgehend handeln. Ungeachtet des zusätzlichen Gewichts auf seinem Schwert schwang er selbiges kraftvoll zur Seite. Es traf den Heranstürmenden und zerschnitt ihn knapp oberhalb seines Bauchnabels in zwei Teile. Während die obere Körperhälfte samt einer unsagbar dämlich dreinblickenden Goblinfratze nun zu Boden plumpste, blieben die Beine noch ein paar Sekunden lang stehen. Unmengen an Blut in die Gegend verspritzend fielen auch sie letztendlich um.
Der Paladin stemmte seinen Fuß gegen den Leichnam auf seinem Schwert und mit einem starken Ruck befreite er es aus selbigem. Beide Hände auf dem Knauf seiner Waffe stieß er sie danach vor sich in den Boden, dabei einen Laut der Zufriedenheit ausstoßend. Hätte er all dies nicht mit blankem Hinterteil vollbracht, wäre Storne Stahlhand vielleicht sogar beeindruckt gewesen.
»So habe ich also einen Hinterhalt der Goblins vereitelt!«, lobpreiste sich der gepanzerte Krieger selbst. Er tat dies voller Inbrunst, als spräche er vor einem großen Publikum. »Wenn ich erst mal wieder in Loewenehr bin, werde ich ein Heldenlied darüber verfassen, welche Abenteuer wir auf unserer Reise erlebt haben. Dieser Kampf wird sicherlich einer der Höhepunkte darin sein.«