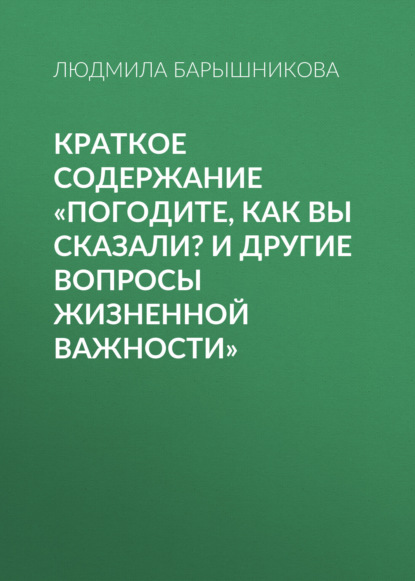- -
- 100%
- +
Der würdige Beamte hörte diese Mitteilungen mit bedeutsamer Miene an und berechnete gleichzeitig, wieviel Buchstaben die Anzeige enthalte. Neben dem Lakai stand noch eine ganze Menge von Frauen, Ladendienern und Dienstpersonal mit Zetteln. Der eine hatte einen Kutscher abzugeben, der sich durch Nüchternheit auszeichnet; der andere wünschte eine wenig gebrauchte Kalesche zu verkaufen, die im Jahre 1814 aus Paris gekommen sei; ein neunzehnjähriges Mädchen wurde angeboten, das sich auf Wäsche und andere Arbeiten verstand; eine feste Droschke ohne Federn, ein junger feuriger Apfelschimmel, siebzehn Jahre alt, frischer, aus London eingetroffener Rüben- und Rettichsamen, ein Landhaus mit allem Zubehör, Pferdeställen und einem freien Raum, der sich zur Anlegung eines Birken- oder Tannenhains eigne; noch ein anderer forderte alle diejenigen, welche alte Schuhsohlen zu kaufen wünschten, auf, sich täglich zwischen acht und drei Uhr morgens da und dort einzufinden, um den Preis zu erfragen. Der Raum, in dem diese ganze Gesellschaft sich aufhielt, war sehr klein und die Luft darin außerordentlich dumpf; aber dem Kollegien-Assessor Kowalow vermochte der Geruch nichts anzuhaben, da er sein Taschentuch vors Gesicht gedrückt hatte und seine Nase sich ja Gott weiß wo befand.
»Mein geehrter Herr, erlauben Sie mir, Sie zu bitten – ich habe große Eile«, sagte er endlich mit einiger Ungeduld.
»Sogleich, sogleich! – Zwei Rubel dreiundvierzig Kopeken. – Einen Augenblick! – Ein Rubel vierundsechzig Kopeken!« sprach der grauköpfige Herr, den Dienern und alten Weibern die Zettel ins Gesicht werfend. »Nun, was wünschen Sie denn?« fragte er endlich, sich an Kowalow wendend.
»Ich möchte – –« begann Kowalow, »es ist mir da eine Nichtswürdigkeit, eine Schurkerei angetan worden – und bis jetzt konnte ich es noch nicht herauskriegen. Da möchte ich Sie bitten, in Ihre Zeitung die Bekanntmachung einzurücken, daß derjenige, der mir diesen Schuft dingfest macht, eine ausreichende Belohnung erhalten würde.«
»Darf ich fragen, wie Ihr werter Name ist?«
»Wozu den Namen? Den kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe viele Bekannte, die Staatsrätin Tschechtarew, die Frau des Stabsoffiziers, Pelagia Grigorjewna Podtotschin … die würden es ja sofort erfahren und da sei Gott vor! Sie können ja einfach schreiben: ein Kollegien-Assessor, oder noch besser: ein Herr mit Majorsrang.«
»Und war der davongelaufene Bursche ihr Diener?«
»Was für ein Diener? Das wäre noch keine Schurkerei! Weggelaufen ist mir – meine Nase –«
»Hm! Ein seltsamer Name! Und hat dieser Herr Nasow Ihnen eine große Summe mitgenommen?«
»Nase – damit meine ich – es wird Ihnen unglaublich vorkommen! Meine eigene Nase ist mir abhanden gekommen, und ich weiß nicht, wohin; der Teufel hat mir einen argen Streich spielen wollen!«
»Ja, auf welche Weise ist sie Ihnen denn abhanden gekommen? Die Sache kommt mir doch ein wenig unbegreiflich vor.«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen, auf welche Weise; aber die Hauptsache ist, daß sie jetzt in der Stadt herumkutschiert und sich Staatsrat nennt. Und darum möchte ich Sie bitten, bekanntzumachen, daß derjenige, der sie fängt, sie mir so schnell wie möglich zustellen möchte. Sie werden doch wohl begreifen, daß ich einen so hervorragenden Körperteil nicht entbehren kann! Das ist keine kleine Zehe, die sich im Stiefel versteckt – da sieht's kein Mensch, wenn einem die fehlt. Ich besuche des Donnerstags die Soiree der Staatsrätin Tschechtarew, und die Frau des Stabsoffiziers, Pelagia Grigorjewna Podtotschin, die eine sehr hübsche Tochter hat, ebenfalls eine sehr gute Bekannte von mir, und Sie werden begreifen, daß ich mich jetzt – so kann ich mich doch nicht vor ihnen sehen lassen!«
Der Beamte dachte tief nach, was die fest zusammengepreßten Lippen bewiesen.
»Nein, eine solche Bekanntmachung kann ich in die Zeitung nicht aufnehmen«, sagte er endlich nach langem Schweigen.
»Wie? Warum?«
»Ja, dadurch könnte die Zeitung um ihren Ruf kommen. Wenn da jeder hineinsetzen könnte, seine Nase sei ihm fortgelaufen, dann … Man sagt ohnehin schon, daß allerlei Unsinn und Lügen darin ständen.«
»Aber dies hier ist doch kein Unsinn. Mir scheint, daß darin nichts dergleichen ist.«
»Ja, Ihnen mag das so scheinen. Da hatten wir in der vorigen Woche einen ähnlichen Fall. Kommt da just wie Sie ein solcher Beamter zu uns mit einem Zettel – das Inserat machte zwei Rubel dreiundsiebzig Kopeken –, und die ganze Bekanntmachung bestand darin, daß ein schwarzer Pudel davongelaufen sei. Scheint es, daß etwas Besonderes dabei wäre? Es hat sich aber gezeigt, daß es ein Pasquill war; mit diesem Pudel war ein gewisser Kassierer gemeint – ich erinnere mich nicht mehr welcher Anstalt.«
»Aber ich fahnde hier ja nicht nach einem Pudel, sondern nach meiner eigenen Nase – und das ist doch fast dasselbe wie nach mir selbst.«
»Nein, ein solches Inserat kann ich durchaus nicht annehmen.«
»Aber wenn ich doch wirklich meine Nase verloren habe?«
»Wenn das der Fall ist, so ist es eine Sache, die den Arzt angeht. Es soll ja Ärzte geben, die jede beliebige Nase ansetzen können. Allein ich sehe schon, Sie sind ein lustiger Herr und lieben es, Späße zu machen.«
»Ich schwöre Ihnen – so wahr Gott heilig ist! Übrigens, wenn es schon soweit gekommen ist, kann ich Ihnen ja auch zeigen –«
»Warum sollen Sie sich bemühen!« fuhr der Beamte fort und nahm eine Prise. »Doch, wenn es Ihnen nicht unangenehm ist«, fügte er neugierig hinzu, »so möchte ich wohl gerne sehen.«
Der Kollegien-Assessor nahm das Tuch vom Gesicht.
»In der Tat, höchst merkwürdig«, sagte der Beamte, »die Nasenstelle ist vollständig glatt, so glatt wie eine frischgebackene Plinse. Es ist kaum zu glauben.«
»Nun, jetzt werden Sie doch wohl nicht mehr streiten wollen? Sie sehen selbst, die Sache muß in die Zeitung. Ich würde Ihnen zu ganz besonderem Dank verpflichtet sein und freue mich, daß dieser Anlass mir das Vergnügen verschafft hat, Ihre Bekanntschaft zu machen.« Wie aus diesen Worten zu ersehen, beschloß der Major, es mit der Liebenswürdigkeit zu versuchen.
»Die Veröffentlichung ist schließlich eine Sache ohne Belang«, sagte der Beamte; »nur sehe ich nicht ein, was für einen Nutzen es für Sie haben könnte. Wollen Sie nicht lieber irgend jemandem, der eine gewandte Feder führt, den Vorfall erzählen, damit er ihn als ein seltnes Naturereignis schildert? Er kann dann diesen Aufsatz in der ›Nordischen Biene‹ (hier nahm er sich wieder eine Prise) abdrucken lassen, zur Belehrung der Jugend (hier putzte er sich die Nase) oder auch zur Unterhaltung des Publikums.«
Der Kollegien-Assessor ließ alle Hoffnungen fahren. Er warf einen Blick in ein vor ihm liegendes Zeitungsblatt, das die Ankündigungen der Theatervorstellungen enthielt; schon verbreitete sich über sein Gesicht ein Lächeln, da er den Namen einer Schauspielerin, einer hübschen Person, las. Und er faßte schon in die Tasche, um nachzusehen, ob er eine Fünfrubelnote bei sich habe, da nach seiner Meinung die Stabsoffiziere im Parkett sitzen müssen, aber der Gedanke an die Nase verdarb alles wieder.
Selbst der Beamte schien durch die bedrängte Lage Kowalows gerührt. Um ihm seinen Kummer soviel als möglich zu erleichtern, hielt er es für angemessen, ihm seine Teilnahme auszudrücken: »Wirklich, es geht mir sehr nahe, daß Ihnen diese Anekdote passieren mußte. Wollen Sie nicht ein Prischen nehmen? Das vertreibt das Kopfweh und alle schwermütigen Gedanken; selbst gegen Hämorrhoiden ist der Schnupftabak ein gutes Mittel!« Und mit diesen Worten hielt der Beamte Kowalow seine Tabaksdose hin, auf deren Deckel eine Dame mit Hut abgebildet war.
Diese Unbedachtsamkeit brachte Kowalow um seine Geduld.
»Ich begreife nicht, wie Sie sich einen solchen Scherz erlauben können«, sagte er wütend; »sehen Sie denn nicht, daß mir gerade das fehlt, was zum Prisennehmen unerläßlich ist? Hol' der Teufel Ihren Tabak. Ich kann ihn jetzt nicht einmal sehen, nicht nur Ihren schlechten Beresiner, sondern auch wenn man mir sogar Rapé anbieten würde.« Und mit diesen Worten ging er ganz wütend aus der Zeitungsexpedition hinaus und begab sich zu dem Polizei-Inspektor.
Kowalow traf diesen Beamten gerade in dem Augenblick, als er sich reckte, gähnte und sprach: »Ach, jetzt schlaf ich recht hübsch zwei Stündchen!« Und so kam ihm der Besuch des Kollegien-Assessors selbstverständlich durchaus nicht gelegen. Der Polizei-Inspektor war ein großer Freund von allerlei schönen Sachen und Industrieerzeugnissen, aber staatliche Banknoten zog er doch allem andern vor. »Das ist etwas Reelles«, pflegte er zu sagen; »es geht nichts über so einen reellen Schein; er braucht keine Nahrung, nimmt nur wenig Raum ein, findet immer Platz in der Tasche, und fällt er zu Boden, so zerbricht er nicht.«
Der Polizei-Inspektor empfing Kowalow ziemlich trocken und sagte, unmittelbar nach dem Essen sei keine Zeit, gerichtliche Untersuchungen einzuleiten; schon die Natur habe es so eingerichtet, daß man sich dann ein wenig ausruhe (aus welcher Bemerkung der Kollegien-Assessor entnehmen konnte, daß der Polizei-Inspektor mit den Sinnsprüchen der alten Weisen nicht ganz unbekannt war) und daß man einem ordentlichen Menschen nicht die Nase abreiße.
Das war überaus deutlich. Es muß hier bemerkt werden, daß Kowalow ein höchst empfindlicher Mensch war. Er konnte alles verzeihen, was man über ihn selbst sagte, aber niemals das, was sich auf seinen Rang oder seine Stellung bezog. Er ließ sogar gelten, daß die Zensur in Theaterstücken alles das passieren ließ, was auf die Offiziere gemünzt war, aber Stabsoffiziere durften nie angegriffen werden. Der Empfang des Polizei-Inspektors machte ihn so verwirrt, daß er den Kopf schüttelte und, die Arme ein wenig ausbreitend, im Gefühl seiner Würde sagte: »Ich muß gestehen, nach solchen beleidigenden Bemerkungen von Ihrer Seite habe ich nichts mehr hinzuzufügen.« Sprach's und ging.
Er kam nach Hause, kaum noch seine Beine fühlend. Es dämmerte schon. Seine Wohnung erschien ihm traurig und widerwärtig nach all diesen unglücklichen Bemühungen. Als er in das Vorzimmer trat, erblickte er seinen Diener Iwan rücklings auf dem schmutzigen Ledersofa liegend, wie er sich die Zeit damit vertrieb, daß er nach der Decke spuckte, wobei er glücklich immer ein und dieselbe Stelle traf. Der Gleichmut seines Dieners empörte ihn. Er versetzte ihm mit seinem Hut einen Hieb auf den Kopf und schrie: »Immer machst du Dummheiten, du Schweinigel.«
Iwan sprang jäh in die Höhe, lief was er konnte, um seinem Herrn den Mantel abzunehmen.
In seinem Zimmer angelangt, warf sich der Major müde und kummervoll auf einen Stuhl, seufzte einige Male tief auf und sagte schließlich: »Mein Gott, mein Gott! Ist das ein Unglück! Hätte ich einen Arm oder ein Bein verloren, das alles wäre noch nicht so schlimm; aber ein Mensch ohne Nase – der Teufel weiß, was das ist: Nicht Fisch und nicht Fleisch – man kann ihn einfach nehmen und zum Fenster hinauswerfen. Und hätte ich sie noch im Kriege oder im Duell oder auf eine andere selbstverschuldete Art verloren, aber um nichts und wieder nichts, ohne Not, nicht einen Groschen habe ich dafür bekommen … Aber nein, es ist ja unmöglich!« fuhr er nach einigem Sinnen fort; »ganz undenkbar, daß ich die Nase verloren haben könnte; ganz und gar unwahrscheinlich. Das hat mir geträumt oder ich phantasiere nur; vielleicht habe ich aus Versehen statt des Wassers den Branntwein ausgetrunken, mit dem ich mir nach dem Rasieren das Kinn abwasche. Iwan, der Dummkopf, hat ihn nicht weggestellt, und ich habe ihn sicher getrunken.« Und um sich zu überzeugen, ob er wirklich nicht betrunken sei, kniff sich der Major so empfindlich, daß er selbst aufschrie. Dieser Schmerz überzeugte ihn vollständig, daß er in der Tat ganz wach und nüchtern sei. Langsam näherte er sich dem Spiegel und schloß zuerst die Augen, in der Hoffnung, daß vielleicht seine Nase sich wieder an der alten Stelle befände; aber in demselben Augenblick sprang er zurück und rief aus: »Was für ein niederträchtiger Anblick!«
Es war wirklich unbegreiflich; wenn er irgend etwas anderes, einen Knopf, die Uhr, einen silbernen Löffel verloren hätte! Aber ein solcher Verlust! Und noch in der eigenen Wohnung! … Der Major Kowalow kam, alle Umstände erwägend, auf den Gedanken, ob es der Wahrheit nicht am nächsten liegen möchte, daß niemand anders schuld daran sei als die Frau des Stabsoffiziers Podtotschin, die ihn mit ihrer Tochter zu verheiraten suchte. Und er selbst kokettierte gern mit ihr, ging aber einer endgültigen Erklärung aus dem Wege. Als Frau Podtotschin ihm geradeheraus erklärte, daß sie ihr Töchterchen ihm geben möchte, da zog er sich ganz leise mit seinen Komplimenten zurück, indem er bemerkte, er sei noch zu jung, er müsse erst noch fünf Jahre dienen, um gerade zweiundvierzig Jahre voll zu haben. Und darum hat die Frau des Stabsoffiziers sicher aus Rache den Plan gefaßt, ihn zu schänden, und sich zu diesem Zwecke irgendein paar alte Hexenweiber angeworben, da auf keinerlei Weise angenommen werden konnte, daß ihm die Nase abgeschnitten worden sei: niemand kam zu ihm ins Zimmer; der Barbier Iwan Jakowlewitsch hatte ihn bereits am Mittwoch rasiert, und während des ganzen Mittwochs, ja sogar noch während des Donnerstags war die Nase noch heil gewesen. Dessen erinnerte er sich noch genau und wußte es ganz gut. Zudem würde er ja auch den Schmerz empfunden haben, und ohne Zweifel hätte die Wunde nicht so schnell heilen können. Es gingen ihm allerlei Pläne durch den Kopf; sollte er die Frau des Stabsoffiziers auf dem Rechtswege vor Gericht laden oder sich selbst zu ihr begeben und sie überführen? Er wurde in seinen Gedanken durch das Licht gestört, das durch alle Spalten der Tür hindurchdrang und erkennen ließ, daß Iwan bereits im Vorzimmer die Kerze angezündet hatte. Bald darauf trat Iwan selbst herein, das Licht vor sich tragend und die ganze Stube erleuchtend. Das erste, was Kowalow tat, war, nach dem Taschentuch zu greifen und die Stelle zu verhüllen, wo sich gestern noch die Nase befunden, damit dieser Dummkopf von Diener den Mund nicht so aufsperre, wenn er seinen Herrn in einer so seltsamen Verfassung erblickte.
Iwan war noch nicht wieder in seine Kammer gegangen, als aus dem Vorzimmer eine unbekannte Stimme sich vernehmen ließ, welche rief: »Wohnt hier der Kollegien-Assessor Kowalow?«
»Bitte treten Sie ein, ja, hier wohnt er«, rief Kowalow schnell aufspringend und die Tür öffnend.
Es war ein Polizeibeamter von hübschem Äußeren mit einem nicht zu hellen und nicht zu dunklen Backenbart und ziemlich vollen Wangen, derselbe, welcher zu Beginn unserer Erzählung auf der Isaaksbrücke stand.
»Haben Sie vielleicht beliebt Ihre Nase zu verlieren?«
»Ganz recht.«
»Sie ist jetzt aufgefunden worden.«
»Was sagen Sie?« rief der Major Kowalow. Die Freude lähmte ihm die Zunge. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er den vor ihm stehenden Polizeimann an, auf dessen vollem Gesicht und Lippen hell das flackernde Kerzenlicht zitterte.
»Auf welche Weise?«
»Auf höchst seltsame Weise: sozusagen auf der Landstraße. Sie saß bereits im Postwagen und wollte nach Riga fahren. Der Paß war schon vor längerer Zeit auf den Namen eines Beamten ausgestellt worden. Und ist es nicht merkwürdig, daß ich selbst anfangs sie für einen Herrn hielt? Aber glücklicherweise hatte ich meine Brille bei mir, und da sah ich denn sofort, daß es eine Nase war. Ich bin nämlich kurzsichtig, und wenn Sie selbst vor mir stehen, so sehe ich nur, daß Sie ein Gesicht haben, aber von einer Nase, einem Bart bemerke ich nichts. Meine Schwiegermutter, das heißt, die Mutter meiner Frau, sieht ebenfalls nichts.«
Kowalow war außer sich. »Wo ist sie, wo? Ich eile sofort hin –«
»Sorgen Sie sich nicht. Ich wußte, daß Sie sie brauchen und habe sie gleich mitgebracht. Und merkwürdigerweise ist der Hauptverbrecher bei dieser Sache ein Halunke von Barbier da auf der Himmelfahrtsstraße – jetzt sitzt er bereits auf der Wache. Ich hatte ihn schon lange im Verdacht, daß er ein Trunkenbold und Dieb sei, und noch vorgestern nahm er in einem Laden eine Partie Knöpfe an sich. Ihre Nase ist noch ganz so, wie sie war.« Und damit griff der Polizeibeamte in die Tasche und zog die in Papier gewickelte Nase heraus.
»Ja, ja, das ist sie!« rief Kowalow; »richtig, das ist sie! Werden Sie heute eine Tasse Tee mit mir trinken?«
»Würde mir sehr angenehm sein, aber ich kann wirklich nicht; ich muß von hier sofort nach dem Zuchthaus fahren … alle Lebensmittel sind jetzt furchtbar teuer … bei mir wohnt die Schwiegermutter, das heißt die Mutter meiner Frau, und Kinder; namentlich das älteste erweckt große Hoffnungen – ein kluger Junge; aber es fehlt mir vollständig an Mitteln, um ihm eine gute Erziehung zu geben …«
Als der Polizeibeamte fort war, verharrte der Kollegien-Assessor einige Minuten in einem unbestimmten Geisteszustand; erst nach einigen Minuten war es ihm möglich, wieder zu sehen und zu fühlen – so hatte ihn die unerwartete Freude überwältigt. Vorsichtig nahm er die wiedergefundene Nase in beide Hände, die er ballte, und betrachtete sie noch einmal ganz aufmerksam.
»In der Tat, sie ist's!« sagte der Major Kowalow zu sich. »Da ist auch das Hitzbläschen an der linken Seite, das sich vorgestern gebildet hat.« Ein Wunder, daß der Major nicht vor Freude auflachte. Aber nichts ist von Dauer hier auf Erden, und so ist auch die Freude im zweiten Augenblick schon nicht mehr so lebendig wie im ersten; im dritten wird sie noch schwächer, und schließlich verfließt sie unbemerkt mit dem gewöhnlichen Zustand der Seele – wie die Ringe auf dem Wasser, die durch das Hineinfallen eines Steines entstanden sind, endlich auf der glatten Oberfläche wieder verschwinden. Kowalow begann nachzudenken und besann sich, daß die Sache ja noch nicht vollständig erledigt war: die Nase war zwar gefunden, aber nun mußte sie wieder an ihren Platz befestigt werden.
»Wenn sie nun nicht festwüchse?«
Bei dieser Frage, die er sich selbst stellte, erbleichte der Major.
Mit einem Gefühl unerklärlichen Schreckens sprang er zum Tisch und rückte den Spiegel näher, damit er die Nase nicht schief aufsetze. Die Hände bebten ihm. Vorsichtig und behutsam hielt er sie an der alten Stelle … o Schrecken! Die Nase hielt nicht! … Er hielt sie vor den Mund, wärmte sie durch seinen Atem ein wenig an und hielt sie wieder an die glatte Stelle zwischen den beiden Wangen, aber die Nase wollte durchaus nicht festhalten.
»Na, na, na! So klettere doch hinauf, du dummes Ding!« sagte er zu ihr. Aber die Nase war wie von Holz und fiel mit einem eigentümlichen Ton so wie ein Pfropfen auf den Tisch. Das Gesicht des Majors begann krampfhaft zu zucken. »Wäre es wirklich möglich, daß sie nicht wieder anwachsen wollte?« sagte er entsetzt zu sich. Aber so oft er sie auch andrückte – alle Bemühungen waren fruchtlos.
Er rief Iwan und schickte ihn zu dem Arzt, der in demselben Hause die schönste Wohnung im ersten Stock inne hatte. Dieser Doktor war ein stattlicher Mann, hatte einen schönen pechschwarzen Backenbart, eine frische gesunde Frau, aß des Morgens frische Äpfel, reinigte sich mit der größten Sorgfalt den Mund, indem er ihn jeden Morgen fast dreiviertel Stunden lang spülte und die Zähne mit fünf verschiedenen Bürstchen putzte. Der Doktor kam unverzüglich. Nachdem er gefragt, wann ihm das Unglück passiert sei, faßte er den Major ans Kinn, hob seinen Kopf und gab ihm mit dem Zeigefinger ein Schnippchen auf dieselbe Stelle, wo früher die Nase gesessen, so daß der Major seinen Kopf mit solcher Heftigkeit zurückzog, daß er mit dem Hinterkopf an die Wand schlug. Der Arzt sagte, das habe nichts zu bedeuten, riet ihm, ein wenig von der Wand wegzutreten, und befahl ihm, den Kopf erst nach rechts zu neigen, befühlte dann die Stelle, wo die Nase gesessen hatte, und sagte »hm!« Dann befahl er ihm, den Kopf nach links zu neigen, und sagte »hm!« Und zum Schluß gab er ihm wieder mit dem Finger ein Schnippchen, so daß Major Kowalow den Kopf emporriss wie ein Pferd, dem man die Zähne besieht. Nachdem der Arzt diese Prüfung angestellt hatte, schüttelte er den Kopf und sagte: »Nein, es ist unmöglich; es ist besser, Sie bleiben so wie Sie sind, denn es könnte noch viel schlimmer werden. Natürlich könnte ich Ihnen die Nase wieder ansetzen; ja, ich könnte sie, wenn's Ihnen beliebte, jetzt gleich wieder befestigen; aber ich versichere Sie, es würde für Sie nur noch schlimmer werden!«
»Das ist eine schöne Geschichte! Wie sollte ich ohne Nase auf der Welt herumlaufen?« rief Kowalow. »Ärger als es jetzt ist, kann es gar nicht werden. Das ist ja, um des Teufels zu werden! Wo soll ich mich mit einem so niederträchtigen Gesicht sehen lassen? Ich habe sehr distinguierte Bekannte, und noch heut Abend muß ich in zwei Familien Besuche machen. Ich habe sehr viele Bekannte: da ist die Staatsrätin Tschechtarew, die Frau des Stabsoffiziers Podtotschin, wiewohl ich mit ihr nach dieser Tat nur noch durch die Polizei verkehren kann … Seien Sie so liebenswürdig«, fuhr Kowalow mit flehender Stimme fort. »Gibt es denn gar kein Mittel? Machen Sie sie irgendwie fest: wenn's auch nicht schön aussieht – wenn sie nur fest sitzt! Ich kann sie sogar in kritischen Situationen leicht mit der Hand festhalten. Ich will sogar nicht tanzen, damit sie nicht durch irgendeine unvorsichtige Bewegung zu Schaden kommt. Und was die Remuneration für Ihre Besuche anlangt, so seien Sie überzeugt – soweit meine Mittel gehen –«
»Sie können versichert sein«, sprach der Doktor weder mit zu lauter noch zu leiser, aber außerordentlich freundlicher und anziehender Stimme, »daß ich nie aus Gewinnsucht meiner Praxis nachgehe. Das ist ganz gegen meine Grundsätze und meine Kunst. Allerdings nehme ich Geld für meine Besuche, aber nur um meine Patienten nicht zu verletzen. Natürlich könnte ich Ihnen die Nase wieder ansetzen; aber ich versichere Sie bei meiner Ehre – wenn Sie schon meinen Worten nicht glauben wollen – es würde noch weit schlimmer werden. Waschen Sie die Stelle öfters mit kaltem Wasser, und ich versichere Sie, Sie werden auch ohne Nase so gesund sein, als hätten Sie eine Nase. Die Nase selbst aber möchte ich Ihnen raten in eine Flasche mit Spiritus zu legen, oder noch besser: gießen Sie zwei Löffel voll scharfen Branntwein und aufgewärmten Essig darauf – dann bekommen Sie ein hübsches Stück Geld dafür. Ich bin sogar bereit, sie selbst zu nehmen, wenn Sie nicht zu viel dafür verlangen.«
»Nein, nein! Verkaufen? Um keinen Preis!« schrie verzweifelt der Major Kowalow.
»Entschuldigen Sie!« sagte der Doktor mit einer Verbeugung; »ich wollte Ihnen nur nützlich sein … was soll ich tun? Wenigstens haben Sie gesehen, daß ich es aufrichtig meinte.«
Und mit diesen Worten verließ der Doktor in würdevoller Haltung das Zimmer. Kowalow bemerkte nicht einmal sein Gesicht und sah in seiner tiefen Betäubung nur noch die aus den Ärmeln des schwarzen Fracks hervorstehenden schneeweißen Manschetten.
Am folgenden Tage beschloß er, bevor er dem Gericht die Klage einreichte, an die Frau des Stabsoffiziers zu schreiben, ob sie ihm nicht ohne Kampf das zurückgäbe, was ihm gehörte. Der Brief hatte folgenden Inhalt:
»Meine Gnädigste!
Ich kann Ihr eigentümliches Benehmen durchaus nicht begreifen. Seien Sie überzeugt, durch ein solches Vorgehen erreichen Sie nichts und werden mich dadurch nie bewegen, Ihre Tochter zu heiraten. Sie können glauben, daß die Geschichte meiner Nase schon in der ganzen Stadt bekannt ist, wie auch der Umstand, daß Sie und niemand anders in erster Reihe beteiligt sind. Ihr plötzliches Verschwinden und ihre Flucht, der Umstand, daß sie bald in der Gestalt eines Beamten, bald in ihrer eigenen Gestalt sich zeigt, sind weiter nichts als das Resultat der Zauberkünste, welche Sie oder diejenigen geübt haben, die sich mit solch edlen Beschäftigungen befassen. Ich halte es für meine Pflicht, Ihnen die Mitteilung zu machen, daß, wenn oberwähnte Nase sich nicht heute noch an Ort und Stelle befindet, ich mich genötigt sehen werde, bei den Gerichten Schutz und Genugtuung zu suchen.
Im übrigen mit vollständiger Hochachtung
Ihr ganz ergebener
Platon Kowalow.«
»Sehr geehrter Herr!
Ihr Brief hat mich über die Maßen verwundert. Ich muß Ihnen offen gestehen, das und insbesondere diese ungerechten Vorwürfe Ihrerseits hatte ich durchaus nicht erwartet. Ich teile Ihnen mit, daß ich den Beamten, von dem Sie sprachen, niemals in meinem Hause empfangen habe, weder in seiner eigenen noch in fremder Maske. Allerdings hat Philipp Iwanowitsch Potantschikow mich besucht, und wenn er sich freilich auch um meiner Tochter Hand beworben hat (er ist ein höchst ehrenwerter, nüchterner und hochgelehrter Mann), so habe ich ihm doch niemals die geringste Hoffnung gegeben. Sie erwähnen noch der Nase. Wenn Sie damit meinen, ich hätte Ihnen eine Nase, das heißt eine abschlägige Antwort oder einen sogenannten Korb geben wollen, so wundert es mich im höchsten Grade, daß Sie selbst davon reden, während ich doch, wie Ihnen wohl bekannt, der ganz entgegengesetzten Meinung war, und wenn Sie jetzt in gesetzlicher Weise um meine Tochter werben, so bin ich sofort bereit, Ihrem Wunsche entgegenzukommen, um so mehr, da dies stets der Gegenstand meines lebhaftesten Verlangens war, in welcher Hoffnung ich stets gern zu Ihren Diensten verbleibe