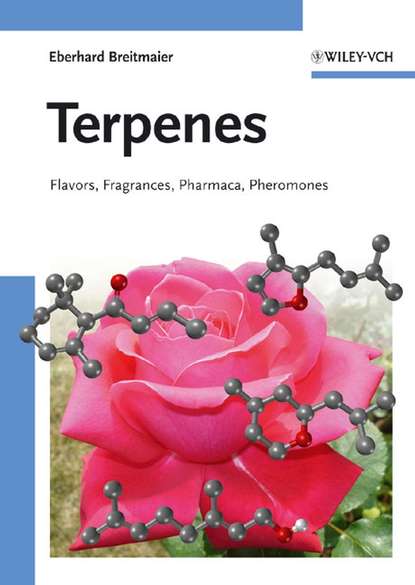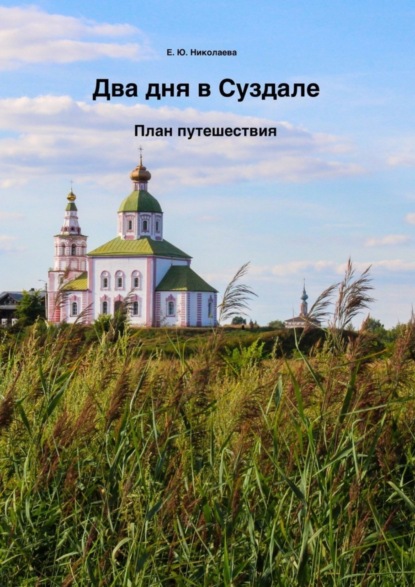- -
- 100%
- +
Alexandra Podtotschin.«
»Ja«, sagte Kowalow, als er den Brief gelesen, »sie ist wirklich unschuldig. Es ist nicht möglich. Der Brief ist so geschrieben, wie nur ein vollkommen unschuldiger Mensch schreiben kann.« Der Kollegien-Assessor war in dergleichen Dingen erfahren, weil er wiederholt noch im Kaukasus in amtlichem Auftrage gerichtliche Untersuchungen zu leiten gehabt hatte. »Aber auf welche Weise, mit Hilfe welcher Schicksalstücke ist denn das vor sich gegangen? Nur der Teufel begreift die ganze Geschichte!« rief er endlich und ließ die Hände sinken.
Mittlerweile hatte sich das Gerücht von diesem außergewöhnlichen Ereignis durch die ganze Stadt verbreitet, und zwar, wie das dann immer zu geschehen pflegt, nicht ohne besondere Zusätze. Damals waren alle Geister ganz besonders dem Ungewöhnlichen zugeneigt; das Publikum hatte sich soeben erst mit dem Magnetismus zu beschäftigen angefangen. Zudem war die Geschichte von den tanzenden Stühlen, die in der Marstallstraße gespielt hatte, noch frisch in aller Gedächtnis, und somit brauchte man nicht darüber zu staunen, daß man sich bald darauf erzählte, die Nase des Kollegien-Assessors Kowalow spaziere gegen drei Uhr auf dem Newski Prospekt umher. Täglich strömte eine große Menge von Neugierigen dorthin. Irgend jemand erzählte, die Nase habe sich in Junkers Ladenräumen gezeigt – und neben Junker entstand ein solches Gedränge und Gewühl von Menschen, daß sogar die Polizei einschreiten mußte. Ein gewisser Spekulant von ehrwürdigem Aussehen mit einem Backenbart, der vor dem Theater allerlei Kuchen verkaufte, fabrizierte sehr schöne hölzerne, dauerhafte Bänkchen, auf denen er die Neugierigen gegen Entrichtung von achtzig Kopeken sich aufstellen ließ. Ein verdienstvoller Oberst verließ deshalb extra früher als gewöhnlich das Haus und drängte sich nur mit großer Mühe durch die Menge; aber zu seinem nicht geringen Verdruß sah er in dem Ladenfenster statt der Nase eine gewöhnliche wollene Jacke, sowie das lithographierte Bild eines jungen Mädchens, das seinen Strumpf glatt zog, nebst einem stutzerhaften Burschen mit ausgeschnittener Weste und kleinem Bärtchen, der sie hinter einem, Baum hervor beobachtete – ein Bild, das schon mehr als zehn Jahre an ein und derselben Stelle hing. Beim Fortgehen sagte er grimmig: »Wie kann man nur mit solchen einfältigen, unwahrscheinlichen Gerüchten die Leute in Aufregung versetzen!« Dann ging die Sage, die Nase des Majors Kowalow spaziere nicht auf dem Newski Prospekt, sondern im Taurischen Garten umher; sie halte sich dort schon seit langer Zeit auf, und als Chosrew-Mirza dort noch wohnte, sei er über dieses seltsame Naturspiel im höchsten Grade erstaunt gewesen. Eine Anzahl Studenten der chirurgischen Akademie begab sich dorthin. Eine vornehme, ehrwürdige Dame bat in einem besonderen Brief den Inspektor des Taurischen Gartens, ihren Kindern dieses seltene Phänomen zu zeigen, und womöglich belehrende und bildende Erklärungen für die Jugend hinzuzufügen.
Über all diese Vorgänge waren natürlich alle diejenigen unvermeidlichen Besucher aller Bälle der Gesellschaft hocherfreut, die gern die Damen lachen machten und deren Stoff zu jener Zeit völlig erschöpft war. Nur wenige ehrwürdige, wohlgesinnte Leute waren unzufrieden. Ein Herr äußerte sich mit Unwillen dahin, daß er nicht begreife, wie man in dem gegenwärtigen erleuchteten Jahrhundert so unsinnige Erfindungen verbreiten könne, und er sei höchst er staunt, daß die Regierung nicht ihre Aufmerksamkeit darauf lenke. Dieser Herr gehörte, wie hieraus zu ersehen, zu denjenigen, welche die Regierung in alles verwickeln möchten – sogar in ihre eigenen täglichen Streitigkeiten mit ihrer Frau. Gleich darauf – aber hier verhüllen sich alle Ereignisse wieder mit nebelhafter Dunkelheit, und was ferner geschah, ist ganz und gar nicht bekannt geworden.
Das Porträt (1842)
Erster Teil
Nirgends blieben so viele Leute stehen wie vor dem kleinen Bilderladen in der Schtschukinpassage. Der Laden zeigte aber auch ein Sammelsurium der sonderbarsten Herrlichkeiten. Den meisten Raum beanspruchten die Ölgemälde, die blank von grünlich angehauchtem Firnis waren und durch stumpf gelbe Goldrahmen in ihrer Buntheit noch gehoben wurden. Ein weißer Winter mit beschneiten Bäumen, ein knallig roter Sonnenuntergang, der mehr an eine Feuersbrunst gemahnte, ein holländischer Bauer mit bös verrenktem Arm und langer weißer Pfeife, der eher einem Truthahn in Manschetten als einem Christenmenschen ähnlich sah – das etwa waren die Motive dieser Bilder. Doch auch Porträts in Stahlstich fehlten nicht: Chosrew-Mirsa, die Lammfellmütze auf dem Kopf, und ein paar Generale in Dreimastern und mit windschiefen Nasen. Ferner hingen an der Ladentür gleich ganze Stöße grober Holzschnittbilderbogen, Erzeugnisse der durch kein Studium beirrten Kunstbegabung unseres Volkes. Da sah man die Prinzessin Miliktrissa Kirbitjewna sowie auf einem andern Blatt die Stadt Jerusalem, bei der die Häuser und die Kirchen ohne Federlesen dick mit roter Farbe überpinselt waren. In diesem Rot ertrank auch noch ein Teil des Erdbodens nebst zwei kleinrussischen Bäuerlein in Fausthandschuhen, die anbetend vor den heiligen Stätten knieten. Käufer für solche Kunstwerke sind sicher äußerst rar, Bewunderer hingegen trifft man immer haufenweise. Ganz ohne Zweifel findest du vor ihnen jederzeit den einen oder andern bummligen Bedienten, in seiner Linken die Menage mit dem Mittagessen, das er für seinen Herrn aus einem Restaurant geholt hat; eins ist nicht zu bezweifeln: seinen Mund wird sich der arme Herr an der Kohlsuppe heute nicht verbrennen. Daneben steht dann wohl in fadenscheinigem Mantel einer der Kavaliere unserer Trödelmärkte, ein abgemusterter Soldat, der ein paar Federmesser feilhält, und etwa eine Vorstadthausiererin, am Arm den großen Korb voll Filzpantoffeln. Ein jeder äußert hier die Kunstbegeisterung auf seine Art: die Bauern fassen die Drucke mit den Fingern an, die »Kavaliere« mustern sie mit wichtiger Miene, die Laufburschen und Handwerkslehrlinge erheben ein Gelächter und finden in den ausgehängten Fratzen verblüffend viele Ähnlichkeiten mit den Kameraden, die gerade neben ihnen stehen. Die alten Diener in den groben Mänteln verweilen hier, weil es ja schließlich einerlei ist, wo sie Maulaffen feilhalten, die jungen Trödlerinnen zieht es unwillkürlich überallhin, wo das Volk sich sammelt, sie kommen angelaufen, um zu hören, was die Leute schwätzen, und festzustellen, was es da zu sehen gibt.
Ohne sich dabei etwas zu denken, hemmte der junge Maler Tschartkow, der ganz von ungefähr des Weges kam, vor diesem Laden seinen Schritt. Er hatte einen alten Mantel an und war im übrigen recht nachlässig gekleidet. Das deutete auf einen Mann, der sich mit Selbstverleugnung seiner Arbeit widmet und deshalb keine Zeit hat, auf sein Äußeres zu achten, was doch für junge Leute sonst von tief geheimnisvollem Reiz ist. Er machte also vor dem Laden halt und lachte anfangs über die entsetzlich schlechten Bilder. Doch langsam wurde er nachdenklich und fragte sich, wem wohl in aller Welt mit dem Geschmier auf irgendeine Art gedient sein könnte. Nicht das erschien ihm wunderlich, daß sich der Russe aus dem Volk von diesen Recken einer grauen Vorzeit, von ihren Gastereien und Gelagen, von Foma und Jerjoma fesseln läßt – die Vorwürfe der Holzschnittbilderbogen waren gewiß volkstümlich und dem kleinen Mann zu Herzen sprechend. Aber wo in der Welt gab es wohl einen Käufer für die bunten, ruppig hingeklecksten Ölgemälde? Wem konnten diese holländischen Bauern, diese blitzblauen und knallroten Landschaften auch nur das geringste sagen, dieses Gesudel, das den Anspruch machte, auf einer irgendwie gehobenen Stufe der Malerei zu stehen, und das dabei die Kunst doch nur zutiefst erniedrigt und geschändet zeigte? Und dabei waren das durchaus nicht die Produkte eines blutigen Dilettanten. Sonst hätte daraus doch bei aller Unfähigkeit und Stümperei wenigstens der Drang, das Beste herzugeben, sprechen müssen. Hier aber war nur eines zu verspüren: absoluter Stumpfsinn und eine kraftlos kümmerliche Talentverlassenheit, die sich ganz unverfroren auf die Kunst geworfen hatte, da doch ihr eigentliches Feld im besten Fall ein Handwerk von der gröbsten Art gewesen wäre. Und diese traurige Talentverlassenheit blieb dabei ihrem angeborenen Beruf vollkommen treu – sie trieb die Kunst kaltblütig als ein ordinäres Handwerk. Dafür waren Zeugen diese Farben und der flotte Strich, das lockere Gelenk und die geübte Hand, die eher einem primitiven Automaten als einem richtigen Menschen zu gehören schienen . . . Tschartkow stand eine Weile vor den scheußlichen Gemälden und war mit den Gedanken bald woanders. Der Bilderhändler aber, ein ergrauter Mann in einem Mantel aus gemeinem Fries, mit einem Kinn, an dessen Stoppeln seit dem Sonntag kein Rasiermesser gekommen war, sprach mittlerweile lebhaft auf ihn ein und marktete und machte Preise, ohne sich vorher zu vergewissern, was Tschartkow eigentlich gefallen habe und ob er etwas von den Sachen kaufen wolle.
»Die Bauern da und hier die feine kleine Landschaft bekommen Sie zusammen für bloß fünfundzwanzig Rubel. Wie das gemalt ist! Das muß jedem in die Augen springen! Frisch von der Messe angekommen: der Lack noch nicht mal richtig trocken! Oder der Winter da – wenn Sie den Winter wollen . . . Fünfzehn Rubel! Das ist allein der Rahmen wert! Ja, so ein Winter stellt was vor!« Der Kaufmann schnippte mit dem Zeigefinger kräftig an die Leinwand, als könnte er auf diese Art die hohe Qualität des Winters augenfällig machen. »Soll ich die Bilder gleich zusammenbinden und Ihnen in die Wohnung schaffen lassen? Wie ist die werteste Adresse? Petruschka, he, reich mal den Bindfaden herüber!«
»Halt, lieber Freund, nur immer langsam!« rief der Künstler, als er, aus der Versunkenheit erwachend, sah, daß der gerissene Händler im Begriff war, die Bilder ganz im Ernst mit Bindfaden zu einem Packen zu verschnüren. Es schien Tschartkow ein wenig peinlich, nichts zu kaufen, da er schon gar so lange in dem Laden stand, und er fuhr fort: »Halt, halt, ich möchte lieber untersuchen, ob sich da unten nicht was für mich findet.« Er bückte sich zu einer Anzahl abgewetzter und verstaubter Bilder, die liederlich am Boden aufgestapelt lagen und sich in dem Geschäfte augenscheinlich nur geringer Wertschätzung erfreuten. Da gab's uralte Ahnenbilder, für die man hier auf Erden kaum noch einen Nachkommen gefunden hätte; da gab es löcherige Leinwanden, darauf sich überhaupt nichts mehr enträtseln ließ, und Rahmen, die den Goldglanz längst verloren hatten – mit einem Worte: nichts als schäbiges Gerümpel. Der Künstler aber sah den Haufen durch und dachte insgeheim: ›Vielleicht kann ich da doch etwas entdecken.‹ Er hatte oft davon erzählen hören, wie der und jener schon in solchem alten Plunder Werke großer Meister aufgestöbert hätte.
Sowie der Händler sah, wofür sich Tschartkow interessierte, erlahmte sein geschäftiger Eifer alsobald; er trat mit der gehörigen Würde wieder auf seinen alten Posten vor der Tür und rief die Leute an und wies auffordernd in den Laden: »Treten Sie näher, Herr! Hier gibt es Bilder . . .! Nur hereinspaziert, hereinspaziert! Frisch von der Messe angekommen!« Als er sich, ohne etwas damit zu erreichen, halb kaputt geschrien hatte, begann er ein ausführliches Gespräch mit einem Trödler, der ihm gerade gegenüber gleichfalls in der Türe lehnte; doch endlich fiel ihm ein, daß ja in seinem Laden noch ein Kunde war. Da wandte er den Leuten draußen kurz den Rücken und trat zu Tschartkow hin. »Na, Herr? Was ausgesucht?« Der Künstler aber stand schon eine Weile regungslos und starrte auf ein Porträt in einem schweren breiten Rahmen, der sicher in vergangenen Tagen einmal vornehm und höchst prunkvoll ausgesehen hatte, heute aber kaum noch schwache Spuren von Vergoldung aufwies.
Dies Bildnis stellte einen alten Mann dar. Ein fleischloses, bronzefarbenes Gesicht mit breiten Backenknochen. Der Maler hatte seine Züge offenbar in einem Augenblick krampfhafter Erregung festgehalten. Und nicht die stille Kraft des Nordens sprach aus ihnen, des Südens Flammensiegel war auf diese Stirn gedrückt. Um seine Glieder wallte ein weites orientalisches Gewand. War das Porträt auch arg verschmutzt und stark beschädigt – kaum hatte Tschartkow das Gesicht vom Staub gereinigt, da erkannte er die Handschrift eines großen Malers. Das Bild schien unvollendet; doch die Kraft des Künstlerpinsels wirkte schlagend. Besonders zeigte sich das an den Augen; der Maler hatte alles, was sein Pinsel konnte, und all sein Streben eingesetzt, um sie zu treffen. Sie sahen einen wirklich an aus dem Porträt heraus und wollten dessen Harmonie beinah zerstören durch ihre seltsame Lebendigkeit. Als Tschartkow nun das Bild zur Ladentüre trug, da wurde der Blick der Augen noch viel lebhafter. Und auch die Leute draußen spürten das. Denn eine Frau, die hinter Tschartkow stand, schrie ganz erschrocken: »Hu, wie er einen ansieht! Hu!« und fuhr zurück. Ein unbehagliches Gefühl, das er sich selber nicht erklären konnte, beschlich den Künstler. Eilig lehnte er das Bild von neuem an die Wand.
»Na, nehmen Sie nun das Porträt?« fragte der Händler.
»Ja, was soll es kosten?« fragte Tschartkow.
»Was wird man denn dafür schon groß verlangen? Drei Viertelrubel, sagen wir!«
»O nein.«
»Was bieten Sie mir denn?«
»Zwanzig Kopeken allerhöchstens«, sagte Tschartkow da und wendete sich rasch zum Gehen.
»Was Sie für einen Schundpreis bieten! Einen Zwanziger! Da kostet ja der Rahmen mehr! Sie wollen es dann wohl erst morgen kaufen? – Halt, Herr, bleiben Sie! Bloß einen Zehner legen Sie noch drauf! – Na also, meinetwegen denn, in Gottes Namen! Geben Sie her den Zwanziger! So wahr ich lebe, bloß weil es mein Handgeld ist – Sie sind der erste, der mir heut was abkauft.«
Danach wischte der Händler mit der Rechten durch die Luft, wie wenn er sagen wollte: Hol's der Kuckuck, fort mit Schaden!
So hatte Tschartkow unversehens das Porträt gekauft und dachte sich dabei in seinem Sinn: ›Wozu kauf ich das eigentlich? Was hab ich denn davon?‹ Er holte einen Zwanziger aus der Tasche, gab ihn dem Händler, klemmte das Porträt unter den linken Arm und ging hinaus. Wie er so durch die Straße schritt, fiel es ihm auf die Seele, daß das sein letzter Zwanziger gewesen war. Ihm wurde plötzlich trüb und weh zumute; geheimer Zorn und eine dumpfe Gleichgültigkeit bekämpften sich in ihm. »Zum Teufel noch einmal! Ist das ein dreckiges Leben!« sprach er im ärgerlichen Ton des Russen, dem es schlecht geht, vor sich hin. Mechanisch ging er schnellen Schrittes weiter und achtete auf nichts von dem, was um ihn war. Das rote Licht des Sonnenuntergangs erhellte noch das halbe Himmelsrund; die Häuser, die gen Abend schauten, beglänzte abschiednehmend noch ein letzter warmer Schein; langsam gewann zugleich das kalte Dämmerblau des Mondes an Gewalt. Die Häuser und die Menschen warfen endlos lange, leichte, durchsichtige Schattenstreifen auf die Erde. Des Malers Auge ward allmählich wider Willen gefesselt von dem Himmel droben, der still in Ungewissem, duftig klarem Lichte stand. Fast gleichzeitig entrannen seinen Lippen die zwei Sätze: »Blödsinnig fein im Ton!« und »Hol der Teufel diese Tränenwelt!« Er drückte das Porträt, das immer wieder seinem Arm entgleiten wollte, fester an sich und schritt schneller aus.
Todmüde und in Schweiß gebadet, erreichte er die Straße, wo er wohnte: die fünfzehnte Querstraße auf der Wassilij-Insel. Schwer atmend und nicht ohne unterwegs ein paarmal auszurasten, erstieg er dann die Treppen, wo Spülwasser ausgegossen war und wo die Hunde und die Katzen manche Spuren ihres Daseins hinterlassen hatten. Als Tschartkow droben an die Tür klopfte, blieb drinnen alles still. Niemand zu Hause. Er stützte sich aufs Fensterbrett und wartete geduldig, bis hinter ihm ein Schritt erscholl und sich ein junger Bursch in blauem Hemd zeigte. Der Bursch war unsres Malers dienstbarer Geist, der ihm Modell stand, seine Farben rieb und ihm den Boden fegte, den er jedoch zu gleicher Zeit mit seinen Stiefeln wieder frisch verdreckte. Er hieß Nikita, und er trieb sich, wenn sein Herr abwesend war, beständig unten vor dem Tor umher. Nikita suchte lange tastend nach dem Schlüsselloch, das in der Dunkelheit nicht leicht zu finden war. Doch endlich ging die Türe auf. Tschartkow betrat sein Vorzimmer, in dem die fürchterlichste Kälte herrschte, wie es bei Künstlern meist der Fall ist, ohne daß sie es jedoch bemerken. Der Maler legte seinen Mantel dort nicht ab und ging gleich in sein Atelier, ein großes, aber niedriges quadratisches Gemach mit dick befrorenen Fensterscheiben, wo eine Menge Ateliergerümpel sich herumtrieb: zerbrochene Gipsgliedmaßen, leinwandbespannte Keilrahmen, flüchtige Skizzen, kaum begonnen, schon verworfen, nachlässig über Stuhllehnen gehängte Draperien. Tschartkow war ganz erschöpft; er warf den Mantel ab und lehnte das Porträt, das er mit heimgetragen hatte, tief in Gedanken zwischen ein paar andere Bilder von kleinerem Formate an die Wand. Dann sank er auf den Diwan, dem man es eigentlich nicht gut nachsagen konnte, daß er mit Leder »überzogen« sei; denn all die vielen blanken Messingknöpfe, die einst das Leder festgehalten hatten, führten schon längst ein Leben ganz für sich, wie sich der Überzug denn gleichfalls selbständig gemacht hatte und so Nikita in die Lage setzte, darunter schmutzige Strümpfe, Hemden sowie andere Wäschestücke zu verstauen. Als er ein Weilchen stumpf auf diesem Möbel gesessen und gelegen hatte, soweit von Liegen bei dem schmalen Diwan überhaupt die Rede war, rief Tschartkow endlich laut nach Licht.
»Ist doch kein Licht mehr da«, erwiderte Nikita.
»Was heißt: ›kein Licht‹?«
»War doch schon gestern keins mehr da«, brummte Nikita.
Richtig, schon gestern hatte es kein Licht gegeben. Der Maler nickte matt und fand sich damit ab und sagte weiter nichts. Er ließ sich aus den Kleidern helfen und zog den äußerst fadenscheinigen Schlafrock an.
»Ach ja, und dann ist auch der Hauswirt dagewesen«, meldete Nikita.
»Wegen des Geldes wohl? Schon recht«, erwiderte der Maler und schlug wegwerfend mit der Linken durch die Luft.
»Er hatte heute aber jemand bei sich«, fuhr Nikita fort.
»Bei sich? Wen denn?«
»Weiß nicht . . . Den Polizeiwachtmeister . . .«
»Was wollte denn der Wachtmeister?«
»Weiß nicht. Er sagte: weil die Miete nicht bezahlt ist.«
»Na, was soll dann sein?«
»Weiß nicht, was sein soll. Bloß hat er gesagt: ›Wenn er nicht zahlen will‹, hat er gesagt, ›dann muß er aus dem Haus.‹ Sie wollten morgen beide wiederkommen.«
»Sollen nur kommen«, sagte Tschartkow. Eine dumpfe Traurigkeit warf ihre Schleier über ihn.
Der junge Tschartkow war ein Künstler von Begabung, der für die Zukunft viel versprach. Was ihm in den Momenten gehobener Inspiration gelang, das zeugte von geschärftem Blick und Sinn für strenge Komposition, von einem eifervollen Drang, sich der Natur zu nähern. »Mein lieber Tschartkow«, sagte sein Professor oft zu ihm, »Sie haben zweifellos Talent. Es wär 'ne Sünde und 'ne Schande, wenn Sie's verkommen und verludern ließen. Woran es fehlt, das ist die Ausdauer. Wenn Sie mal etwas reizt, wenn Ihnen was gefällt, dann stürzen Sie sich drauf, und alles andere scheint Ihnen Dreck und Tand. Sie wollen überhaupt nichts andres sehen. Nehmen Sie sich wohl in acht, daß Sie kein Modemaler werden! Schon heute kreischen Ihre Farben manchmal gar zu laut. Sie zeichnen auch bei weitem nicht solid genug. Oft ist die Zeichnung einfach schwach, alle Konturen ganz verblasen. Sie werfen sich auf den modernen Beleuchtungsschwindel und auf dergleichen billigen Kitsch, der jedem Esel in die Augen sticht. Sehn Sie sich vor: auf einmal stecken Sie, hast du nicht gesehen, tief in der englischen Manier. Sehn Sie sich vor: schon streckt die eitle Oberflächlichkeit nach Ihnen ihre Krallen aus. Sie laufen auch zuzeiten mit einer stutzerhaften Halsbinde und einem blankgebügelten Kastor umher. Es ist ja sehr verlockend, Geld zu machen mit modernen Bildchen und Porträtchen. Bloß geht bei der Beschäftigung das Talent zum Kuckuck, statt daß was Rechtes daraus wird. Geduld, Geduld! Und jede Arbeit innerlich ausreifen lassen! Sollen andere den Stutzer spielen und leicht verdientem Geld nachjagen – das Geld, das Ihnen mit der Kunst noch einmal zu erwerben vorbestimmt ist, das läuft Ihnen nicht davon!«
Teilweise hatte der Professor recht. Zuweilen packte Tschartkow wohl die Lust, flott in den Tag hineinzuleben und sich fein zu kleiden, kurzum, sich seiner Jugend leichtsinnig zu freuen; doch er behielt sich stets im Zügel. Zuzeiten konnte er beim Malen alles um sich her vergessen; riß er sich dann zum Schluß von seiner Arbeit los, so glich es dem Erwachen aus einem wunderschönen Traum. Auch sein Geschmack war gut gebildet. Wohl hatte er die Tiefe Raffaels noch nicht so recht erfaßt, doch fühlte er sich hingerissen von Guidos saftigem, breitem Strich, er ließ sich fesseln von den Porträts des großen Tizian und schwärmte für die Niederländer. Noch hatte sich der dunkle Schleier, der diese alten Bilder deckt, vor seinen Augen nicht gelichtet, doch konnte er durch ihn hindurch schon mancherlei erkennen, wenn er sich auch in seinem Innersten nicht unbedingt der Meinung des Professors unterwerfen wollte, die alten Meister seien Vorbilder für uns, die ewig unerreichbar blieben. Er fand sogar, daß unser neunzehntes Jahrhundert die Alten doch in manchen Stücken überflügelt hätte. Man stünde heute der Natur intimer gegenüber und wisse sie mit mehr Lebendigkeit und Treue nachzubilden. Kurzum, er dachte, wie nun einmal junge Leute denken, die schon etwas erreicht haben und innerlich sehr stolz auf das Erreichte sind. Es konnte ihn empören, wenn irgend so ein zugereister Maler aus Frankreich oder Deutschland, der oft nicht einmal Maler von Beruf war, wenn so ein Mensch bloß durch die flotte Technik, durch breiten Strich und knalliges Kolorit ein mächtiges Geschrei erregte und sich im Handumdrehen ein Vermögen machte. Solche Gedanken lagen ihm sehr fern, wenn er von seiner Arbeit hingenommen war und Speis und Trank, kurzum, die ganze Welt darob vergaß; sie plagten ihn nur in den Zeiten, wo die Not bei ihm am Ende gar zu groß geworden war, wenn er kein Geld für Farben, Leinwand noch auch Pinsel mehr besaß und wenn der ungeduldige Hausherr des Tages zehnmal erschien und die längst fällige Miete einkassieren wollte. Dann schien der durch den Hunger aufgepeitschten Phantasie des armen Kerls das Los des reichen Malers höchst beneidenswert; dann stand in ihm wohl der Gedanke auf, der, ach so oft, verführerisch durch die Russenköpfe geistert: den ganzen Krempel hinzuschmeißen und seinen Kummer zu versaufen, Gott und der Welt zum Trotz! – Na ja, und gerade heute lag ihm die Art von Stimmung nur zu nah.
»Geduld, Geduld!« so sprach er grimmig vor sich hin. »Auch die Geduld hat schließlich ihre Grenzen. Geduld! Und wovon soll ich morgen mittag essen? Gepumpt krieg ich von keinem was. Wenn ich auch alle meine Bilder und alle Zeichnungen dazu verkaufen wollte, der ganze Kram trägt mir noch keinen Zwanziger ein. Sie hatten freilich ihren Zweck, das fühl ich ganz genau. Umsonst hab ich kein Stück davon gemacht; an jedem habe ich mein Teil gelernt. Aber was nützt mir das? Bloß Studien und Skizzen, die ewiglich nur Studien und Skizzen bleiben, und weiter wird nichts draus. Wer soll sie denn auch kaufen, da doch niemand meinen Namen kennt? Wer kann denn etwas anfangen mit diesen Zeichnungen nach der Antike und Studien nach der Natur, oder mit meiner »Psyche«, die niemals fertig wird, oder mit dieser Innenansicht meines Zimmers oder mit dem Porträt Nikitas, und wenn es zehnmal besser ist als irgend so ein Kitschporträt von einem Modemaler? Zum Teufel noch einmal! Was plag ich mich und schinde mich gleich einem Schuljungen in einem fort nur mit dem Abc, wo ich doch einen Namen haben und mir Geld verdienen könnte, so gut wie irgendeiner von den andern?«
Kaum waren diese Worte seinem Mund entronnen, da packte unsern Maler jäh ein Zittern; er wurde totenbleich: zwischen den Leinwanden hervor, die drüben lehnten, sah ihn ein krampfverzerrtes Antlitz an; zwei fürchterliche Augen bohrten ihren Blick in seine Stirn, als wenn sie ihn verschlingen wollten; zwei stumme Lippen riefen ihm dräuend zu, er solle schweigen. Schon war der Maler im Begriff, laut aufzuschreien, um Nikita, der draußen schon ein fürchterliches Schnarchen angehoben hatte, zu sich in das Atelier zu rufen. Doch er besann sich auf einmal und mußte lachen: das war bloß das Porträt, das er gekauft und mittlerweile wieder ganz vergessen hatte. Der Mondschein, der durchs Zimmer wallte, fiel auf das Bild und lieh ihm diese gespenstische Lebendigkeit. Er machte sich daran, es näher zu betrachten und zu säubern. Er tauchte einen Schwamm ins Wasser und fuhr damit ein paarmal über das Porträt. So wusch er fast den ganzen Staub und Schmutz herunter, der sich durch viele Jahre angesammelt hatte. Dann hängte er das Bildnis an die Wand und mußte mehr noch als im Anfang staunen, wie meisterhaft gemalt es war. Dies Gesicht schien ihm zu leben, diese Augen sahen so fest auf ihn, daß er zum Schluß entsetzt zurückfuhr und zitternd rief: »Er starrt mich an! Das sind lebendige Menschenaugen!« Und ihm fiel ein, was ihm vor längerer Zeit schon sein Professor über ein Bildnis Lionardo da Vincis Seltsames berichtet hatte. Der große Meister mühte sich an dem Porträt durch viele Jahre und hielt es immer noch nicht für vollendet, indessen es doch nach Vasaris Zeugnis von aller Welt als unerhört vollendetes, schlechthin vollkommenes Werk der Kunst gepriesen wurde. Vollendeter als alles andre waren auf dem Bild die Augen; sie weckten Staunen und Bewunderung bei den Zeitgenossen. Sogar das kleinste Äderchen darin, das kaum noch zu erkennen war, hatte des Künstlers Pinsel treulich festgehalten. Das Bildnis nun, das heute hier vor Tschartkow hing, besaß etwas ganz Sonderbares. Das konnte schon nicht mehr als Kunst bezeichnet werden, denn es zerriß die ganze Harmonie des Bildes; die Augen wirkten wie lebendige Menschenaugen, als wären sie aus eines Menschen Angesicht geschnitten und lebendig in die Leinwand eingefügt. Vor diesem Bild empfand man nichts von dem erhabenen Genuss, der unsre Seele bei dem Anblick eines Meisterwerkes packt, mag dessen Vorwurf noch so grausig sein – hier lähmte den Beschauer ein schmerzlich quälendes Gefühl. ›Wie kommt das?‹ fragte sich der Maler unwillkürlich. ›Das ist doch bloß Natur, lebendige Natur . . . Woher denn also das seltsam peinliche Gefühl? Ist schon die sklavische, buchstabentreue Abschrift der Natur Versündigung am Geist der Kunst und wirkt gleich einem grell dissonierenden Gekreisch? Oder kommt es daher, daß hier der Maler sein Modell nicht mit dem rechten Anteil und Gefühl betrachtet, daß nicht die Seele ihm die Hand geführt hat? Steht darum bloß die schauerliche Wirklichkeit des Dargestellten auf der Leinwand, von keinem Glanz der unergründlichen Idee durchhellt, die heimlich hinter allen Dingen waltet? Gleicht das hier nicht der Wirklichkeit, die sich dem Blicke öffnet, wenn man zu dem Messer des Chirurgen greift, um eines Menschen Schönheit zu ergründen? Man schneidet ihm das Innere auf und sieht nur Gräuel und Entsetzen! Warum scheint dir die einfachste und niedrigste Natur, wenn sie der rechte Künstler abmalt, von einem ganz eigenen Licht verklärt, und du empfindest nichts von Niedrigkeit? O nein, du hast den edelsten Genuss daran und meinst zu spüren, wie sich der Strom der Welt um dich zu stillerem Fließen glättet? Warum scheint dir das gleiche Stück Natur, wenn es ein andrer Künstler auf die Leinwand bannt, von Hässlichkeit und Schmutz erfüllt, und mag der Künstler die Natur genauso treu darstellen wie der erste? Nein, nein, es fehlt an seinem Bilde doch etwas: das Leuchten, das von innen kommt. Das ist genauso wie ein Blick ins Land: mag auch die Aussicht noch so wunderherrlich sein – steht nicht der Sonnenball am Firmament, so fehlt ihr irgend etwas.‹