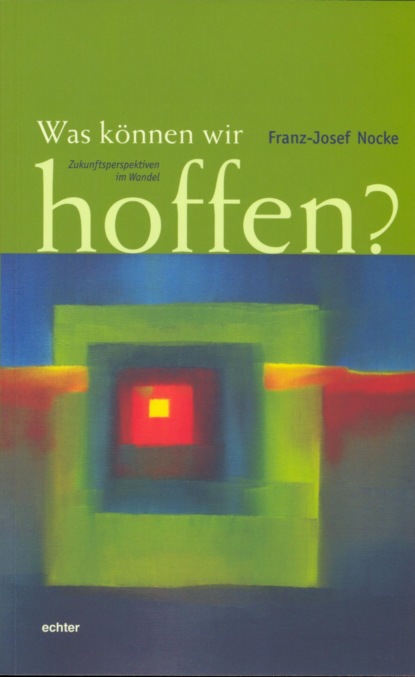- -
- 100%
- +
Dazu gibt es eine Parallele in neueren geistlichen Liedern, Texten und Meditationen. Einen ähnlichen Stellenwert, wie ihn vor drei Jahrzehnten Aufbruchs- und Befreiungsgesänge hatten, nehmen heute Einstimmungen zur Konzentration auf den gegenwärtigen Augenblick und auf die eigene Mitte ein, wie etwa der rasch beliebt gewordene Taizé-Gesang „Bei Gott bin ich geborgen, still, wie ein Kind“11 oder ein Text von Andreas Gryphius (1616–1664), der mir in letzter Zeit auffallend häufig begegnete: „Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen. Der Augenblick ist mein…“.12
In vielen geistlichen Übungen heute verbindet sich mit der Konzentration auf den gegenwärtigen Augenblick die Konzentration auf die eigene Mitte. Vielleicht kann man sagen: Während für die Spiritualität der sechziger und siebziger Jahre das Politische Nachtgebet mit seinen Impulsen zu konkreten gesellschaftlichen Veränderungen ein epochales Charakteristikum war, sind heute etwa die „Reise nach innen“ zur Findung der eigenen Mitte und das Stillwerden zur Wahrnehmung der Gegenwart epochaltypische Frömmigkeitsformen.
Dies ist natürlich eine extrem holzschnittartig vereinfachende Darstellung. Ich schreibe sie nicht auf, um zu werten oder eine Epoche gegen die andere auszuspielen, sondern um die möglichen Konturen eines (in Wirklichkeit viel differenzierteren) Wandels zu erkennen, und um meine Frage zu verdeutlichen: Was wird aus unserer Hoffnung? Gehört zur Hoffnung nicht das Interesse an der Zukunft? Gehört zu ihr nicht auch der Wille, die kommende Wirklichkeit mitzugestalten?
Sehnsucht
Vielleicht zeigt sich aber noch eine andere, relativ neue Brücke zur Hoffnung: die Sehnsucht. Seit einigen Jahren begegnet mir dieses Wort häufiger, und zwar wiederum ebenso in profanen wie in religiösen Zusammenhängen. Plötzlich stand es in den Feuilletons, der Computer des Buchhändlers listet viele Hunderte von Titeln mit der Vokabel „Sehnsucht“ auf, und die Werbesprache verspricht die Erfüllung aller Sehnsüchte.
Hat die Sehnsucht etwas gemeinsam mit der Hoffnung? Sie träumt von einer größeren, schöneren Wirklichkeit, sie streckt sich danach aus, sie überschreitet das Gegenwärtige und Vorhandene. Sie kann das Herz öffnen, sie kann aus der Selbstgenügsamkeit herausführen und sensibilisieren für das Geheimnis Gottes und für seine absolute Zukunft.
Aber gibt es nicht auch große Unterschiede? Ist die Hoffnung nicht aktiver? Spielen in ihr nicht das Wollen und das Handeln eine größere Rolle? Könnte die neuerliche Aktualität des Wortes „Sehnsucht“ ein Zeichen dafür sein, dass wir gegenwärtig weniger entschlossen sind, weniger zielgerichtet handeln, weniger motiviert, Zukunft zu gestalten, mehr mit uns selbst, mit unserer Befindlichkeit und mit unserem Schmerz beschäftigt, als etwa die Generation derer, die sich von Martin Luther King und von der lateinamerikanischen Hoffnungsbewegung inspirieren ließen?
Oder ist, bei aller begrifflichen Unterscheidung, in der lebensgeschichtlichen Praxis mit gleitenden Übergängen zu rechnen? Um es mit einem Bild zu sagen: Könnte die Sehnsucht mit ihren Träumen den selbstgenügsam Schlafenden unruhig machen, ihn aufwecken, ihn verlocken, aufzustehen und darauf zu setzen, dass die Träume realisierbar sind, sodass er sich nun konkrete Ziele setzt und sich aufmacht, sie zu erreichen? Könnte die Sehnsucht der Hoffnung eine neue Tür öffnen? Könnte es sogar sein, dass die Sehnsucht dann nicht etwa durch die Hoffnung überholt oder abgelöst wird, sondern dass sie den hoffenden Menschen weiter begleitet und, als Hunger des endlichen Wesens nach Unendlichkeit, daran erinnert, dass alle konkreten innerweltlichen Hoffnungsziele immer nur vorläufig, nie schon die letzte Erfüllung sein können?
Zu diesem Buch
Die Stichworte „Fortschritt“, „Traum“, „Apokalyptik“ und „Sehnsucht“ wollen wir uns in den folgenden Kapiteln etwas genauer anschauen. Anschließend werden wir auf Fragen und Denkimpulse eingehen, die aus dem Dialog mit jüdischer Theologie und mit der Naturwissenschaft sowie aus dem Gespräch über die Reinkarnationsidee kommen und mit denen sich heute eine christliche Theologie der Hoffnung zu beschäftigen hat. Und schließlich werden wir fragen, was die Hoffnung für das Verständnis des Sterbens bedeuten und wie sie grundsätzlich die Existenz der Hoffenden prägen könnte. Doch zuvor müssen wir uns mit der der Hoffnung eigentümlichen Sprache befassen.
1 GS 1.
2 Franz Kaulen, Hoffnung, in: Wetzer-Welte, Bd. 6, 1889, 148–151, Zit.: 148.
3 GS 39.
4 Elie Wiesel, Die Nacht, Freiburg 51996, 56. Die französische Originalausgabe erschien in Paris 1958.
5 Hans Jonas, Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme, Frankfurt am Main 1987, 12.
6 Vgl. Die Kirchen und das Judentum. Dokumente von 1945–1985, hrsg. von Rolf Rendtorff und Hans Hermann Henrix, Paderborn und München 1988, und den Fortsetzungsband: Dokumente von 1985–2000, hrsg. von Hans Hermann Henrix und Wolfgang Kraus, Paderborn und Gütersloh 2001.
7 Vgl. z. B. Johann Baptist Metz: „Fragt euch, wenn euch da eine neue Theologie begegnet, fragt euch: Ist das eine Theologie, die man vor und nach Auschwitz gleich treiben könnte? Und wenn ja, dann lasst sie, mit welchem Namen sie auch immer verbunden sein mag, dann lasst sie liegen!“, hier zit. aus der Podiumsdiskussion: Glaube und Widerstand nach Auschwitz, in: Auschwitz als Herausforderung für Juden und Christen, hrsg. von Günter B. Ginzel, Heidelberg 1980, 170–202, Zitat 175 f.
8 Vgl. z. B. Olaf Briese, Einstimmung auf den Untergang. Zum Stellenwert „kupierter“ Apokalypsen im gegenwärtigen geschichtsphilosophischen Diskurs, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 20 (1995) 145 bis 156.
9 Vgl. z. B. Michael N. Ebertz und Reinhold Zwick (Hrsg.), Jüngste Tage. Die Gegenwart der Apokalyptik, Freiburg 1999.
10 Vgl. dazu unten das 4. Kapitel.
11 Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, in: Gesänge aus Taizé. Neuausgabe Taizé 2000, Nr. 32. Der französische Originaltext wirkt allerdings weniger infantil als die deutsche Nachdichtung.
12 Andreas Gryphius, Betrachtung der Zeit (1663), hier zitiert aus: Das große deutsche Gedichtbuch, neu hrsg. von Karl Otto Conrady, Darmstadt 41995, 41.
2
Nicht Fahrpläne, sondern Perspektiven
Die Bildersprache der Hoffnung
„Lies keine Oden, mein Sohn, lies die Fahrpläne: sie sind genauer“ – als Hans Magnus Enzensberger vor fünf Jahrzehnten diese Verse „Ins Lesebuch für die Oberstufe“1 schrieb, ging es ihm wohl kaum um eine allgemeine Reflexion über die Sprache, sondern eher um einen politischen Appell. Manche Zeitgenossen nahmen diesen Text aber wie ein literarisches Programm: Poesie, die Sprache der Bilder, sei nicht mehr brauchbar, gebraucht werde die harte Sprache genauer Informationen.
Wie ein direkter Widerspruch dazu klingen einige Sätze in dem Grundsatzdokument der Würzburger Synode der westdeutschen Bistümer von 1975. In diesem Dokument, überschrieben „Unsere Hoffnung. Ein Bekenntnis zum Glauben in dieser Zeit“, heißt es:
„Wir Christen hoffen auf den neuen Menschen, den neuen Himmel und die neue Erde in der Vollendung des Reiches Gottes. Wir können von diesem Reich Gottes nur in Bildern und Gleichnissen sprechen, so wie sie im Alten und Neuen Testament unserer Hoffnung, vor allem von Jesus selbst, erzählt und bezeugt sind. Diese Bilder und Gleichnisse vom großen Frieden der Menschen und der Natur im Angesichte Gottes, von der einen Mahlgemeinschaft der Liebe, von der Heimat und vom Vater, vom Reich der Freiheit, der Versöhnung und der Gerechtigkeit, von den abgewischten Tränen und vom Lachen der Kinder Gottes […], wir können sie nicht einfach ‚übersetzen’, wir können sie eigentlich nur schützen, ihnen treu bleiben und ihrer Auflösung in die geheimnisleere Sprache unserer Begriffe und Argumentationen widerstehen, die wohl zu unseren Bedürfnissen und von unseren Plänen, nicht aber zu unserer Sehnsucht und von unseren Hoffnungen spricht.“2
Hinter den zuspitzenden Formulierungen der letzten Zeilen steht eine Auseinandersetzung um die Genauigkeit der Sprache, den Wirklichkeitsgehalt des Glaubens und die Wissenschaftlichkeit der Theologie. Bewegt sich der Glaube, wenn er zum Beispiel von der Versammlung der Völker auf dem Berg Sion, vom Kommen des Menschensohns auf den Wolken des Himmels, von der Auferstehung der Toten aus den Gräbern usw. redet, in einem überholten Weltbild? Spricht er die Sprache einer untergegangenen Vorstellungswelt? Wäre heute nicht eine genauere Sprache angebracht? In dieser Frage vollzog sich in der Theologie der letzten Jahrzehnte ein Wandel, den man als hermeneutischen Schlüssel zum Verstehen der neueren Eschatologie bezeichnen könnte.
„Die letzten Dinge“
Die neuscholastische Theologie des 19. Jahrhunderts, die bis um die Mitte des 20. Jahrhundert als die klassische katholische Schultheologie galt, wollte möglichst genau sein. Wenn sie in der Eschatologie von den „letzten Dingen“ sprach, klangen ihre Aussagen nicht wie dichterische Visionen, sondern wie ein sachlich distanzierter Bericht über bestimmte „Ereignisse“ in der Zukunft und über die nach diesen Ereignissen eintretenden „Zuständlichkeiten“.3 Lehrbücher der Eschatologie aus dieser Epoche lesen sich wie geographisch exakte Reiseführer in ein fremdes Land, und wie Fahrpläne, in denen die Stationen der Zukunft chronologisch genau verzeichnet sind. Man suchte physikalisch genau das Ende der Welt zu erklären, den „Weltbrand“, der als „Verbrennung der Erde und ihres Lufthimmels“ zu verstehen sei. Man machte sich Gedanken über den Zeitpunkt des Jüngsten Gerichts (vor oder nach dem Weltbrand?), über seinen Ort (im Tale Josaphat?), über den Wortlaut der Urteilssprüche, über die Dauer der gesamten Gerichtsveranstaltung, über die biologische Beschaffenheit des Auferstehungsleibes usw.4
Die neuscholastischen Theologen beriefen sich auf die Bibel und die kirchliche Tradition; aber mit ihrem Drang zur Genauigkeit unterschieden sie sich doch sehr von den Kirchenvätern, welche mit den biblischen Bildern spielerisch allegorisierend umzugehen wussten. Im Hintergrund dürfte, wenn auch unbewusst, das in der späten Neuzeit dominierend gewordene Ideal der „exakten“ Naturwissenschaften gestanden haben, das zu einem gewissen Minderwertigkeitskomplex bei den Geisteswissenschaften und zu entsprechenden Kompensationsversuchen beitrug.
Bildersprache
Demgegenüber hat die neuere Theologie (wie auch andere geisteswissenschaftliche Disziplinen) die spezifische Aussagekraft von Metaphern, Symbolen und Bildern wiederentdeckt. Für die Eschatologie ist die Unterscheidung zwischen exakter Informationssprache und offener Bildersprache besonders wichtig.
Zunächst einmal wegen der Herkunft der Eschatologie. Karl Rahner betonte in seinen „Überlegungen zur Hermeneutik eschatologischer Aussagen“ den Ursprung christlicher Zukunftserwartungen in den Erfahrungen der Gegenwart:
„Wir projizieren nicht von einer [etwa visionär geschauten] Zukunft etwas in die Gegenwart hinein, sondern wir projizieren unsere christliche Gegenwart in der Erfahrung des Menschen mit sich, mit Gott […] und in Christus auf seine Zukunft hin, weil der Mensch eben seine Gegenwart gar nicht anders verstehen kann denn als das Entstehen, das Werden, als die Dynamik auf eine Zukunft.“5
Das bedeutet sprachlich: Erfahrungen der Gegenwart werden zu Bildern der erhofften Zukunft. So ist es ja auch mit der Reich-Gottes-Verkündigung Jesu. Nirgends findet sich im Neuen Testament eine Definition dessen, was mit „Reich Gottes“ gemeint sei. Jesus lädt Menschen ein, mit ihm zu gehen und auf dem Weg mit ihm Erfahrungen zu machen. Sie erfahren, wie kranke Menschen geheilt, wie Gedrückte aufgerichtet, wie Geängstigte ermutigt werden, wie Menschen, die unfähig zur Kommunikation sind (Taube, Stumme, Blinde), oder die durch ihre Krankheit oder ihre gesellschaftliche Rolle ausgeschlossen sind (Aussätzige, Zöllner, Prostituierte), in die Gemeinschaft zurückgeholt werden. Sie erleben, wenigstens anfangshaft, einen neuen Umgang miteinander, Versöhnung und Zusammenführung bislang Verfeindeter, Geschwisterlichkeit statt Herrschaftsansprüche. Sie erleben sogar die Entmachtung des Todes. Sie erfahren verwundert, dass Jesus diese erstaunlichen Veränderungen nicht nur selbst bewirken kann, sondern dass er sie auch ihnen zutraut, als er sie in die Dörfer und Städte Israels schickt, und sie merken, dass sie wirklich dazu fähig werden. So fängt für sie das Reich Gottes an. So spüren sie die das Leben und die Welt verändernde Nähe Gottes.
Als sie nach der Ermordung Jesu die neue Lebendigkeit des Auferstandenen erfahren, da wächst ihnen die Gewissheit, dass dieses Reich Gottes Zukunft hat. Sie können ihren Glauben an Jesus mit den alten Hoffnungsbildern Israels verbinden: mit dem Bild vom Brot und Wein in Überfluss, vom friedlichen Nebeneinander der wilden Tiere, vom festlichen Friedensfest der Völker… Ihnen wird klar, dass alles bisher Erlebte erst ein Anfang war. Sie haben eine Zukunft vor Augen, in der die kleinen Saatkörner groß aufgehen werden. Sie können von dieser Zukunft eigentlich nur sprechen, indem sie von den kleinen Körnern reden. Sie können nicht anders als in Bildern sprechen. Aber diese Bilder sind keine geheimen Rätselworte, sondern sie erzählen von Erfahrungen: von Heilungen, Tischgemeinschaften, Auferstehungen.
So ist es mit der Sprache der Hoffnung. Es geht ja primär nicht um Informationen, sondern um Lebensperspektiven. Nicht eine ferne Zukunft soll detailliert und genau beschrieben werden, nicht himmlische oder höllische Landschaften sollen exakt dargestellt werden, als wären sie von Geographen vermessen, sondern dem Lebensweg soll eine Richtung gegeben werden: In welcher Richtung ist etwas zu erwarten? Welche Schritte zählen? Deshalb nennen wir die Eschatologie heute auch lieber nicht „Lehre von den letzten Dingen“, sondern „Theologie der Zukunft“ oder „Theologie der Hoffnung“. Hoffnungsperspektiven werden in Bildern aufgebaut.
Aber man sollte nicht sagen: „Ach, nur Bilder!“, als wären diese weniger wert als sachliche Informationen. Es kommt auf den Gegenstand an. Frage ich jemanden nach dem Weg, nach der Abfahrt des Zuges oder nach dem Preis für eine Ware, dann brauche ich eine Sachinformation. Die Tugend der Informationssprache ist ihre Genauigkeit: Bei Entfernungen, Uhrzeit, Preisen u.ä. geht es um Zahlen. Geht es aber um die Liebe oder um die Hoffnung, dann ist eine andere Sprache eher angebracht. Wenn ein Freund seiner Freundin verspricht, nicht von ihrer Seite zu gehen, wenn sie ihm sagt, sie wolle mit ihm ihr Lebenshaus bauen, dann sagen sie einander mehr, als wenn sie exakte Prognosen über den geographischen Ort ihres künftigen Wohnsitzes machten oder präzise finanzielle Regelungen miteinander absprächen.
Bildersprache ist auch nicht das bloße Ergebnis einer Verlegenheit, etwa: weil man es nicht genauer sagen kann; sie hat vielmehr ihre eigenen spezifischen Stärken. Bilder sind einerseits konkret und von daher fähig, an gegenwärtige Erfahrungen und Erwartungen anzuknüpfen; andererseits eignet der Bildersprache eine gewisse Offenheit. Die Bilder können in andere übergehen, sich selbst transzendieren, die Erwartungen können sich weiten, ohne dass die Kontinuität der Hoffnungs- und Verheißungsgeschichte verloren ginge. In diesem Sinne ist auch die Verwandlung biblischer Hoffnungsbilder interessant. Die Bibelwissenschaft spricht von „Motivtransposition“: Aus der Verheißung von Weideplätzen in der Abrahams-Geschichte wird die Verheißung eines Landes, in dem Milch und Honig fließen, in der Exodus-Geschichte. Der erste Exodus (aus Ägypten) wird durch einen noch großartigeren, zweiten Exodus (aus Babylon) übertroffen, der Bundesschluss am Sinai durch die Verheißung eines größeren, neuen Bundes.
Hoffnungsbilder leisten außerdem noch etwas Wichtiges: Sie sprechen mit dem Vorstellungsmaterial der Gegenwart von der erhofften Zukunft, und so verbinden sie Zukunft und Gegenwart miteinander. So wird die erhoffte Zukunft z. B. mit dem Bild eines festlichen Hochzeitsmahles geschildert. Damit werden konkrete irdische Ereignisse wie die Hochzeit, das Mahlhalten, das Miteinander-Teilen zu Vorzeichen einer guten Zukunft – und gewinnen so nochmals eine besondere Bedeutung.
Auch das Wort „Auferstehung“ ist ja ein Bildwort: Jemand, der liegt, erhebt sich. Das tun wir jeden Morgen. Das Aufstehen kann aber auch zum Bild für einen psychischen Vorgang werden. Wir sagen: Ich war „down“, „ganz unten“, wusste nicht, wie ich wieder auf die Beine kommen sollte. Da hat mich jemand „aufgerichtet“. Manche sprechen sogar ausdrücklich von einer „Auferstehung mitten im Leben“. Sie deuten damit an, dass sie einen Zusammenhang zwischen Rettungserfahrungen in diesem Leben und der Auferstehung aus dem Tod am Ende dieses Lebens sehen.6
Die neue Stadt
Was ich hier begrifflich entfaltet habe, möchte ich noch durch eine persönliche Erinnerung illustrieren. Ich denke an die Jahre meiner Mitarbeit in einer Kirchengemeinde im Duisburg-Meidericher Ortsteil Hagenshof. Der Hagenshof war von der Stadt als Mustersiedlung geplant worden, entwickelte sich aber mit seiner zur Anonymität verleitenden Hochhausarchitektur schon während der Bauzeit zu einem sozialen Brennpunkt. Monatlich wird in jeden Haushalt das Gemeindeblatt gebracht, in dessen Kopfteil, leicht stilisiert, die Skyline des Hagenshofs zu erkennen ist – und darunter steht: „die neue stadt“.
Als das Blatt im September 1971 zum ersten Mal erschien, fragten sich manche: Was ist damit gemeint? Der Ortsteil, der hier mit zahlreichen Baukränen errichtet wird? Oder ein biblisches Motiv, das himmlische Jerusalem, das sich am Ende der Zeiten vom Himmel herab auf diese Erde senkt? Gemeint war beides – die Bilder sollten ineinander übergehen: „Aus dem Glauben an einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo es weder Tränen noch Leid noch Jammer geben wird, will die Katholische Kirchengemeinde … ein wenig dazu beitragen, dass unsere Neubausiedlung Hagenshof eine neue Stadt wird, in der es schon jetzt viele frohe Menschen gibt“, schrieb der Gründungspfarrer in der ersten Ausgabe. Er spielte damit auf die Bilderwelt der Johannesoffenbarung7 an, in der wiederum Hoffnungsbilder des Alten Testaments, besonders aus den Büchern Jesaja und Ezechiel8 verdichtet sind.
Diese Bilderwelt hat im Laufe der europäischen Geschichte immer wieder dazu inspiriert, Heilsgeschichte und Weltgeschichte miteinander in Beziehung zu setzen. Der Philosoph, Literaturkritiker und Theologe Johann Gottfried Herder nannte die Johannesoffenbarung „ein Buch für alle Herzen und alle Zeiten“.9 In jüngster Zeit sprach der Journalist Paul Badde von dem Einfluss, den das biblische Bild von der himmlischen Stadt auf die abendländische Geschichte ausgeübt habe: „Es gibt einen Schlüssel zum Geheimnis Europas. Er findet sich am Schluss der Bibel… Diese Worte liegen fast allen Umwälzungen unseres Erdteils wie ein verborgener Code zugrunde.“10 Die Theologin Rita Müller-Fieberg hat eine differenzierte Dissertation über das Gespräch zwischen Theologie und Literatur über das Motiv „Neues Jerusalem“ vorgelegt. Sie schließt mit der Feststellung, das Bild von der verheißenen Stadt fordere dazu heraus, „die versprochene Lebensfülle schon jetzt in die eigene Gegenwart hineinzulassen.“11
Für uns, die wir jahrzehntelang die Bilderwelt der Johannesoffenbarung wie die verschlüsselte Botschaft einer uns fremden Welt eher umgangen hatten, traf sich ihre Wiederentdeckung mit der Neubelebung einer Theologie der Hoffnung. Heute rückschauend, sehen wir, woher wir gekommen waren und welchen Weg wir gegangen sind: Gegenüber einer „Jammertal-Frömmigkeit“, in welcher wir gelernt hatten, das „Irdische zu verachten und das Himmlische zu lieben“,12 wollten wir die Erde lieben, damit auf dieser Erde Himmel anfangen kann. In unseren jugendbewegten Träumen hatten wir das Geheimnis der Welt „jenseits des Tales“ gesucht, jetzt sollte Gottes geheimnisvolle Welt mitten in einer Hochhaus-Stadt wenigstens anfangshaft Wirklichkeit werden. Anders als im „Milieukatholizismus“ der ersten Jahrhunderthälfte, dem die Kirche wie eine Fluchtburg erschien, wie ein Bollwerk gegen die böse Welt draußen, sollte die Gemeinde dazu beitragen, dass es „frohe Menschen“ nicht nur im Gemeindezentrum, sondern im ganzen Hagenshof gibt: Kirche nicht in Abgrenzung zur Welt, sondern Kirche für die Welt. Im Unterschied aber zur Skepsis der Religionskritik, welche in der Religion nur ein Betäubungsmittel sah, mit dem geplagte Menschen sich vorübergehend über die Lasten des Lebens hinwegtrösten, das sie aber um so schlimmer lähmt, je mehr sie davon Gebrauch machen, setzten wir darauf, dass der Glaube ein Lebenselixier sein könnte: eine Prise Hoffnung zur Kräftigung für die nächsten Schritte. Es sollte eine „geerdete“ Hoffnung sein: Hier auf Erden soll anfangen, was einmal, bei der Vollendung der Schöpfung, ganz groß dastehen wird.
„In deinen Toren werd ich stehen…“
Es ist gewiss kein Zufall, dass unter den neuen geistlichen Liedern, die in dieser Gemeinde gesungen wurden, das Lied von der verheißenen neuen Stadt13 einen besonderen Platz einnahm. Das Lied geht mit seiner Melodie und mit manchen sprachlichen Bildern auf ein modernes israelisches Lied14 zurück, in welchem Jerusalem als ersehnte Stadt Israels besungen wird. Die durch die evangelische Pfarrerin Christine Heuser geschaffene deutsche Fassung setzt allerdings andere Akzente. Die „freie Stadt Jerusalem“ wird hier zu einem Bild für die ersehnte und erhoffte Vollendung der Welt. Das Ziel liegt noch in weiter Ferne. Die da singen, fühlen sich wie die Verschleppten in Babylon unter der Fremdherrschaft von mächtigen Herren. Ihre Wunden schmerzen:
„Ihr Mächtigen, ich will nicht singen
eurem tauben Ohr.
Sions Lied hab ich begraben
in meinen Wunden groß.“
Das erinnert an Motive des 137. Psalms:
„An den Strömen von Babel, da saßen wir
und weinten, wenn wir an Zion dachten.
Wir hängten unsere Harfen an die Weiden in jenem Land.
Dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder,
unsere Peiniger forderten Jubel: ‚Singt uns Lieder vom Zion!’
Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn,
fern, auf fremder Erde?“15
Aber ein Versprechen hält die Hoffnung wach:
„Ich halte meine Augen offen,
liegt die Stadt auch fern.
In die Hand hat Gott versprochen:
Er führt uns endlich heim.“
Aus den Bildern der Erinnerung an die Mühen und Schmerzen der eigenen Geschichte werden Bilder der Hoffnung, aus den Steinen der Gefängnisse und der Gräber werden die Mauern der kommenden Stadt:
„Die Mauern sind aus schweren Steinen,
Kerker, die gesprengt,
von den Grenzen, von den Gräbern,
aus der Last der Welt.“
Die Erinnerung an die vergossenen Tränen verschmilzt mit dem Bild von den Stadttoren, die nach der Johannesoffenbarung wie Perlen glänzen:
„Die Tore sind aus reinen Perlen,
Tränen, die gezählt.
Gott wusch sie aus unsern Augen,
dass wir fröhlich sind.“
Und immer wieder klingt im Refrain das Grundmotiv durch: die Hoffnung, einmal in dieser Stadt zu Hause zu sein:
„In deinen Toren werd ich stehen,
du freie Stadt Jerusalem.
In deinen Toren kann ich atmen,
erwacht mein Lied.“
Mit solchen Bildern der Hoffnung bekamen Menschen in der gemeindlichen Alltagspraxis Augen für die Perspektive der Hoffnung. Diese Hoffnung entdeckte inmitten all der Lebensfeindlichkeiten und Unbehaustheiten dennoch die Anfänge einer neuen Welt. In zusammengewürfelten, einander zunächst fremden Menschen wuchs zumindest eine Ahnung davon, was Wohnung, Heimat, Gemeinschaft bedeuten könnte. Gemeinde wurde zum Treffpunkt, wo man einander vom eigenen Leben erzählen konnte – und wo man lernen konnte, welche Freude es macht, einander beizustehen.