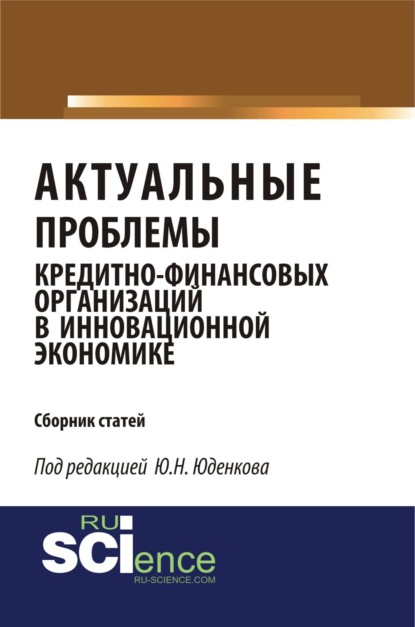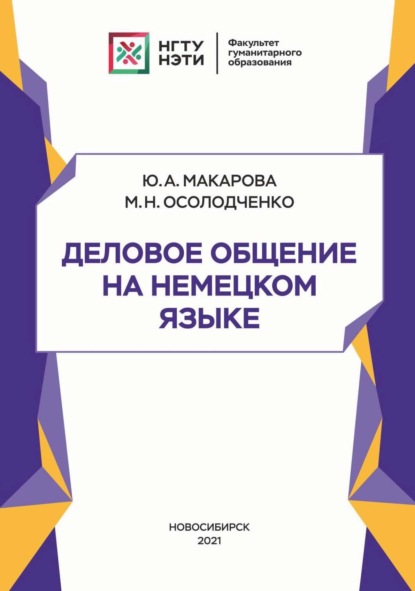- -
- 100%
- +
»Weihnachtsgeschenk?« Michelle war baff. »Sie ist doch nicht –«
Candice ließ sie gar nicht erst ausreden, sondern hob nur die Hand, um die Verabschiedung einzuläuten. »Also dann . . . mach’s gut. Viel Spaß in Anaheim. Wir . . .«, sie blickte zur Seite, als wäre da etwas, das sie sehen konnte und worauf sie sich sehr freute, ihr Gesicht leuchtete geradezu auf, »werden hier bestimmt viel Spaß haben. Das kann ich dir versprechen. Kannst es dir ja dann von . . . deiner Frau erzählen lassen, wenn sie zurückkommt.« Sie machte eine kurze Pause. »Ich meine . . . wenn sie zurückkommt.« Der Bildschirm wurde dunkel.
Perplex sank Michelle wie ein nasser Sack in ihren Bürosessel zurück, denn sie hatte sich zuvor während des Gesprächs von Sekunde zu Sekunde angespannter aufgerichtet. Was war denn hier auf einmal los?
»Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«, fragte Mrs. Lebowski von der Tür her.
Es war eine Art stille Verabredung zwischen ihnen, dass sie Michelle jederzeit ansprechen konnte, wenn die Tür offenstand. Wollte Michelle das nicht, schloss sie die Tür.
Tief durchatmend schüttelte Michelle den Kopf. Wahrscheinlich sah das immer noch so fassungslos aus, wie sie sich fühlte. »Nein, danke, Mrs. Lebowski.« Sie richtete sich wieder auf und saß kerzengerade in ihrem Stuhl, wie ein braves Schulmädchen.
Dennoch trat Mrs. Lebowski einen Schritt ins Büro hinein. Ihre Miene wirkte besorgt. »Ist irgendetwas mit . . . Cindy?«
Könnte man vielleicht so sagen, dachte Michelle. Obwohl ich ja selbst noch nicht einmal genau weiß, was es ist. »Wussten Sie, dass sie singen kann?« Fragend wandte sie ihr Gesicht ihrer Vorzimmerdame zu.
»Ja.« Mrs. Lebowski nickte. »Sie hat eine sehr schöne Stimme. Sheryl und sie haben einmal Happy Birthday für mich gesungen.« Sie schmunzelte. »Ich weiß gar nicht, wie sie meine Tochter dazu gebracht hat. Sie macht so etwas normalerweise nicht.«
»Cindy kann«, Michelle räusperte sich, »sehr überzeugend sein.«
»Sie ist ja auch eine außergewöhnlich nette junge Frau«, antwortete Mrs. Lebowski lächelnd. »Aber das muss ich Ihnen ja nicht sagen. Sie kennen sie besser als ich.«
Da bin ich gar nicht mehr so sicher, dachte Michelle.
»Wie geht es ihr?«, kehrte Mrs. Lebowski wieder zu dem etwas besorgten Gesichtsausdruck zurück, mit dem sie hereingekommen war. »Ist in Florida etwas passiert?«
Wenn ich das nur wüsste. Michelle konnte sich immer noch keinen richtigen Reim auf das Gespräch mit Candice machen. Sie kannten sich schon sehr lange, und eigentlich war Candice nie jemand für Intrigen gewesen. Auch wenn sie in ihrem Job mehr als genug damit konfrontiert wurde. Sie ignorierte das einfach und beteiligte sich nicht daran. Intrigen machen Falten, sagte sie immer. Und die wollte sie natürlich nicht haben.
»Nein, es ist nichts passiert«, beruhigte sie Mrs. Lebowski mit einem weiteren Kopfschütteln. »Sie scheint sich dort unten sehr gut zu unterhalten.«
Mrs. Lebowskis Gesicht hellte sich auf. »Dann ist es ja gut. Heutzutage weiß man ja nie . . .«
»Nein, nein.« Michelle wusste nicht genau, was sie tun sollte. Das war ein Zustand, den sie zwar durchaus kannte, aber noch nicht sehr oft erlebt hatte. Und mögen tat sie ihn noch viel weniger. »Sie ist ja bei ihrer Mutter.« Warum hatte sie das gesagt? Sollte sie das jetzt beruhigen?
»Sie sollten auch runterfliegen. Zu Weihnachten bei der Familie sein. Das ist doch immer das Schönste.« Begütigend hob Mrs. Lebowski die Hände. »Ich weiß, ich weiß. Sie können hier nicht weg. Aber wenn ich alle meine fünf Kinder zu Weihnachten um mich habe inklusive Anhang und Enkelkinder, bin ich einfach glücklich. Eine andere Art Weihnachten kann ich mir nicht vorstellen.«
»Ich habe keine fünf Kinder«, erwiderte Michelle ziemlich brüsk. Was sie gar nicht hatte sein wollen, aber diese Situation überforderte sie etwas. Geschäftliche Situationen taten das nie, private jedoch oft. »Und schon gar keine Enkel.«
»Was nicht ist, kann ja noch werden.« Mrs. Lebowski zwinkerte unbeeindruckt von Michelles Reaktion eindeutig herausfordernd. »Cindy ist ja noch jung.«
Das vertrieb die aus alter Gewohnheit so brüske Reaktion in Michelle und sie musste lachen. »Da trauen Sie ihr aber einiges zu. Dennoch ist es sehr nett von Ihnen, dass Sie wenigstens nicht davon ausgehen, dass ich die Kinder kriegen muss.«
»Erstens«, entgegnete Mrs. Lebowski trocken, »sind Sie«, sie hüstelte, »nicht mehr ganz so jung, und zweitens«, mit einem anerkennenden Blick musterte sie Michelle, »haben Sie hier eine Aufgabe, die sich schwer mit einer Schwangerschaft vereinbaren lässt. Und die kaum jemand anderer so gut erledigen könnte wie Sie.« Sie lächelte. »Ich bin froh, dass Sie da sind.« Damit drehte sie sich um und kehrte in ihr Vorzimmer zurück.
Woraufhin Michelle wieder mit ihren Gedanken allein war. Ihre Mundwinkel zuckten, dann lächelte sie leicht kopfschüttelnd. Mrs. Lebowski ließ manchmal so ganz nebenbei Sachen fallen . . . Oder die ganze Familie Lebowski. Ihre Tochter war ja genauso. Und vermutlich ihre restlichen Kinder auch. Die hatte Michelle noch nicht kennengelernt.
Normalerweise hätte sie sich jetzt einfach erneut ihrer Arbeit gewidmet, aber irgendwie erschien es ihr so, als wäre nichts an der aktuellen Situation normal. Also lehnte sie sich in ihrem Sessel zurück und dachte darüber nach. Sollte sie Cindy anrufen, um sich zu vergewissern, was da los war? Es konnte doch nicht sein, dass das stimmte, was Candice da angedeutet hatte. Aber warum hatte sie es dann angedeutet? Das war nicht gerade typisch für Candice.
Sicher, sie war keine Kostverächterin. Eine schöne junge Frau wie Cindy wäre ihr jederzeit ins Auge gefallen und hätte ihr Interesse erweckt. Mit Ehefrauen hatte sie auch kein Problem, wie sie selbst richtig gesagt hatte. Wenn die eine Affäre wollten oder sich auf eine einließen, war das eindeutig ihr Problem, nicht das von Candice. Aber mit Cindy?
Michelle fühlte, wie sich wieder Spannung in ihr aufbaute. Sie konnte Cindy vertrauen, das wusste sie. Wusste sie das? Auf einmal erinnerte sie sich daran, wie enttäuscht Cindy gewesen war, als sie nicht mit ihr über ein gemeinsames Weihnachtsfest sprechen wollte. Sie hatte gar nicht weiter darüber nachgedacht. Es war so selbstverständlich für sie, dass Weihnachten Arbeit bedeutete, nicht Vergnügen. Jedenfalls nicht für sie selbst. Und schon gar nicht privat.
Und schließlich hatte sie Colorado angeboten nach Weihnachten. Oder nicht? Sie runzelte die Stirn. Wahrscheinlich hatte sie die Tatsache unterschätzt, dass manche Leute dachten, Weihnachten müsste genau an dem Tag stattfinden, der dafür im Kalender vorgesehen war.
»Michelle?« Fragend blickte Chris zur Tür herein, die noch immer offenstand. »Hast du gerade Zeit?«
Hier komme ich ja sowieso nicht weiter, seufzte Michelle innerlich. Ist wie ein Taubenschlag heute. »Ja, komm rein.« Sie winkte mit der Hand und schaute ihrer Sicherheitschefin entgegen.
»Es geht um die besonderen Sicherheitsmaßnahmen für Weihnachten«, sagte Chris, kam auf Michelles Schreibtisch zu und legte ein Tablet darauf. »Hab’s noch nicht hochgeladen. Ich wollte erst, dass du es anschaust.«
»Ist das nicht dasselbe wie jedes Jahr?«, fragte Michelle, warf aber einen Blick auf den Bildschirm des Geräts.
Chris grinste. »Da bin ich in gewisser Weise überfragt. Ist mein erstes Weihnachten als Sicherheitschefin von Disneyland.«
»Ja natürlich.« Michelle nickte. »Das hatte ich schon fast vergessen.« Auf einmal hatte sie das Bedürfnis, Chris anzulächeln. Sie mochte sie wirklich sehr gern, auch wenn sie darüber nicht sprach. Aber Christine Stacey war die Art bodenständige Amerikanerin, die wie das Salz der amerikanischen Erde war, das diesem Land die Würze gab und die Stabilität. Man konnte sich immer auf sie verlassen, in jeder Situation. »Manchmal habe ich das Gefühl, du bist schon ewig da.«
»Nicht so lange wie du. Du bist ja schon fast eine Institution.« Freundlich lächelte Chris von ihrer muskulösen Höhe auf Michelle hinunter.
»Nicht in Disneyland.« Mit einer Art korrigierender Missbilligung hob Michelle die Augenbrauen. »In Disney World war ich ein paar Jahre.«
»Ist das so ein großer Unterschied?«, meinte Chris locker. »Dein Ruf ist dir vorausgeeilt.«
»Lassen wir das«, sagte Michelle, weil sie sich nicht ganz sicher war, was Chris mit diesem Ruf meinte, und nicht darüber diskutieren wollte. »Was ist nun mit den Sicherheitsmaßnahmen?«
»Wer wird hier übernehmen, solange du in Florida bist?« Chris beugte sich herunter und zeigte auf einen Punkt auf dem Bildschirm, als hätte er irgendetwas mit ihrer Frage zu tun.
»Solange ich in Florida bin?« Das war Michelle ja ganz neu. Wo kam denn diese Vermutung her?
»Na ja, Cindy ist ja schon unten. Und ihre Mutter lebt doch dort. Also . . . ihr seid doch . . . eine Familie.« Ganz erstaunt blickte Chris sie an. »Deshalb bin ich natürlich davon ausgegangen –«
Ungläubig schüttelte Michelle den Kopf. »Anscheinend geht jeder davon aus. Aber das habe ich nie gesagt. Ich bin immer bei der Arbeit an Weihnachten. Das war noch nie anders.«
»Du warst vorher aber auch noch nie verheiratet.« Diese nüchterne Feststellung machte Chris so, wie sie auch schon als Polizistin die Dinge immer von der Faktenseite her betrachtet hatte. Wenn es nicht gerade um Sheryl ging . . .
»Das scheint ein entscheidender Punkt zu sein.« Michelle seufzte.
»Siehst du das nicht so?« Nun runzelte Chris verständnislos die Stirn. »Willst du nicht mit Cindy zusammensein an Weihnachten?«
So hatte Michelle sich die Frage eigentlich noch nie gestellt. Ob sie das wollte. Nach ihren Wünschen ging es hier nicht. Es ging darum, was getan werden musste.
»Der Flug nach Miami ist eine Tagesreise«, sagte sie. »Einmal quer über den Kontinent von der Westküste in den äußersten Südosten.«
Chris zuckte mit einer einzelnen Augenbraue. »Soll das jetzt ein Argument sein?«
Nein, es war nur eine Ausrede, das wusste Michelle selbst. Aber das hätte sie nie laut gesagt. Sie war sich vieler Dinge bewusst, ohne sie auszusprechen. Auch wenn es keine Geheimnisse waren, behielt sie vieles lieber für sich. Eine alte Gewohnheit aus Kindertagen, als es ohnehin keinen Sinn gehabt hatte, etwas zu sagen, um etwas zu bitten oder sich zu beklagen.
Und ehrlich gesagt hatte ihr das im Geschäftsleben auch schon sehr oft geholfen. Je weniger das Gegenüber wusste, desto besser. Je weniger irgendjemand wusste . . .
Wutanfälle – ja, so konnte man seine Gefühle schon zeigen. Das schüchterte die Leute ein und brachte sie dazu, das zu tun, was man wollte. Was auch immer sie in so einem Wutanfall von sich gegeben hatte, das bedeutete gar nichts. Und das verriet auch nichts von ihren innersten Gefühlen. Von ihren wirklichen Gefühlen. Es war ungefährlich.
»Und wieder zurück«, setzte sie hinzu. »Das sind schon zwei Tage. Aber nur«, sie verzog das Gesicht, »wenn ich gleich wieder umkehre.«
»Das heißt, da ist die Weihnachtsfeier noch nicht drin.« Chris gab es auf, das Thema Sicherheitsmaßnahmen noch einmal auf den Tisch zu bringen, und stützte sich neben Michelle ab, um ihr in die Augen zu sehen. »Disneyland wird nicht zusammenbrechen, Boss, wenn du nicht hier bist.« Sie grinste. »Auch wenn du das denkst. Vertrau uns doch mal ein bisschen.«
»Uns?« Verständnislos hob Michelle die Augenbrauen.
»Sheryl und mir zuerst mal«, erklärte Chris geduldig. »Wir sind auf jeden Fall da und passen auf. Sheryl wird im Feuerwehrhaus schlafen, wenn es sein muss, das weißt du.«
»Dann habt ihr aber auch kein schönes Weihnachtsfest«, wandte Michelle ein.
»Ist das wichtig?« Chris richtete sich auf und schüttelte den Kopf. »Wir sind zusammen. Das ist alles, was zählt.« Sie schmunzelte. »Dann schlafe ich eben auch im Feuerwehrhaus.«
Auf einmal wurde Michelle misstrauisch. »Warum wollen mich alle hier weghaben?«, fragte sie.
Das brachte Chris dazu, die Augen zu rollen. »Niemand will dich hier weghaben«, widersprach sie. »Aber kannst du dich erinnern, was du mir damals gesagt hast, als wir dieses . . . Gespräch hatten?«
So taff sie war, die große Chris, sie wurde fast ein wenig rot. Solche ›Frauengespräche‹ lagen weder ihr noch Michelle, und doch war es damals nötig gewesen. Genauso wie Chris es offenbar jetzt für nötig befand, obwohl es ihr sichtlich peinlich war. Aber ein Feigling war sie nicht. Ganz im Gegenteil.
»Manchmal muss man über seinen Schatten springen«, fuhr sie deshalb fort. »Wo wäre ich jetzt, wenn ich damals nicht deinen Rat befolgt hätte? Ich weiß noch nicht einmal, ob ich je wieder mit Sheryl gesprochen hätte.« Sie ließ das so im Raum stehen, als wollte sie, dass Michelle darüber nachdachte und selbst zu dem für sie richtigen Schluss kam.
Statt etwas zu sagen, nahm Michelle jedoch nur das Tablet auf und betrachtete Chris’ Vorschläge. »Das ist gut so«, sagte sie dann. »Ich wüsste nicht, was man besser machen könnte.« Sie blickte zu Chris hoch und reichte ihr das Tablet. »Ich verlasse mich auf dich.«
Das war ein großer Vertrauensbeweis, und das wusste Chris auch. Sie zögerte noch kurz, dann nickte sie Michelle zu und ging hinaus.
4
Miami. Meine Lieblingsstadt. Mit einem innerlichen Grummeln biss Michelle die Zähne zusammen, als sie auf dem Flughafen in Miami ankam.
Früher hatte sie nie etwas gegen Miami gehabt, doch seit die Sache mit Cait passiert war . . . Aber Cait war nicht mehr hier. Jetzt war Miami die Stadt, in der Cindy war. Aus der sie stammte und in der ihre Mutter immer noch lebte, auf dem Familiensitz der Claybournes. Also sollte sie das Grummeln vielleicht vergessen.
Sie kannte den Club, von dem Candice gesprochen hatte. Es war der Club, in dem sie, Michelle, und Cindy sich kennengelernt hatten. Auch nicht gerade die beste Erinnerung . . . Bis auf die Tatsache an sich, dass Cindy und sie sich dort kennengelernt hatten. Sodass Cindy dann in Disney World auf Michelle zugekommen war, eben weil sie sich schon kannten. Auf eine intime Art, die dieser einen Begegnung auf keinen Fall entsprach. Michelle wollte lieber nicht daran denken, wie peinlich ihr das gewesen war. Nach dem, was vorher passiert war. Und alles nur wegen Cait . . . Nun biss sie doch noch einmal die Zähne zusammen.
Aber diese Zeiten waren vorbei. Cait war Vergangenheit. Cindy war die Gegenwart. Und die Zukunft.
Endlich konnte sie es nicht mehr verhindern zu lächeln. Obwohl sich ihre Stirn dann gleich wieder bewölkte. Würde Cindy sich überhaupt freuen, dass sie nun doch kam? Sie hatte ja sicher schon gar nicht mehr damit gerechnet, denn Michelle hatte sich nicht angekündigt. Vielleicht hatten Cindy und Candice tatsächlich schon –
Nein, das war unmöglich. Nicht Cindy. Aber so ganz sicher war sie sich trotzdem nicht. Vertrauen war für sie immer noch eine Art sehr fragiles Konstrukt.
Es stand für sie außer Frage, dass sie nicht in das Haus der Claybournes gehen würde. Lindsay Ann Claybourne war zwar jetzt ihre Schwiegermutter – daran konnte Michelle sich immer noch nicht gewöhnen, da sie altersmäßig gar nicht so weit auseinanderlagen –, aber genau das, diese selbstverständliche, freundliche Mütterlichkeit, konnte sie im Augenblick überhaupt nicht vertragen. Sie musste erst einmal allein hier ankommen.
Das würde Cindy wahrscheinlich nie verstehen. Für sie waren Menschen keine Bedrohung und auch keine Figuren auf einem Schachbrett, die man verschob oder in verschiedene Richtungen schickte, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Sie waren einfach . . . Menschen. Und Cindy nahm jeden Menschen so, wie er war. Egal, wie er auf sie zukam.
Wofür Michelle nur dankbar sein konnte. Denn so, wie sie das erste Mal auf Cindy zugekommen war . . . damals in jenem Hotelzimmer . . . das trieb ihr heute noch die Schamesröte ins Gesicht, obwohl sie überhaupt nicht dazu neigte, rot zu werden. Das wäre im Geschäftsleben äußerst schädlich gewesen. Da nahm einen kein Mann mehr ernst. Was sie ohnehin oft schon deshalb nicht taten, weil sie klein und zierlich war. Auch wenn die roten Haare es ein wenig wieder ausglichen.
Sie ging ganz automatisch auf den Taxistand zu und setzte sich in den ersten Wagen in der Reihe.
»Wohin, Lady?«, fragte der Taxifahrer nach ein paar Sekunden, weil sie nichts sagte, und blickte etwas ungeduldig in den Rückspiegel.
»In eine ruhige Ecke«, antwortete Michelle, als hätte ihr das jemand eingegeben.
»South Pointe Park?« Er hob die Augenbrauen und sah sie über den Spiegel an. »Oder nicht doch lieber Shopping? Ocean Drive?«
»Park klingt gut. Wenn es da ruhig ist«, gab Michelle zurück.
»Okay.« Er wandte seinen Blick in Richtung des Seitenspiegels, schaute nach hinten und fuhr los.
Während der Fahrt sah Michelle zwar durch das Fenster hinaus, aber in Wirklichkeit sah sie nichts. Und sie blickte auch nicht auf ihr Handy oder Tablet, wie sie es normalerweise tat, wenn ihre Chauffeurin sie fuhr oder sie in einer fremden Stadt in irgendeinem Taxi saß auf dem Weg zu einer geschäftlichen Konferenz oder Besprechung.
Nein, geschäftlich war das hier nicht. Es war eindeutig privat. Sehr privat.
Dieser private Teil ihres Lebens hatte massiv zugenommen, seit sie mit Cindy verheiratet war. Und er hatte schon vorher zugenommen, eigentlich fast schon seit dem Moment, als sie Cindy kennengelernt hatte. Spätestens aber, seit Cindy nach Disney World gekommen war. Erst jetzt erkannte sie, dass das ihr Leben praktisch auf den Kopf gestellt hatte. Weit mehr als jede von Keith’ Intrigen oder alle Angriffe, die sie beruflich hatte abwehren müssen.
Denn so sehr sie sich innerlich auch gewehrt hatte, sich auf eine private Beziehung, die über reinen Sex hinausging, einzulassen, äußerlich hatte es keinen Grund gegeben, Cindy abzuwehren. Sie war viel zu sanft und verständnisvoll, um so etwas herauszufordern.
Ja, es hatte Momente gegeben . . . Damals mit LaVerne McNamara zum Beispiel . . . Aber das war etwas anderes gewesen. Immer, wenn es um sie beide gegangen war, hatte Cindy eine unendliche Geduld bewiesen.
»Wir sind da, Lady.« Der Taxifahrer blickte erst in den Spiegel, dann drehte er sich über die Schulter zu Michelle um, als sie nicht reagierte. »Hey. Wir sind da. Hier wollten Sie doch hin. South Pointe Park. Oder jetzt doch nicht?«
»Doch. Natürlich.« Er hatte sie so aus ihren Gedanken gerissen, dass sie ihm nur ihre Kreditkarte reichte und ausstieg.
»Hey! Soll ich die behalten?« Er ließ das Fenster herunterfahren und streckte seinen Arm hinaus.
Sie schüttelte den Kopf, ging wieder zum Wagen zurück und nahm die Karte. »Zwanzig Prozent Trinkgeld haben Sie schon mit eingezogen?«
»Nope.« Er streckte seine Hand wieder aus, nahm die Karte erneut und reichte sie Michelle kurz darauf wieder hinaus. »Danke, Lady.« Das erste Mal wirkte er etwas freundlicher. »Schönen Tag noch. Und . . . Frohe Weihnachten.« Die Seitenscheibe fuhr noch hoch, um die Kühle der Klimaanlage im Innenraum zu halten, während er sich schon auf die Straße einfädelte.
»Frohe Weihnachten«, murmelte Michelle auch, aber das konnte er selbstverständlich nicht mehr hören.
Zwar betrug die Lufttemperatur 26 Grad, wie sie an den hier aufgestellten Säulen ablesen konnte, die Wassertemperatur jedoch nur 22. Ein bisschen kalt zum Baden. Aber deshalb war sie ja auch nicht hergekommen. Obwohl sich einige Touristen, die aus Europa wahrscheinlich kälteres Wetter um diese Jahreszeit gewöhnt waren, johlend im Wasser tummelten.
Es waren jedoch so wenige, dass der Lärm nicht störte. Aus dieser Entfernung wirkte er fast nur wie ein mildes, kaum zu identifizierendes Hintergrundrauschen. Der Taxifahrer hatte ihren Wunsch beachtet und sie tatsächlich an eine ruhige Ecke gebracht. Schon indem sie ein paar Schritte in den Park hineinging, quer über den grünen Rasen und unter den Palmen hindurch, merkte sie das.
Es war selten, dass sie Zeit hatte, sich ihren Gedanken zu widmen. Ihren privaten Gedanken wiederum, denn im geschäftlichen Bereich nahm sie sich die Zeit. Einfach, weil es sein musste. Man musste Lösungen finden für Probleme, die sich jeden Tag stellten. Zehntausende von Mitarbeitern und Millionen von Besuchern sorgten dafür, dass sich das nie änderte.
Deshalb war diese plötzliche Ruhe ungewohnt. Sie wurde fast nervös davon. Langsam schlenderte sie weiter und blieb dann an einer Art Aussichtspunkt stehen, von wo man den Strand, ankommende und abfahrende Schiffe und dahinter das weite Meer in all seiner Unendlichkeit sehen konnte. Das Meer hatte sie in Kalifornien auch, aber sie stellte wieder einmal fest, dass es hier an der Ostküste und zudem noch im Süden, nur einen Katzensprung entfernt von den Bahamas, völlig anders war als im vom Smog erdrückten Los Angeles.
Das ergab sich jedoch schon aus der Natur der Sache, denn Kalifornien grenzte an den Pazifik, den sogenannten Stillen Ozean, und Florida an den Atlantik. Dennoch war es in Kalifornien nicht still und hier nicht wilder. Wenn nicht gerade ein Hurricane tobte. Im Gegenteil, in diesem Moment kam sie sich so vor, als wäre sie im Auge des Sturms gelandet, in dem es absolut ruhig war.
Es gab jedoch gar keinen Sturm und demgemäß auch kein Auge, jedenfalls nicht, wenn man die äußeren Wetterbedingungen betrachtete. Die Wetterbedingungen in ihrem Inneren – das war eine ganz andere Geschichte. Sich mit ihren Gefühlen zu beschäftigen war ihr immer noch fremd. Lösungen für Probleme zu finden war ihr wesentlich vertrauter. Und da fühlte sie sich auch mehr auf der sicheren Seite, denn damit kannte sie sich aus.
Zudem gab es auch immer eine Lösung, man musste sie nur finden. In Gefühlsdingen war das nicht unbedingt der Fall. Dort konnte es auch einfach nur darum gehen, darüber zu reden. Ohne dass man nach einer Stunde – oder auch nach vier Stunden – auch nur einen Schritt weiter war. Merkwürdigerweise befriedigte das die meisten Frauen durchaus.
Michelle war aber nicht so. Was hatte sie also hierhergetrieben? Was erwartete sie überhaupt davon, dass sie hergekommen war? Wäre es nicht besser gewesen, einfach zu akzeptieren, dass Cindy und sie unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie man Weihnachten feierte – beziehungsweise nicht feierte? Sich also darüber zu einigen, dass man sich nicht einig war?
Sie atmete tief durch und sog die feuchte Meeresluft wie ein Lebenselixier, das sie jetzt unbedingt brauchte, in ihre Lungen ein. Ihr war ganz klar, sie suchte immer noch nach einer Lösung, und dabei konnte sie noch nicht einmal so richtig das Problem benennen. Sicherlich, sie hatte bis jetzt noch nicht viel Erfahrung als Ehefrau. Aber musste eine Ehe es nicht auch einmal aushalten, dass man verschiedener Meinung war?
Eine Weile starrte sie übers Meer, und als ob sich dadurch, dass der Himmel blau und klar über ihr schwebte, auch in ihrem Inneren etwas klärte, kamen ihr plötzlich Gedanken, die sie so noch nie gehabt hatte. Zum Beispiel dieser: Sie hatte Cindy nicht zugehört.
Ihre Stirn runzelte sich ganz von selbst, als sie das dachte. Langsam kam ihr zumindest ein Teil des Problems zu Bewusstsein. Statt den Vorschlag ihrer eigenen Frau sofort abzuschmettern, weil er nicht zu ihrer üblichen Routine passte, zu dem, was sie gewöhnt war und auch für notwendig hielt, hätte sie mit Cindy darüber reden sollen. Vielleicht hätten sie dann eine Lösung gefunden, die zu ihnen beiden passte.
Aber das wäre auf jeden Fall ein Kompromiss gewesen. Und sie hasste Kompromisse.
Da sie es sich nicht hatte nehmen lassen, am Morgen – oder eher halb in der Nacht, bis die Sonne kaum aufgegangen war – noch ein paar Stunden im Büro zu verbringen und erst danach abgeflogen war, neigte sich der Tag nun bereits seinem Ende zu. Der Sonnenuntergang fand um diese Jahreszeit immer so gegen halb sechs statt, das wusste sie noch sehr gut aus ihrer Zeit in Orlando. In Los Angeles ging die Sonne noch früher unter, und so hatte sie durch ihren Flug nach Südosten sogar eine gute Dreiviertelstunde mehr Sonnenlicht gewonnen.
Woran ihr im Moment allerdings nicht sehr viel lag. Die wenigen Menschen, die sich bis vor kurzem noch im Wasser getummelt hatten, und auch die paar, die hier mit einem Segway durch den Park gefahren oder eher lautlos geglitten waren, schienen wie auf einen Schlag verschwunden. Auf einmal herrschte eine fast gespenstische Ruhe, als wäre dies hier wirklich das Ende der Welt, das niemand erreichen konnte.